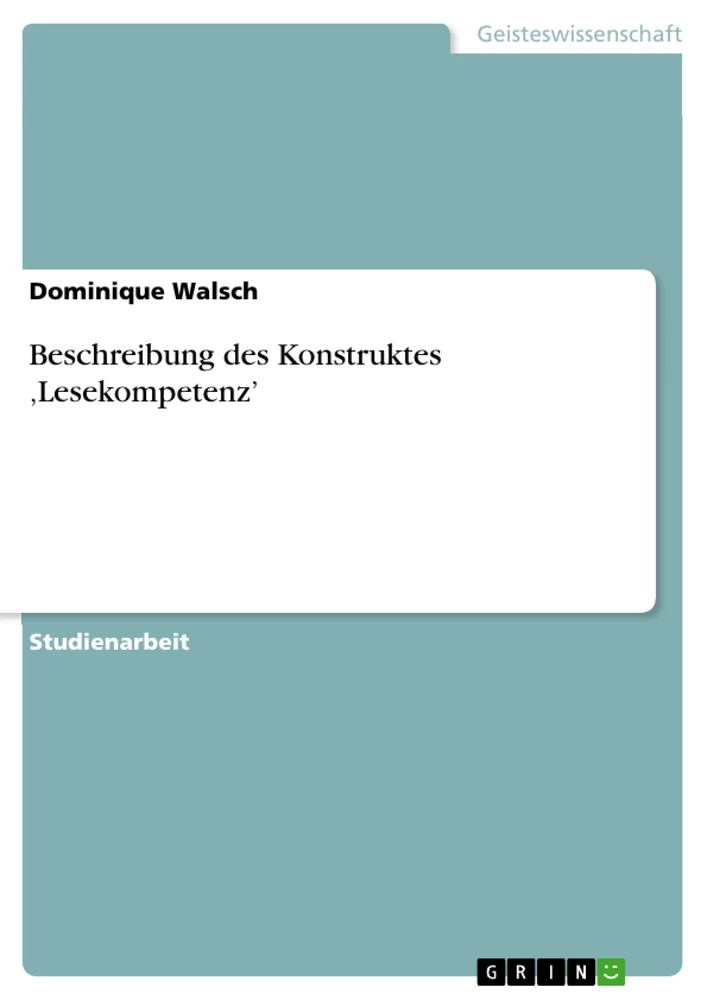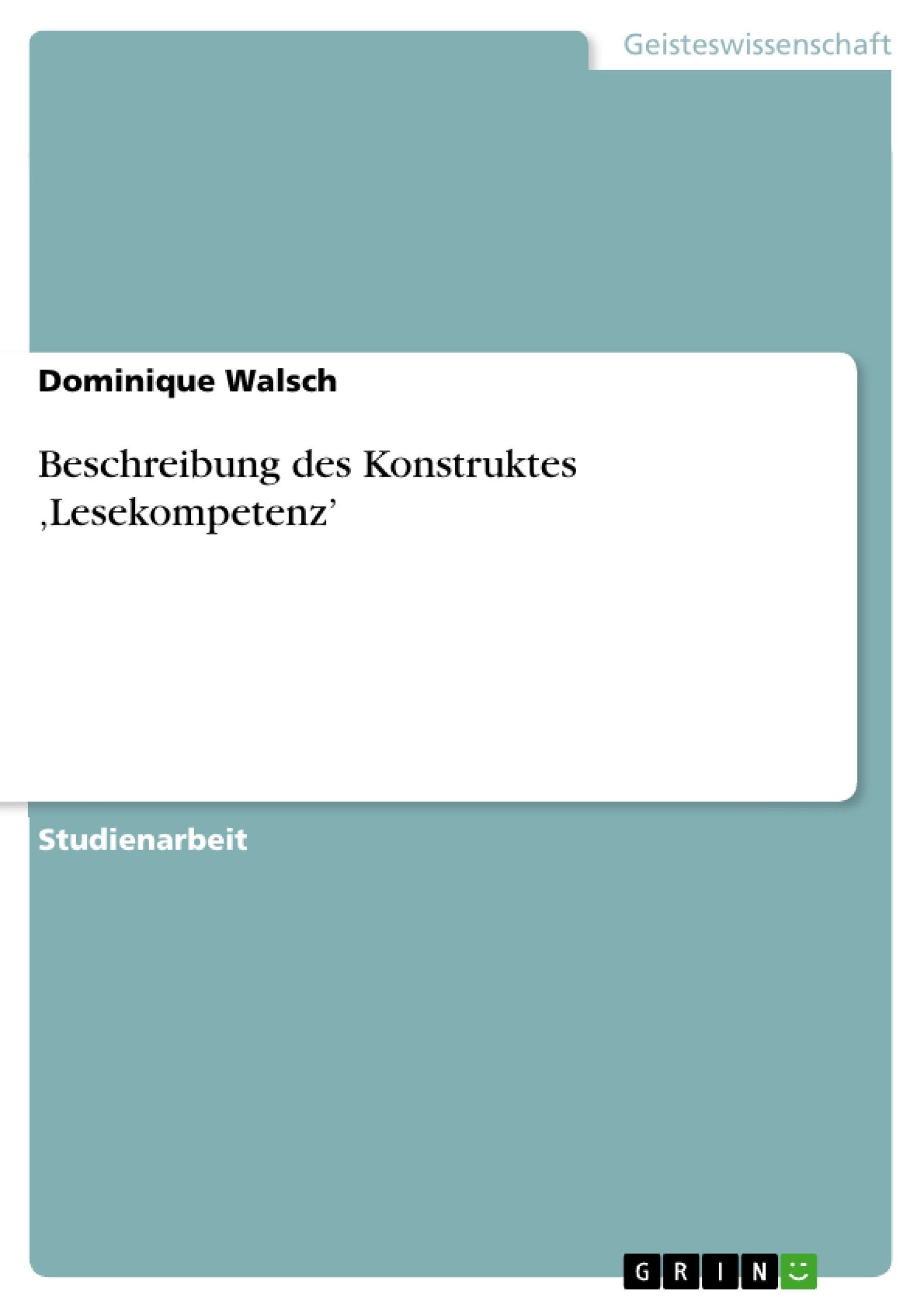1. Definition von Lesekompetenz
Als Lesekompetenz im allgemeinen Sinne versteht man die Fähigkeit,
geschriebene Texte unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren
Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und in einen größeren
Zusammenhang einordnen zu können, sowie in der Lage zu sein, Texte für
verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen.
2. Geschichtliche Entwicklung der Lesefähigkeit
Im Altertum war Lesekompetenz eher selten zu finden. Selbst Könige
konnten trotz Privatleher oft nicht richtig lesen. Deshalb gab es damals Schreiber, die speziell ausgebildet waren und das Lesen und Schreiben übernahmen.
Nach der Erfindung des Buchdruckes von Johannes Gutenberg und der
massenhaften Verbreitung der Lutherbibel im Zeitalter der Reformation
(16. Jahrhundert) nahm die Lesekompetenz in Mitteleuropa stark zu.
Später brachte auch die Entstehung der Sonntagsschulen im
19.Jahrhundert große Fortschritte.
Schließlich förderten die Einführung der allgemeinen Schulpflicht und die Einrichtung öffentlicher Bilbliotheken in der Neuzeit die Lesekompetenz in der Bevölkerung ungemein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition von Lesekompetenz
- 2. Geschichtliche Entwicklung der Lesefähigkeit
- 3. Die vier Teilkompetenzen der Lesekompetenz
- 3.1 Kognitive Teilkompetenz
- 3.2 Emotionale Teikompetenz
- 3.3 Motivationale Teilkompetenz
- 3.4 Interaktive Teikompenenz
- 4. Dimensionen und Einflußfaktoren der Lesekompetenz
- 5. Die Ebenen des Leseprozesses
- 6. Interindividuelle Unterschiede in Teilprozessen
- 6.1 Basale Wahrnehmungsprozesse
- 6.1.1 Augenbewegung (Okulomotorik)
- 6.1.2 Wahrnehmungsspanne
- 6.2 Prozesse auf Wortebene
- 6.2.1 Lexikalischer Zugriff
- 6.2.2 phonologische Rekodierung
- 6.2.3 Nutzung des Satzkontextes bei der Worterkennung
- 6.3 Prozesse auf Satzebene
- 6.3.1 Syntaktische Prozesse
- 6.4 Prozesse auf Textebene
- 6.4.1 Globale Kohärenzbildung
- 6.4.2 Inhaltliches Vorwissen
- 6.4.3 Arbeitsgedächtniskapazität
- 6.1 Basale Wahrnehmungsprozesse
- 7. Theorien zur Lesekompetenz:
- 7.1 Theorie der verbalen Effizienz
- 7.2 Kapazitätstheorie
- 7.3 Interaktiv-kompensatorisches Modell
- 7.4 Integrationsprozesse auf Textebene
- 8. Fazit
- 9. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konstrukt der Lesekompetenz und analysiert dessen historische Entwicklung, die verschiedenen Teilkompetenzen, sowie die relevanten Dimensionen und Einflussfaktoren. Darüber hinaus werden die Ebenen des Leseprozesses und die interindividuellen Unterschiede in den Teilprozessen betrachtet.
- Definition und historische Entwicklung der Lesekompetenz
- Die vier Teilkompetenzen der Lesekompetenz
- Dimensionen und Einflussfaktoren der Lesekompetenz
- Die Ebenen des Leseprozesses
- Interindividuelle Unterschiede in den Teilprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert Lesekompetenz als die Fähigkeit, geschriebene Texte in ihrer Aussage, Absicht und formalen Struktur zu verstehen und für verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Lesefähigkeit, beginnend vom Altertum bis zum 20. Jahrhundert, wobei die Auswirkungen des Buchdrucks, der allgemeinen Schulpflicht und neuer Medien wie dem Fernseher thematisiert werden.
Kapitel drei gliedert die Lesekompetenz nach Flath (2004) in vier Teilkompetenzen: die kognitive, die emotionale, die motivationale und die interaktive Teilkompetenz. Die kognitiven Kompetenzen beinhalten das Herausfiltern von Informationen, die Interpretation des Textes und die Reflexion der gelesenen Inhalte im Kontext von Vorwissen. Die emotionale Teilkompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit, Texte nach persönlichen Bedürfnissen auszuwählen und sie mit eigenen Gefühlen und Erfahrungen zu verknüpfen.
Die motivationale Teilkompetenz umfasst die Motivation, Texte zu lesen, die Zielstrebigkeit, die Ausdauer und die positive Einstellung zum Lesen. Die interaktive Teilkompetenz schließlich betrifft die Kommunikation über den Text und die gemeinsame Reflexion mit anderen.
Kapitel vier behandelt Dimensionen und Einflussfaktoren der Lesekompetenz, wobei insbesondere auf die Theorie der generativen Transformationsgrammatik von Chomsky (1965) eingegangen wird.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Themen der vorliegenden Arbeit sind Lesekompetenz, Lesefähigkeit, Teilkompetenzen, Dimensionen, Einflussfaktoren, historische Entwicklung, Medien, Textverständnis, Interindividuelle Unterschiede und Leseprozess.
- Quote paper
- Dominique Walsch (Author), 2005, Beschreibung des Konstruktes ‚Lesekompetenz’, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/173196