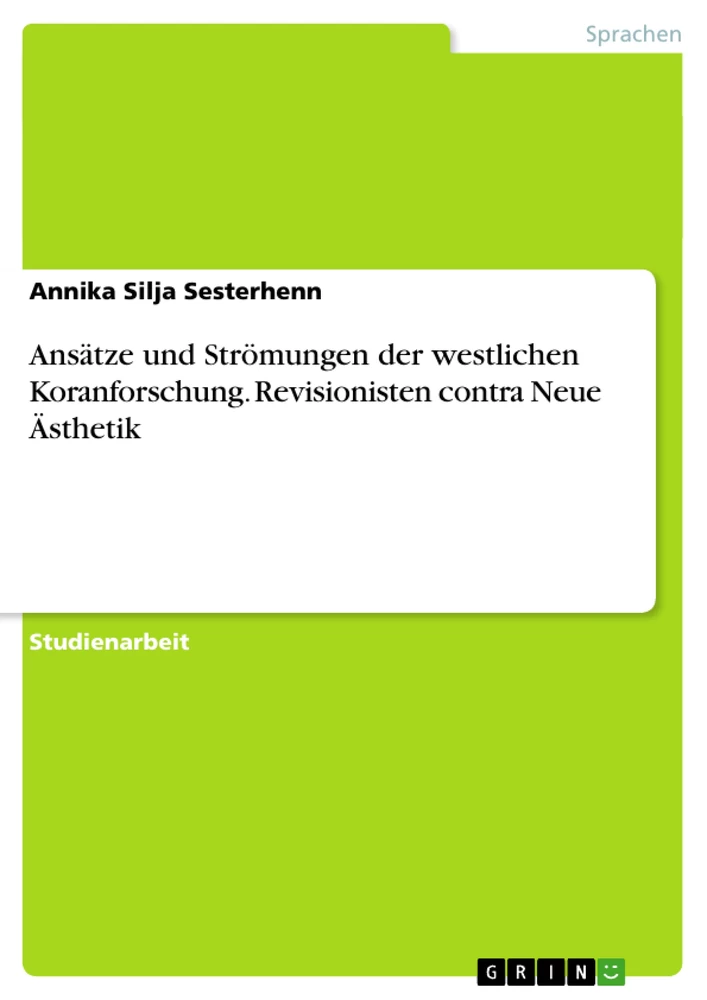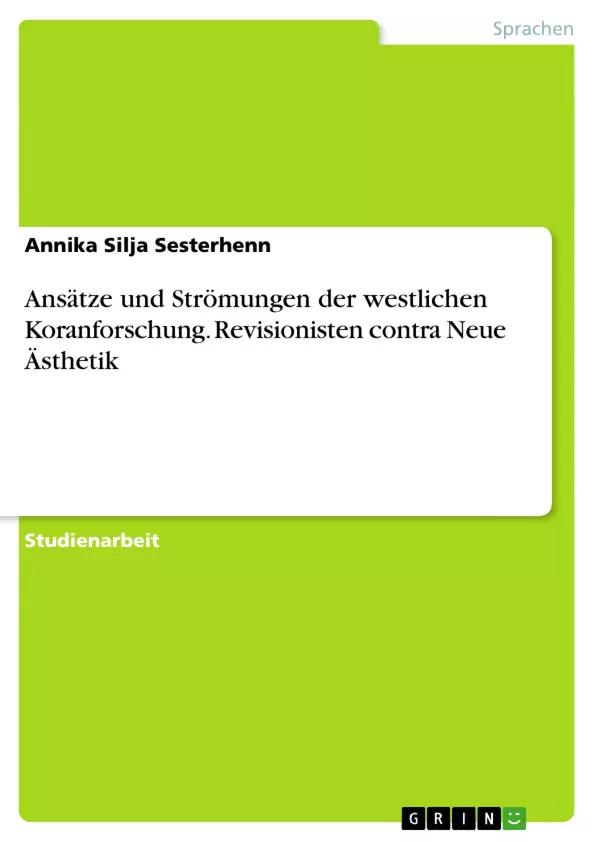Wissenschaft im Allgemeinen ist ein rationales System des Erkenntnisgewinns. Ihre Ergebnisse müssen nachprüfbar sein, müssen über bloße Meinung, Glauben, Erfahrung, Weisheit, Sinnlichkeit oder Gefühl hinausgehen und mit Quellen begründet sein. Geisteswissenschaften haben dabei eine Sonderstellung. Sie müssen, in höherem Grade als andere Bereiche der Forschung, stets die Gratwanderung begehen, auf rationaler Ebene Phänomene zu untersuchen, die sich eben mit Glauben, Gefühlen, Sinnlichkeit und subjektiven Erfahrungen befassen. Dass die Wissenschaftler bei dieser Aufgabe selbst immer wieder mit ihren grundeigenen subjektiven Empfindungen konfrontiert werden ist unausweichlich. Ein altes, beinahe ebenso unausweichliches Problem jedweder Forschung ist es, dass wer nach Beweisen für seine subjektiven Empfindungen sucht, meist auch welche findet. Ein Literaturwissenschaftler, der davon überzeugt ist, Shakespeare habe nur die Hälfte seines Werks selbst geschrieben und den Rest von seinen Geliebten geschenkt bekommen, wird das in komplizierten Arbeiten wissenschaftlich zu untermauern wissen. Genauso wie jener, der Shakespeare alleinverantwortlich für sein großes, weltbedeutendes Werk hält. Diese Arbeit soll und kann nun in keinster Weise beweisen wer in der Koranforschung seinen subjektiven Ideen erlegen ist und diese durch zweifelhafte wissenschaftliche Thesen zu stützen versucht oder wer auf dem hundertprozentig rein objektiv-wissenschaftlichen Weg geblieben ist, dessen tatsächliche Existenz anzweifelswert ist. Sie soll eher im Allgemeinen aufzeigen, zu welch unterschiedlichen Ergebnissen Forscher kommen können, die dasselbe Werk untersuchen. Wobei bei einigen Beispielen eine eher wissenschaftsferne Motivation zu erkennen sein wird.
Im folgenden Kapitel werden einführend allgemein verbreitete und in den meisten wissenschaftlichen Kreisen als Grundlage anerkannte Informationen zur Geschichte des Korans und seiner Redaktion, sowie ein kleiner Überblick über seine wichtigsten formalen und inhaltlichen Kennzeichen angeführt werden. Kapitel 3 gibt anschließend einen Einblick in die westliche Koranwissenschaft und ihre verschiedenen Ansätze. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf jenen Arbeiten, deren Thesen von den allgemein anerkannten Basisannahmen über die Geschichte und den Inhalt des Koran abweichen. Das vierte Kapitel stellt die Arbeit „Gott ist schön- Das ästhetische Erleben des Koran“ von Navid Kermani und damit eine neue Herangehensweise an das Thema vor.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeines über den Koran
- 2.1 Kurze Einführung in Form und Inhalt
- 2.2 Mohammed
- 3. Die verschiedenen Strömungen und Ansätze der westlichen Koranwissenschaft
- 4. Neue Wege: „Gott ist schön-Das ästhetische Erleben des Koran“ von Navid Kermani
- 5. Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Ansätze der westlichen Koranwissenschaft, insbesondere solche, die von allgemein anerkannten Annahmen abweichen. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ergebnisse, die aus der Untersuchung desselben Werkes resultieren können, und zeigt dabei auch wissenschaftsexterne Motivationen auf.
- Die Geschichte und Redaktion des Korans
- Formale und inhaltliche Kennzeichen des Korans
- Verschiedene Strömungen und Ansätze der westlichen Koranwissenschaft
- Abweichende Thesen zur Geschichte und zum Inhalt des Korans
- Eine neue Herangehensweise an das Thema Koran (Navid Kermani)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Herausforderungen geisteswissenschaftlicher Forschung, insbesondere die Auseinandersetzung mit subjektiven Empfindungen bei der Untersuchung von Glauben und Erfahrung. Sie verweist auf die Problematik der subjektiven Voreingenommenheit in der Forschung und betont, dass die Arbeit nicht beweisen kann, wer in der Koranforschung objektiv geblieben ist, sondern die unterschiedlichen Forschungsergebnisse aufzeigen will, auch solche mit erkennbar wissenschaftsexterner Motivation.
2. Allgemeines über den Koran: Dieses Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in den Koran als Grundlage des Islam. Es beschreibt den Koran als Sammlung der Offenbarungen Gottes an Mohammed, erläutert die Struktur in Suren und Verse und diskutiert die Bedeutung des arabischen Originals und der Rezitation. Die inhaltliche Vielfalt des Korans wird erwähnt, von Geschichten früherer Propheten bis zu religiösen und weltlichen Gesetzen. Der Abschnitt thematisiert die i'gaz-Lehre, die die Unnachahmlichkeit des Korans betont und dessen arabische Sprache als unersetzlich für sein Verständnis darstellt. Schließlich wird die Einteilung in mekkanische und medinensische Suren erläutert, wobei die spätere schriftliche Fixierung des Korans unter Uthman Ibn Affan hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Koran, Koranwissenschaft, westliche Koranwissenschaft, Revisionismus, Neue Ästhetik, mekkanische Suren, medinensische Suren, i'gaz-Lehre, Navid Kermani, Offenbarung, Rezitation, arabische Sprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze der westlichen Koranwissenschaft, insbesondere solche, die von allgemein anerkannten Annahmen abweichen. Sie untersucht die unterschiedlichen Ergebnisse, die aus der Untersuchung desselben Werkes resultieren können, und zeigt dabei auch wissenschaftsexterne Motivationen auf. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit dem Buch „Gott ist schön-Das ästhetische Erleben des Koran“ von Navid Kermani als Beispiel für eine neue Herangehensweise.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einführung in den Koran, seine Geschichte und Redaktion, seine formalen und inhaltlichen Kennzeichen, sowie die verschiedenen Strömungen und Ansätze der westlichen Koranwissenschaft. Es werden abweichende Thesen zur Geschichte und zum Inhalt des Korans diskutiert, mit besonderem Fokus auf Kermanis Ansatz. Die Herausforderungen geisteswissenschaftlicher Forschung, insbesondere die Auseinandersetzung mit subjektiven Empfindungen bei der Untersuchung von Glauben und Erfahrung, werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) betont die Herausforderungen der geisteswissenschaftlichen Forschung und die Problematik der subjektiven Voreingenommenheit. Kapitel 2 (Allgemeines über den Koran) bietet eine Einführung in den Koran, seine Struktur, die i'gaz-Lehre und die Einteilung in mekkanische und medinensische Suren. Kapitel 3 behandelt die verschiedenen Strömungen und Ansätze der westlichen Koranwissenschaft. Kapitel 4 analysiert Kermanis Werk als Beispiel für eine neue Herangehensweise. Kapitel 5 (Schlussbemerkungen) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis des Textes?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Koran, Koranwissenschaft, westliche Koranwissenschaft, Revisionismus, Neue Ästhetik, mekkanische Suren, medinensische Suren, i'gaz-Lehre, Navid Kermani, Offenbarung, Rezitation, arabische Sprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Vielfalt und die unterschiedlichen Interpretationen der Koranforschung aufzuzeigen. Sie möchte demonstrieren, wie verschiedene Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können und welche Rolle wissenschaftsexterne Motivationen dabei spielen können. Es geht nicht darum, die "objektive" Wahrheit über den Koran zu finden, sondern die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen zu beleuchten.
Wer ist Navid Kermani und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Navid Kermani ist ein deutscher Schriftsteller und Islamwissenschaftler. Seine Arbeit „Gott ist schön-Das ästhetische Erleben des Koran“ dient in dieser Arbeit als Beispiel für eine neue, von traditionellen Ansätzen abweichende Herangehensweise an die Interpretation des Korans. Seine Perspektive wird analysiert und im Kontext der westlichen Koranwissenschaft eingeordnet.
- Arbeit zitieren
- Annika Silja Sesterhenn (Autor:in), 2003, Ansätze und Strömungen der westlichen Koranforschung. Revisionisten contra Neue Ästhetik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17247