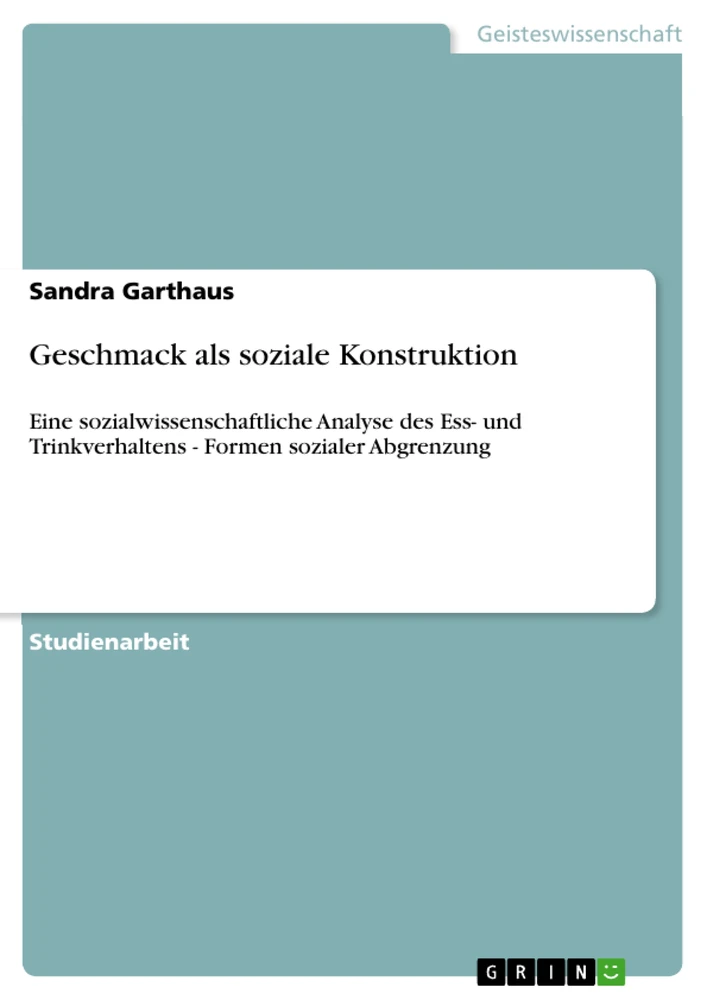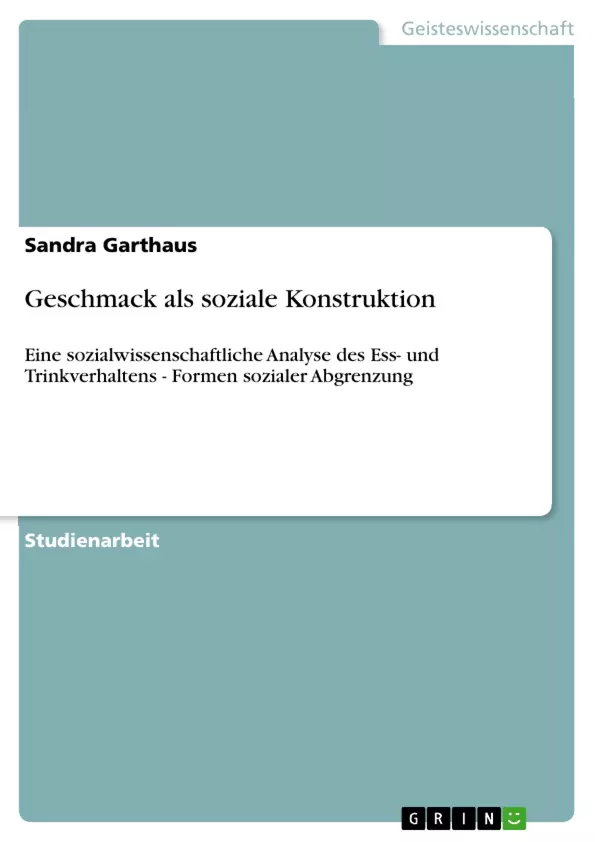Die Nahrungsaufnahme ist ein alltäglicher essentieller Vorgang bei Mensch und Tier. Betrieben wird er mit einer enormen Selbstverständlichkeit und scheinbar ohne jegliche Hintergedanken. Es steckt jedoch noch viel mehr hinter dem Essen der Menschen. „Nicht alles, was sich zur Deckung von Energie- und Nährstoffbedarfen eignet, wird als Nahrung betrachtet“ (Prahl/Setzwein 1999, 89). Aber warum ist dies so? Für diese ‚Eigenart’ muss es Gründe geben, die sowohl die Ess-, als auch die Trinkkultur beeinflusst haben. Diese Gründe haben dafür gesorgt, dass sich Gesellschaften unterschiedlich entwickelt haben. Diese Differenz macht sich in ihrer Art zu Essen und zu Trinken bemerkbar.
In der folgenden Arbeit möchte ich die Frage klären, wie sich diese Verhaltensweisen entwickelt haben. Dafür werde ich die Ess- und Trinkkultur sozialwissenschaftlich untersuchen. Ich werde verschiedene Aspekte hinzuziehen, wie die kulturellen und religiösen Bestimmungen, die die Essgewohnheiten verschiedener Gesellschaften unterscheiden. Die Sinngebung der Nahrungsgewohnheiten, damit sind die Art und Weise des Konsumierens, die Esssitten und -normen und kulturellen Bewertungen gemeint, ist nämlich eine primäre Institution des Essens. Ich werde die Gegensatzstrukturen der Essstile, sowie den Vegetarismus aufzeigen. In einem seperaten Punkt gehe ich näher auf die Trinkkultur ein und werde herausstellen, wie sie als Instrumentarium zur sozialen Differenzierung eingesetzt wird. In einem abschließenden Fazit werde ich resümierend auf die Arbeit zurückblicken und die Hauptthesen zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschmack als Abgrenzungskriterium
- kulturelle Bestimmungen
- Erklärungsmuster
- Säkularisierungsprozess
- soziale Faktoren
- Konsummuster
- Der Vegetarismus
- kulturelle Bestimmungen
- Trinkkultur
- Mittel zur sozialen Differenzierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der sozialwissenschaftlichen Analyse des Ess- und Trinkverhaltens und untersucht, wie diese Verhaltensweisen als Formen sozialer Abgrenzung fungieren. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung dieser Verhaltensweisen zu verstehen und aufzuzeigen, wie kulturelle, religiöse und soziale Faktoren den Geschmack und die Konsummuster beeinflussen.
- Geschmack als soziales Konstrukt
- Kulturelle Bestimmungen und ihre Auswirkungen auf das Essverhalten
- Soziale Faktoren, die den Konsum beeinflussen
- Trinkkultur als Mittel zur sozialen Differenzierung
- Die Rolle des Vegetarismus in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beschreibt den Hintergrund der Untersuchung. Sie verdeutlicht, dass Ess- und Trinkkultur über den bloßen Grundbedarf hinausgehen und wichtige soziale Funktionen erfüllen.
- Geschmack als Abgrenzungskriterium: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff des Geschmacks und seine soziale Konstruktion. Es werden die kulturellen Bestimmungen und ihre Bedeutung für die Auswahl und Interpretation von Nahrungsmitteln erörtert. Weiterhin wird das Erklärungsmuster für Esstabus erläutert.
- Trinkkultur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Trinkkultur als Instrumentarium zur sozialen Differenzierung. Es zeigt auf, wie verschiedene Gesellschaften ihre Trinkgewohnheiten als Mittel der Abgrenzung nutzen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Ess- und Trinkkultur, Geschmack, soziale Konstruktion, Abgrenzung, kulturelle Bestimmungen, soziale Faktoren, Konsummuster, Vegetarismus, Trinkkultur, Differenzierung und Sozialisation.
- Arbeit zitieren
- Sandra Garthaus (Autor:in), 2007, Geschmack als soziale Konstruktion, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/171311