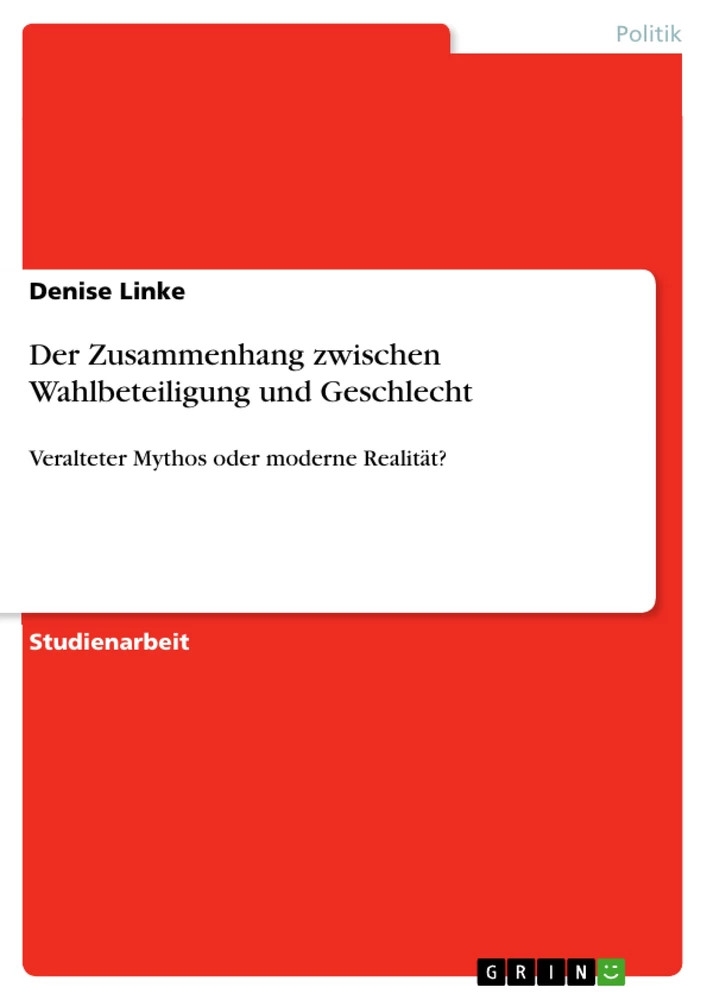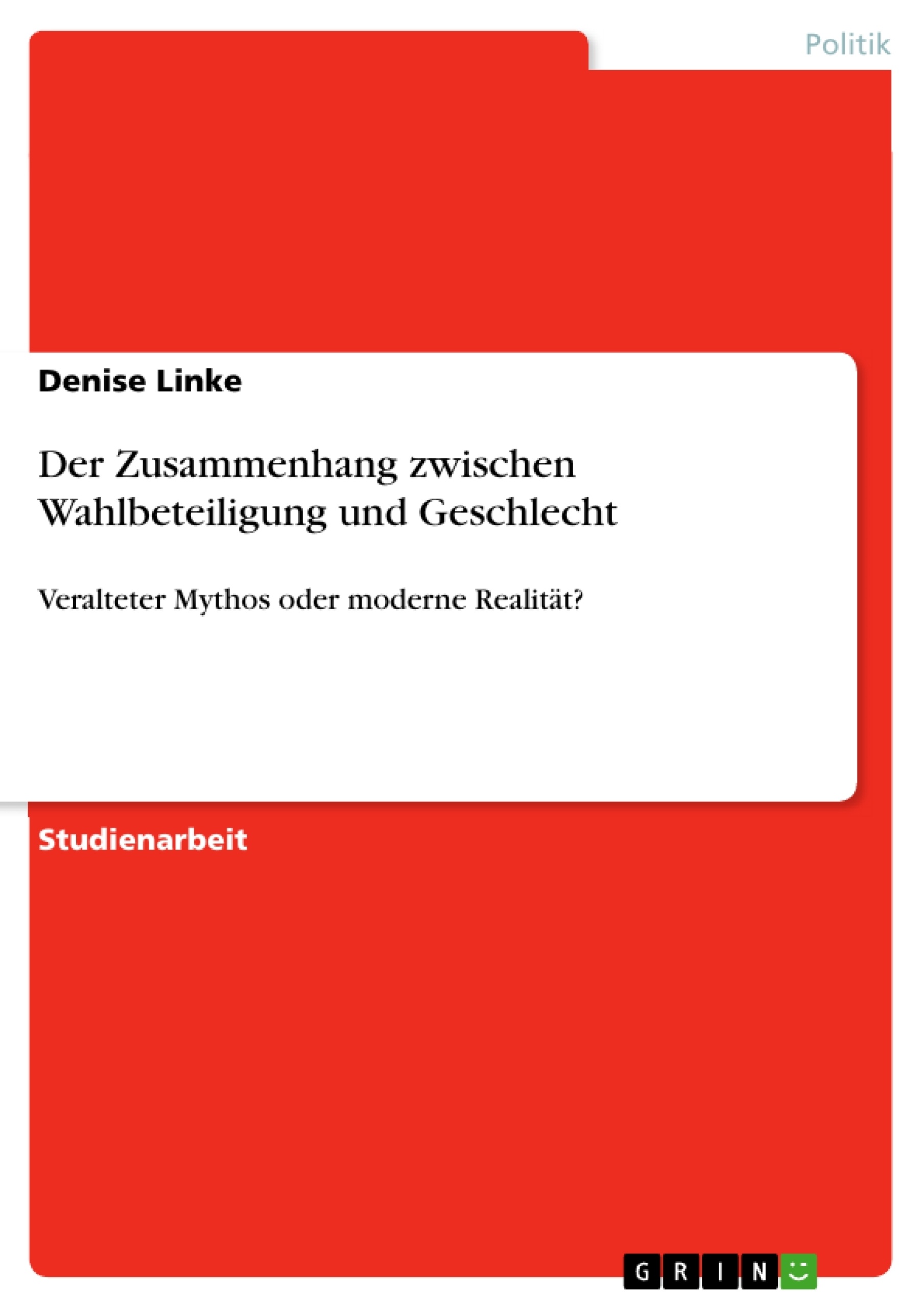Seit der Einführung des Frauenwahlrechts 1918 hat sich eine ganze Menge im Wahlverhalten von Frauen und Männern verändert, und auch die Wahlbeteiligung schwankte im Zeitfluss. Sowohl die Beteiligungsrate als auch die verschiedenen Ausprägungen der Beteiligung unterlagen einem ständigen Wandel und einer stetigen Entwicklung, bedingt durch historische Ereignisse und politische Begebenheiten. War die Frauenwahlbeteiligung zu Beginn noch gering, wuchs sie in den Folgejahren bereits und auch die Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen schmolzen im Laufe der Jahre. Wie kann diese Nivellierung der Geschlechterunterschiede erklärt werden und ist sie real oder nur ein Mythos, welchen uns die Wahrnehmung unserer Umgebung und der Medien vorgaukelt? Gibt es andere Faktoren, welche für die Wahlbeteiligung ausschlaggebender sind als das Geschlecht? Inwieweit greifen die allgemeingültigen Klischees der politisch desinteressierten Hausfrau und des engagierten Ehegatten? Im Folgenden möchte ich die Realität aus den festgesetzten Vorstellungen filtern und schließlich klären, ob sich die seit 1918 gepflegten Vorurteile der Frau als notorischer Nichtwählerin bewahrheiten, oder ob wir dieses lang gepflegte Bild ad acta legen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Ein historischer Abriss: Die Wahlbeteiligung der Frauen seit 1918
- Theoretischer Teil: Soziologische Ansätze zur Erklärung der Frauenwahlbeteiligung
- Praktischer Teil: Endlich Tacheles: Wie oft gehen Frauen wählen und wie hängt das mit dem politischen Interesse zusammen?
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Frauenwahlbeteiligung seit 1918 und beleuchtet die Gründe für die Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen. Sie untersucht verschiedene soziologische Ansätze, um die Wahlbeteiligung von Frauen zu erklären.
- Die Entwicklung der Frauenwahlbeteiligung seit 1918
- Soziologische Ansätze zur Erklärung der Frauenwahlbeteiligung
- Der Einfluss von politischem Interesse auf die Wahlbeteiligung
- Die Rolle von Geschlecht und sozialem Status in der Wahlentscheidung
- Die Bedeutung von Tradition, Information und Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Ein historischer Abriss: Die Wahlbeteiligung der Frauen seit 1918
Die Einleitung beleuchtet die Einführung des Frauenwahlrechts im Jahr 1918 und die anschließende Entwicklung der Wahlbeteiligung von Frauen. Sie zeigt, dass die Wahlbeteiligung von Frauen zunächst gering war, aber im Laufe der Zeit gestiegen ist. Die Einleitung stellt die Frage, ob die Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen real sind oder ob sie durch gesellschaftliche Vorurteile und Klischees geprägt sind.
Theoretischer Teil: Soziologische Ansätze zur Erklärung der Frauenwahlbeteiligung
Der theoretische Teil untersucht verschiedene soziologische Ansätze, die versuchen, die Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen zu erklären. Er beleuchtet das Rational-Choice-Modell und den sozialpsychologischen Ann-Arbor-Ansatz.
Praktischer Teil: Endlich Tacheles: Wie oft gehen Frauen wählen und wie hängt das mit dem politischen Interesse zusammen?
Der praktische Teil analysiert die Faktoren, die die Wahlbeteiligung von Frauen beeinflussen, und untersucht den Zusammenhang zwischen politischem Interesse und Wahlbeteiligung. Er betrachtet auch die Rolle von Geschlecht und sozialem Status in der Wahlentscheidung.
Schlüsselwörter
Frauenwahlbeteiligung, Wahlverhalten, Soziologische Ansätze, Rational-Choice-Modell, Ann-Arbor-Ansatz, Politisches Interesse, Geschlecht, Sozialer Status, Tradition, Information, Motivation.
- Quote paper
- Denise Linke (Author), 2010, Der Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und Geschlecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170844