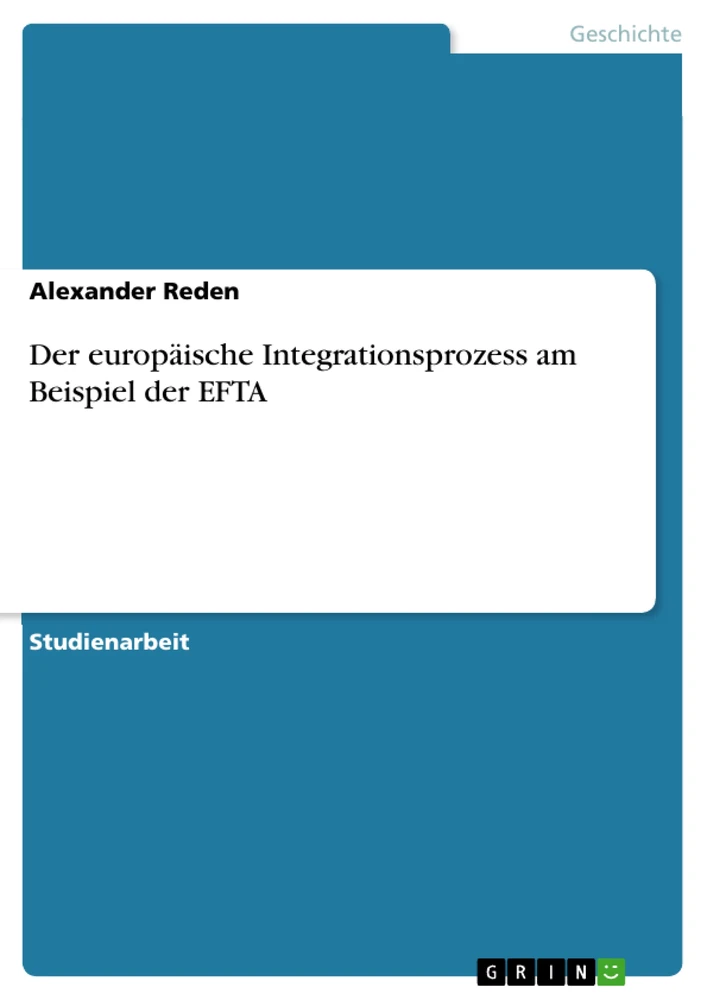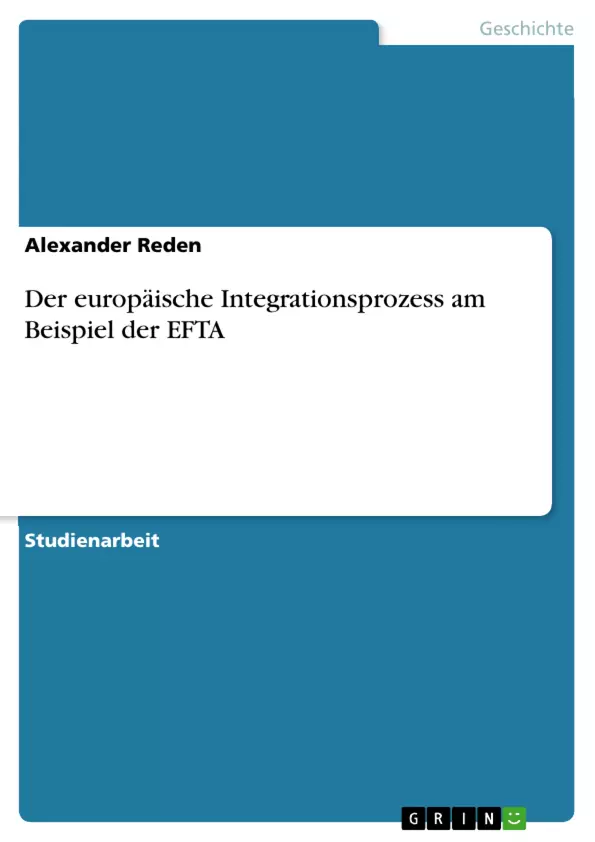Die europäische Integration ist auch dieser Tage wieder ein großes Thema. Derzeit wird über die Öffnung des Arbeitsmarktes für Bürger aus den östlichen Mitgliedsstaaten der EU diskutiert. Es wird viel über die Vor- und Nachteile, über Gefahren und Risiken und über die Auswirkungen auf die ökonomische Strukturen der Zuwanderungs- und Abwanderungsstaaten gesprochen. Der Startschuss für die Arbeitnehmerfreizügigkeit fällt am 01. Mai 2011.
Niemand kann vorhersagen ob es zu einer Bewegung der Arbeitnehmer aus den Mitgliedsstaaten kommt und wenn ja in welchen Dimensionen. Die Voraussetzungen sind durch die entsprechenden Gremien der Europäischen Union (EU) geschaffen worden. Doch auch heutzutage wird dieser Schritt des Integrationsprozesses mit Argwohn betrachtet. Dies geschieht teils aus Informationsmangel, Angst und Skepsis wie auch einer gewissen Machtlosigkeit, wenn denn der Ball ins Rollen gebracht wurde und die nachfolgenden Ereignisse scheinbar wenig beeinflussbar sind. Begonnen hat dieser europäische Integrationsprozess nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hatte aus den Fehlern gelernt, die nach dem Ersten Weltkrieg gemacht wurden. Deutschland wurde vormals in die Isolation gedrängt und mit Reparationen belegt worden, die nicht bezahlbar waren um die Wirtschaft des Landes klein zu halten. Aufgrund dieser Situation und einiger anderer Ereignisse wie zum Beispiel der Weltwirtschaftskrise von 1929 keimte ein neuer Nationalismus in Deutschland auf. Adolf Hitler führte Deutschland und Europa mit Beginn des Zweiten Weltkrieges in eine soziale wie auch ökonomische Katastrophe, deren Folgen bis in die 1970er Jahre auf Westblockseite ökonomisch und bis in die 1990er Jahre auf gesamteuropäischer Seite politisch durch den Kalten Krieg spürbar waren.
Doch wie kam es zu diesem Prozess der Europa heute so geschlossen erscheinen lässt, trotz verschiedener Differenzen? Wie konnte die Einung Europas erfolgen und die paneuropäische Idee von Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, wenn auch anders im Aufbau, erfolgen? Wie entwickelten sich neue Wirtschaftsbeziehungen nach den einschneidenden Erlebnissen der vorangegangen Jahre? In dieser Arbeit soll als Teil des Integrationsprozesses die European Free Trade Association (EFTA) in ihrer Entwicklung gegenüber der Betrachtung der Entwicklung der Europäischen Gemeinschaften (EG).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I – Grundbegriffe
- I.1 Freihandel und Freihandelszone
- I.2 Protektionismus
- I.3 Zölle
- I.4 Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR)
- Kapitel II – Die Nachkriegssituation in Europa
- II.1 Die North Atlantic Treaty Organization (NATO)
- II.2 Der Warschauer Pakt (WVO)
- II.3 Die Westeuropäische Union (WEU)
- Kapitel III – Die Entstehung der Europäischen Gemeinschaften
- III.1 Der Beginn des Integrationsprozesses (1951-58)
- III.2 Die Übergangszeit (1958-69)
- III.3 Ansätze zur Politikintegration und erste Erweiterung (1970-80)
- III.4 Die Vertiefung und die zweite Erweiterung der EG (1989-90)
- Kapitel IV – Die European Free Trade Association (EFTA)
- IV.1 Die Stockholmer Konvention
- IV.2 Die Ziele der EFTA
- IV.3 EFTA - Warum?
- Kapitel V - Die besondere Rolle Frankreichs
- V.1 De Gaulles Erbe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem europäischen Integrationsprozess, insbesondere am Beispiel der European Free Trade Association (EFTA). Sie befasst sich mit den Grundbegriffen und Prinzipien des Freihandels und der Freihandelszone sowie mit den historischen und politischen Kontexten, die zur Entstehung der EFTA führten. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Chancen der europäischen Integration, wobei die Entwicklung der EFTA im Vergleich zu den Europäischen Gemeinschaften (EG) betrachtet wird. Des Weiteren wird die besondere Rolle Frankreichs in der europäischen Integration unter Charles de Gaulle beleuchtet.
- Die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die European Free Trade Association (EFTA) und ihre Rolle im Integrationsprozess
- Der Vergleich zwischen der EFTA und den Europäischen Gemeinschaften (EG)
- Die Bedeutung des Freihandels und der Freihandelszone
- Die historische und politische Rolle Frankreichs in der europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I bietet eine Einführung in die Grundbegriffe des Freihandels, der Freihandelszone, des Protektionismus und der Zölle. Es werden die Prinzipien des Liberalismus und die Auswirkungen von Handelshemmnissen erläutert. Kapitel II beschreibt die Nachkriegssituation in Europa mit Fokus auf die Entstehung der NATO, des Warschauer Paktes und der Westeuropäischen Union. Kapitel III beleuchtet die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaften, beginnend mit dem Beginn des Integrationsprozesses in den 1950er Jahren, über die Übergangszeit bis hin zur Vertiefung und Erweiterung der EG in den 1980er und 1990er Jahren. Kapitel IV befasst sich mit der Entstehung der EFTA, ihrer Ziele und ihren Besonderheiten im Vergleich zu den EG. Kapitel V konzentriert sich auf die besondere Rolle Frankreichs in der europäischen Integration und das Erbe von Charles de Gaulle.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Freihandel, Freihandelszone, Protektionismus, Zölle, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), European Free Trade Association (EFTA), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Warschauer Pakt, Westeuropäische Union (WEU), Charles de Gaulle.
- Quote paper
- Alexander Reden (Author), 2011, Der europäische Integrationsprozess am Beispiel der EFTA, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170817