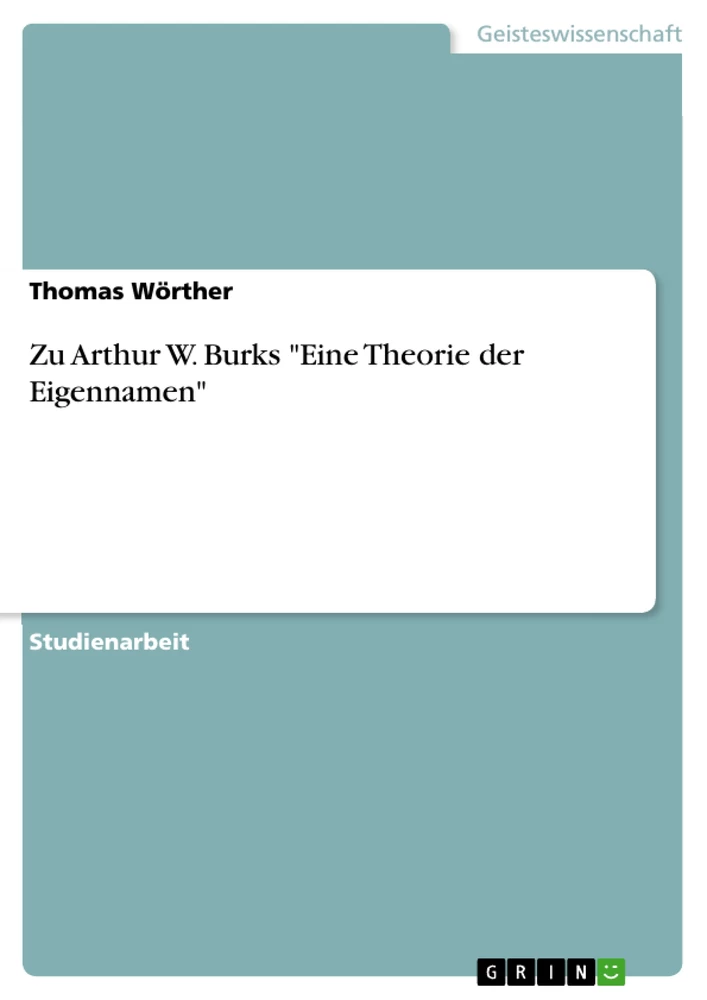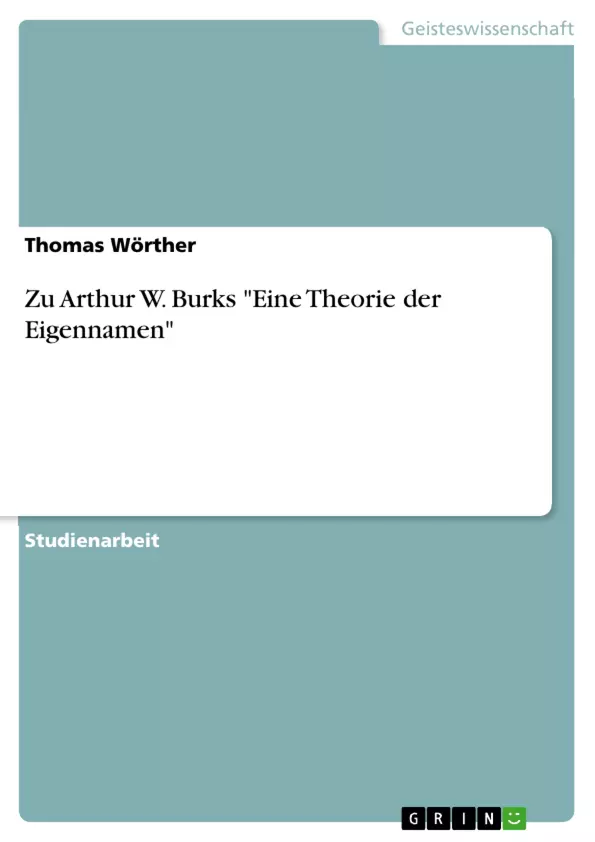Arthur W. Burks modifiziert die von Frege und Russell eingeführte Beschreibungstheorie durch seinen Versuch, eine eigene Theorie über den Begriff des Eigennamens der gewöhnlichen Rede zu entwickeln. Darin behauptet er, daß man allein mit beschreibenden Kennzeichnungen keinen Gegenstand ausreichend identifizieren könne. Auch die von Searle und Wittgenstein gemachten Vorschläge der Bündeltheorie, daß die Bedeutung eines Eigennamens in einem Bündel von Kennzeichnungen bestehe, lehnt er ab. Immerhin, so Burks, sei es möglich, daß es zwei identische Gegenstände gibt, die exakt dieselben Eigenschaften aufweisen. Auch deiktische Ausdrücke allein reichen nicht aus, da der gemeinte Gegenstand ohne zusätzliche Beschreibung nicht eindeutig bezeichnet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Indexikalischer Ausdruck
- Die Bedeutung von Eigennamen
- Fiktionale Personen
- Definition des Eigennamens
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In seiner Arbeit „Eine Theorie der Eigennamen“ setzt sich Arthur W. Burks mit der Frage auseinander, wie Eigennamen in der gewöhnlichen Sprache zu verstehen sind. Er kritisiert dabei die gängige Beschreibungstheorie von Frege und Russell und versucht, eine eigene Theorie zu entwickeln, die die spezifischen Herausforderungen der Verwendung von Eigennamen im Alltag berücksichtigt.
- Kritik an der Beschreibungstheorie
- Entwicklung der indexikalischen Ausdruckstheorie
- Die Bedeutung von Eigennamen in der Referenz
- Die Frage nach der Bedeutung von Eigennamen für fiktionale Personen
- Die Definition des Eigennamens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Burks stellt in seiner Einleitung die Grundidee seiner Arbeit dar. Er strebt eine neue Theorie der Eigennamen an, die die bestehenden Ansätze von Frege und Russell überwindet. Er kritisiert dabei die Beschreibungstheorie und die Bündeltheorie als unzureichend, da sie nicht alle Aspekte der Verwendung von Eigennamen in der Alltagssprache erfassen.
Fragestellung
Burks untersucht die Frage, ob es eine objektsprachliche Beschreibung gibt, die mit einem Eigennamen identisch ist, aber selbst keinen Eigennamen enthält. Diese Frage stellt sich aufgrund der Problematik der Erklärungskette, die bei der Verwendung von Kennzeichnungen entsteht, da diese wiederum Eigennamen enthalten, die ihrerseits erklärt werden müssten.
Indexikalischer Ausdruck
Burks führt den Begriff des indexikalischen Ausdrucks ein, der aus einem indexikalischen Symbol (z. B. „dies“) und einem nicht-indexikalischen Symbol (z. B. „fest“) besteht. Er argumentiert, dass Eigennamen durch die Verbindung einer Beschreibung mit einem deiktischen Ausdruck ausreichend bestimmt werden können.
Die Bedeutung von Eigennamen
Burks untersucht die Frage, ob Eigennamen generell Bedeutung haben und wie diese sich in verschiedenen Verwendungssituationen verändern kann. Er argumentiert, dass Eigennamen zwar in der Regel ein bestimmtes Ding bezeichnen, ihre Bedeutung jedoch variieren kann, je nach Kontext und Perspektive des Sprechers.
Fiktionale Personen
Burks diskutiert die Frage, ob auch fiktionale Personen, die keine reale Entsprechung haben, einen Eigennamen besitzen können. Er kommt zu dem Schluss, dass auch fiktionale Personen durch indexikalische Ausdrücke bestimmt werden können, auch wenn sie nicht in der realen Welt existieren.
- Quote paper
- Thomas Wörther (Author), 2004, Zu Arthur W. Burks "Eine Theorie der Eigennamen", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165568