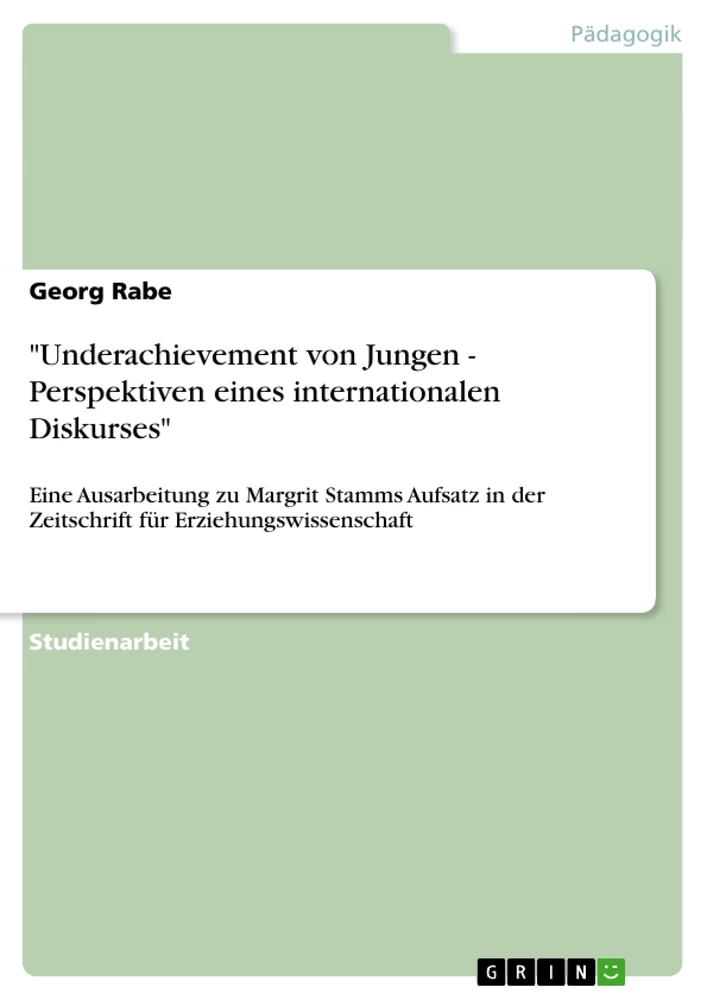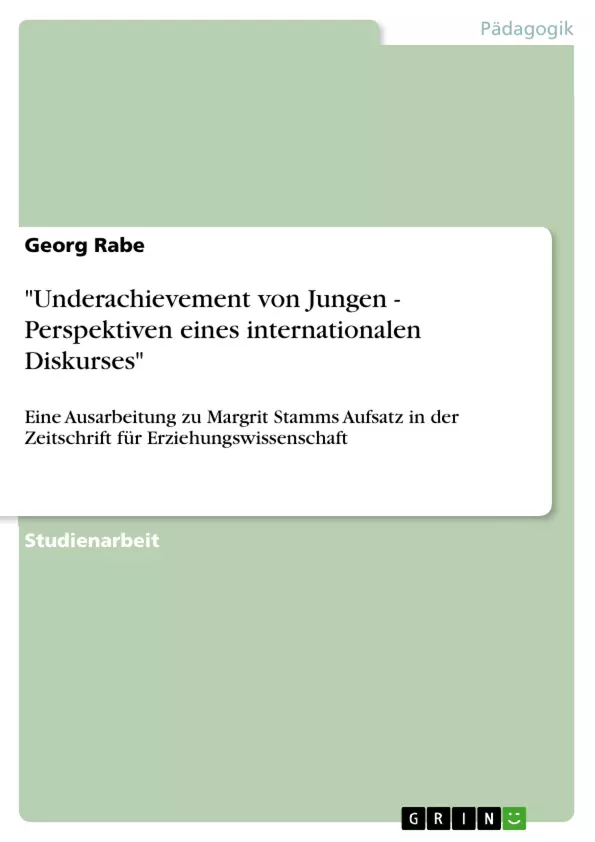Als Textfundament dieser Ausarbeitung dient der Aufsatz "Underachievement von Jungen: Perspektiven eines internationalen Diskurses", den die schweizerische Professorin Margrit Stamm im Jahr 2008 in der "Zeitschrift für Erziehungswissenschaft" veröffentlichte. Demgemäß wird der Inhalt des Aufsatzes im folgenden Punkt zusammengefasst dargestellt. Im dritten und vierten Punkt wird jeweils ein Erklärungsmuster für Underachievement von Jungen mithilfe des Etikettierungsansatzes und ferner der Theorie Bourdieus interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung des Aufsatzes
- Geschichtliche Verortung des Underachievement
- Statistische Fakten zum Bildungs(miss) erfolg von Jungen
- Fünf Erklärungsmuster
- Fazit
- Interpretation anhand des Etikettierungsansatzes
- Interpretation anhand Bourdieu
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung dient als theoretische Grundlage zum Referat „Underachievement von Jungen: Perspektiven eines internationalen Diskurses“. Sie analysiert den gleichnamigen Aufsatz von Margrit Stamm, der die zunehmende Aufmerksamkeit auf Jungen aufgrund ihres Bildungsfernsbleibens, ihres Verhaltens und ihrer schlechteren Schulleistungen thematisiert. Der Fokus liegt auf dem Underachievement von Jungen, verstanden als mangelnder Bildungsfortschritt trotz vorhandenem Potenzial.
- Geschichtliche Entwicklung des Themas „Underachievement“
- Statistische Fakten zum Bildungs(miss)erfolg von Jungen
- Fünf Erklärungsmuster für Underachievement von Jungen
- Interpretation des Underachievement anhand des Etikettierungsansatzes
- Interpretation des Underachievement anhand der Theorie von Bourdieu
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Hintergrund und die Zielsetzung der Ausarbeitung dar und erläutert den Fokus auf den Aufsatz von Margrit Stamm.
Zusammenfassung des Aufsatzes
Dieses Kapitel fasst den Aufsatz von Margrit Stamm zusammen, der die „Jungenwende“ als verstärkte internationale Aufmerksamkeit auf Jungen aufgrund ihres zunehmenden Underachievements beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Definition von Underachievement als mangelnder Bildungsfortschritt.
Geschichtliche Verortung des Underachievement
Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung des Underachievement-Konzepts, beginnend mit der Diskussion über die Benachteiligung von Mädchen in den 1950er Jahren im angloamerikanischen Raum. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung des Diskurses im deutschsprachigen Raum und der zunehmenden Aufmerksamkeit auf das Underachievement von Jungen seit Ende der 1990er Jahre.
Statistische Fakten zum Bildungs(miss)erfolg von Jungen
Dieser Abschnitt präsentiert statistische Daten, die auf die Benachteiligung von Jungen im deutschen Bildungssystem hinweisen. Die Überrepräsentation von Jungen an Hauptschulen und die höhere Bildungsbeteiligung von Mädchen werden als Beispiele genannt. Die Ergebnisse der PISA-Studie 2001/2003 werden ebenfalls betrachtet.
Fünf Erklärungsmuster
In diesem Kapitel werden fünf verschiedene Erklärungsmuster für das Underachievement von Jungen vorgestellt. Diese reichen von biologischen Differenzen über die Qualität von Schulen bis hin zum Einfluss von Medien und dem Verhalten der Jungen selbst.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Ausarbeitung sind: Underachievement von Jungen, Bildungsungleichheit, Jungenwende, Etikettierungsansatz, Bourdieu, Geschlechterrollen, Schulerfolg, Schulversagen, PISA-Studie, failing schools, Feminisierung der Schulen, medienvermittelter Männlichkeitskult. Die Ausarbeitung beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen und analysiert die Ursachen für das Underachievement von Jungen im Kontext des internationalen Diskurses.
- Arbeit zitieren
- M.Ed. Georg Rabe (Autor:in), 2008, "Underachievement von Jungen - Perspektiven eines internationalen Diskurses", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165279