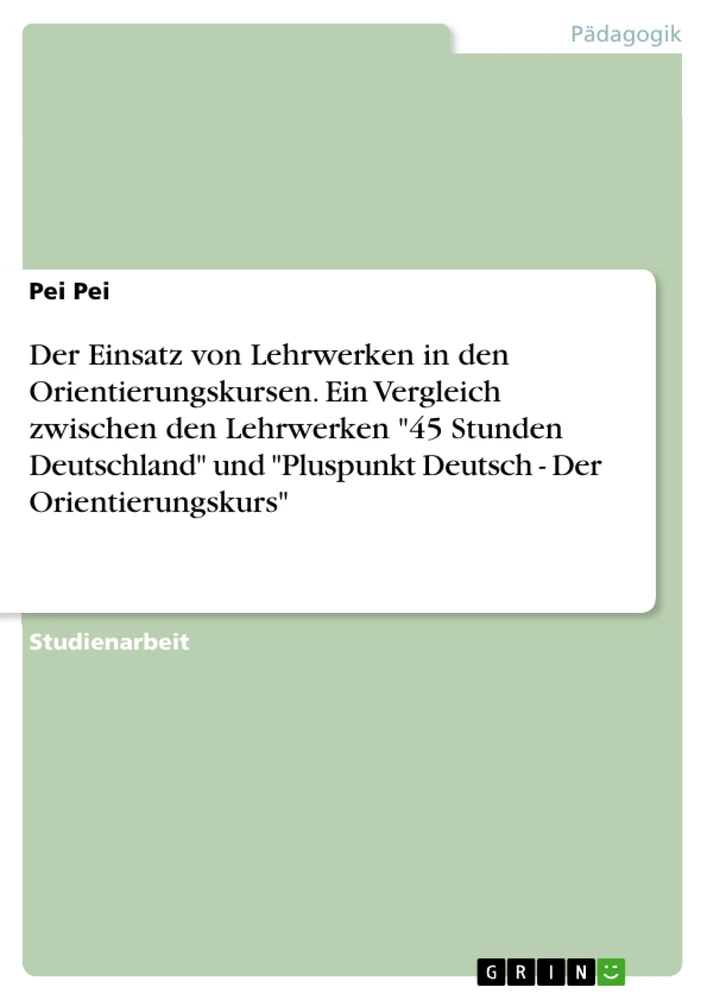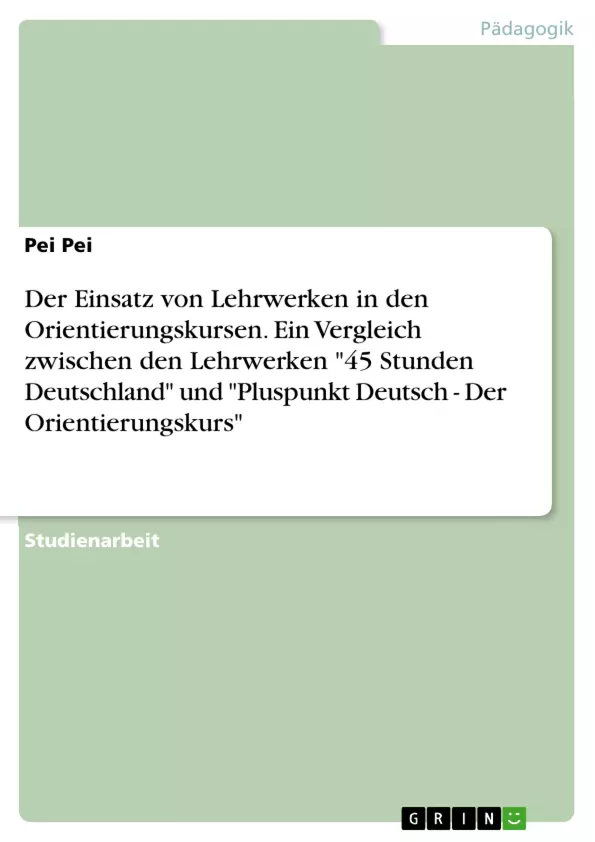Deutschland ist seit Jahren ein Land, das stark von Zuwanderung beeinflusst ist. Nach der Meinung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge steht Integration logischerweise für Deutschland, sowohl heute als auch in der Zukunft, im Mittelpunkt.
Der Orientierungskurs umfasst nach dem Curriculum für einen bundesweiten Orientierungskurs 45 Unterrichtseinheiten. Im Orientierungskurs handelt es sich um die deutsche Politik, Geschichte und Kultur. Ab dem 1. Januar 2009 müssen Teilnehmer des Orientierungskurses zum Abschluss den bundeseinheitlichen Orientierungskurstest schreiben.
Das BAMF hat in dem regelmäßig aktualisierten Standardwerk eine fünfseitige Liste der zugelassenen Lehrwerke von August 2009 dargestellt. Die Kursträger und Lehrkräfte können sich für ein geeignetes Lehrwerk von der Liste zugelassener Lehrwerke für ihren Unterricht entscheiden.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Vergleich zwischen zwei Lehrwerken für den Orientierungskurs: 45 Stunden Deutschland und Pluspunkt Deutsch – Der Orientierungskurs. Hierbei werden verschiedene Kriterien zur Kritik von Lehrwerken zu Rate gezogen. Es soll überprüft werden, inwiefern die beiden Lehrwerke den praktischen Teil des Orientierungskurses erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Darstellung des Integrationskurses
- 1.1 Ziele
- 1.2 Umfang
- 1.3 Teilnehmende
- 1.4 Abschlusstest
- 2 Darstellung des Orientierungskurses
- 2.1 Zielsetzung und Aufbau
- 2.2 Voraussetzungen für die Teilnehmenden
- 2.3 Ausrichtung der Themenbereiche
- 2.4 Methodik und Didaktik
- 3 Vergleich zwischen den Lehrwerken 45 Stunden Deutschland und Pluspunkt Deutsch - Der Orientierungskurs
- 3.1 Kursmaterialien
- 3.1.1 Layout
- 3.1.2 Inhalte
- 3.1.3 Zusatzmaterialien
- 3.2 Interkulturelles Lernen
- 3.2.1 Politik und Gesellschaft
- 3.3.2 Geschichte
- 3.3 Visualisierung
- 3.3.1 Funktionen der Bilder
- 3.3.2 Bilder als Informationsträger
- 3.3.3 Bild-Text-Kombination
- 3.3.4 Bilder als Sprechanlass
- 3.3.5 Landeskundliche Bilder
- 3.3.6 Bilder zur Veranschaulichung der Mimik/Gestik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Analyse und dem Vergleich zweier Lehrwerke für den Orientierungskurs im Rahmen von Integrationskursen: 45 Stunden Deutschland und Pluspunkt Deutsch - Der Orientierungskurs. Ziel ist es, die beiden Lehrwerke anhand verschiedener Kriterien zu bewerten und zu überprüfen, inwiefern sie den praktischen Teil des Orientierungskurses erfüllen.
- Darstellung des Integrationskurses und des Orientierungskurses
- Vergleich der Kursmaterialien der beiden Lehrwerke
- Analyse des interkulturellen Lernens in den Lehrwerken
- Bedeutung der Visualisierung im Kontext des Orientierungskurses
- Bewertung der Eignung der Lehrwerke für den praktischen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Integrationskurs und stellt seine Ziele, den Umfang, die teilnehmenden Personen sowie den Abschlusstest vor. Kapitel zwei fokussiert auf den Orientierungskurs, wobei die Zielsetzungen, der Aufbau, die Voraussetzungen für die Teilnehmer, die Themenbereiche und die Methodik/Didaktik des Kurses näher erläutert werden.
Im dritten Kapitel erfolgt der Vergleich der beiden Lehrwerke 45 Stunden und Pluspunkt. Die Analyse umfasst die Kursmaterialien, den Aspekt des interkulturellen Lernens und die Verwendung von Visualisierungselementen. Es wird untersucht, wie die Lehrwerke die verschiedenen Lernbereiche des Orientierungskurses abdecken und welche Stärken und Schwächen sie in Bezug auf die Gestaltung und den Inhalt aufweisen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich zentralen Themen wie Integrationskurse, Orientierungskurse, Lehrwerke, interkulturelles Lernen, Visualisierung und dem Vergleich von Unterrichtsmaterialien im Kontext der Sprach- und Integrationsförderung. Die Lehrwerke 45 Stunden Deutschland und Pluspunkt Deutsch - Der Orientierungskurs dienen als Fallbeispiele, um die Praxis des Unterrichts im Orientierungskurs zu beleuchten.
- Quote paper
- Pei Pei (Author), 2010, Der Einsatz von Lehrwerken in den Orientierungskursen. Ein Vergleich zwischen den Lehrwerken "45 Stunden Deutschland" und "Pluspunkt Deutsch - Der Orientierungskurs", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/164127