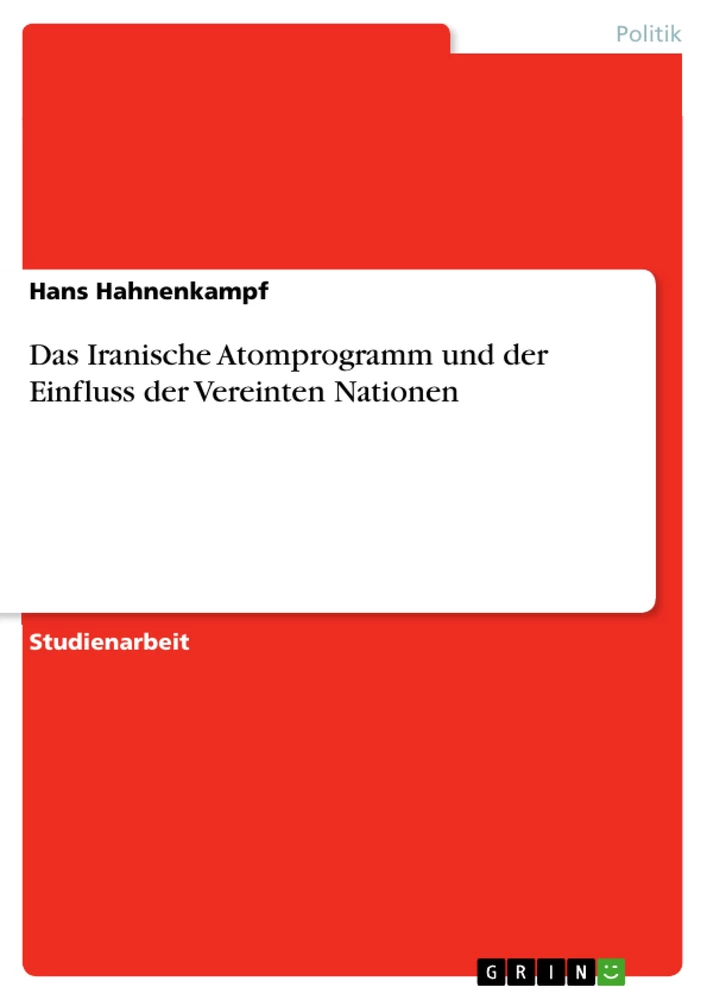II Einleitung
„To fully understand what has been going on nuclear wise in Iran, it is necessary to examine the timeline of events as they took place.“ Diese Hausarbeit über die Atompolitik des Iran und den Einfluss der Vereinten Nationen möchte ich mit diesem Zitat beginnen, da sich der Atomstreit mit dem Iran bereits über fast zehn Jahre erstreckt und seine Wurzeln sogar noch weiter in der Vergangenheit liegen. Das Vorgehen der einzelnen Länder, der IAEA und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Hinzu kommt, dass sich für die tatsächliche Entwicklung einer Atombombe bisher noch keine Beweise haben finden lassen. „All that is certain about Irans nuclear program is, that there is nobody in the west who has any idea about how far Teheran has advanced in its bid to achieve a nuclear weapons capability.“
Der Streit um das iranische Atomprogramm beschäftigt die Weltöffentlichkeit derzeit wie kein zweites Thema. Für die Meisten geht es in erster Linie darum, dass verhindert wird, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Es geht aber um mehr: Es gilt auch herauszufinden, ob das internationale Nicht-Verbreitungsregime, das im Wesentlichen von der internationalen Atomenergieorganisation getragen wird und auf dem Atomwaffensperrvertrag beruht, in der Lage ist, jetzt und in Zukunft die illegale Proliferation bzw. den geheimen Bau von Atomwaffen zu verhindern. In diesem Fall stellt gerade das iranische Atomprogramm die Effektivität und Durchsetzungsfähigkeit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) in Frage.
Aus diesem Grund soll diese Hausarbeit sich mit der Frage beschäftigen, ob die Vereinten Nationen die Wandlung des Iran zu einer Atommacht effektiv unterbinden können.
Das Verhalten des Iran werde ich anhand der Realismus-Theorie untersuchen. So hat die Vergangenheit gezeigt, dass der Besitz von Atomwaffen für ein im Vergleich zu anderen Waffen einzigartiges Drohpotenzial und Machtinstrument steht: Egal ob man an den Einsatz der Atombombe im japanischen Hiroshima oder Nagasaki denkt, das geheime Atomprogramm Israels, die Aufrüstung der Rivalen Indien und Pakistan oder der Bau der Atombombe in Nordkorea. Mit Hilfe des atomaren Drohpotenzials soll die Machtposition gegen Einflüsse von außen abgesichert werden....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Die Sicht des Westens
- Kontroverse und die Hintergründe
- Richtungswechsel unter Ahmadinedschad
- Diplomatische Verhandlungen durch die VN
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem iranischen Atomprogramm und untersucht den Einfluss der Vereinten Nationen auf dessen Entwicklung. Der Fokus liegt darauf, zu analysieren, ob die VN in der Lage sind, die Wandlung des Iran zu einer Atommacht effektiv zu verhindern.
- Das iranische Atomprogramm im Kontext der internationalen Beziehungen
- Die Realismus-Theorie und ihre Anwendung auf die iranische Außenpolitik
- Die Rolle der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA)
- Die diplomatischen Verhandlungen zwischen Iran und den VN
- Die Effektivität von Resolutionen des Sicherheitsrates
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Konflikt um das iranische Atomprogramm vor und erläutert die Bedeutung der Vereinten Nationen in diesem Zusammenhang. Die Realismus-Theorie wird als analytisches Werkzeug vorgestellt.
- Geschichtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge des iranischen Atomprogramms und die Entwicklung der iranischen Atompolitik bis zum Beginn des Konflikts mit der UN.
- Die Sicht des Westens: Hier werden die Gründe für die Besorgnis des Westens hinsichtlich des iranischen Atomprogramms dargestellt und die Realismus-Theorie als Erklärung für die Handlungsweise des Iran angewandt.
- Kontroverse und Hintergründe: Dieses Kapitel beschreibt die Eskalation des Konflikts zwischen Iran und der UN, die Rolle der IAEA und die Hintergründe für die Entwicklung des Atomprogramms.
- Richtungswechsel unter Ahmadinedschad: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss des neuen iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinedschad auf die iranische Atompolitik und die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft.
- Diplomatische Verhandlungen durch die VN: Das Kapitel analysiert die verschiedenen diplomatischen Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinten Nationen, die zur Lösung des Konflikts beitragen sollen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem iranischen Atomprogramm, der internationalen Politik, der Realismus-Theorie, der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), den Vereinten Nationen, den Resolutionen des Sicherheitsrates, den diplomatischen Verhandlungen und dem Nichtverbreitungsvertrag.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Streit um das iranische Atomprogramm?
Es geht um die Befürchtung der Weltgemeinschaft, dass der Iran unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung Kernwaffen entwickelt.
Welche Rolle spielt die IAEA?
Die Internationale Atomenergie-Organisation überwacht die Einhaltung des Nichtverbreitungsvertrags und führt Inspektionen im Iran durch.
Was besagt die Realismus-Theorie in diesem Kontext?
Sie erklärt das Streben nach Atomwaffen als rationales Instrument zur Machtsicherung und Abschreckung gegen Einflüsse von außen.
Können die Vereinten Nationen den Iran stoppen?
Die Arbeit untersucht die Effektivität von diplomatischen Verhandlungen und UN-Sicherheitsratsresolutionen zur Unterbindung der atomaren Bewaffnung.
Wie änderte sich die Politik unter Ahmadinedschad?
Unter seiner Präsidentschaft kam es zu einem Richtungswechsel hin zu einer konfrontativeren Atompolitik und einer Beschleunigung des Programms.
- Arbeit zitieren
- Hans Hahnenkampf (Autor:in), 2010, Das Iranische Atomprogramm und der Einfluss der Vereinten Nationen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/161546