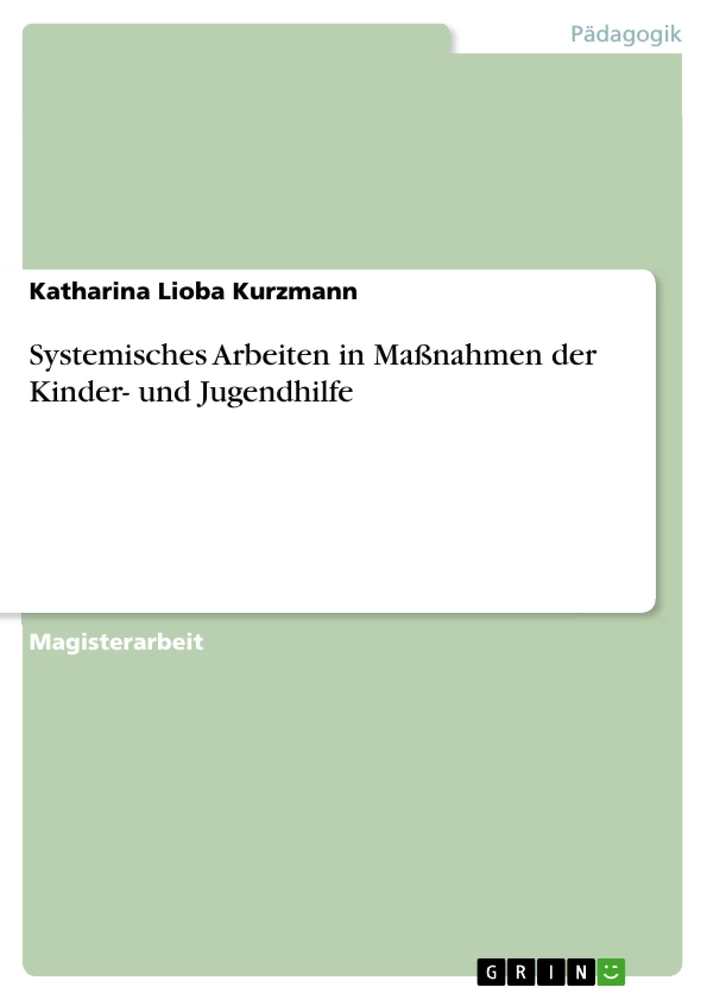Systemisches Denken, Handeln und Arbeiten ist weiterhin auf dem Vormarsch und hat sich in vielen Anwendungsfeldern bewährt. Trotz kontroverser Diskussionen von Autoren im Rahmen anderer Disziplinen wie beispielsweise der Soziologie, die eine systemtheoretische Sicht als unangemessen, nicht „bis zum Ende gedacht“ oder einfach nur als überholt ansieht, scheint eine systemische Sichtweise im Bereich der Sozialen Arbeit Früchte zu tragen. Die Verbindung zwischen Pädagogik einerseits und Systemdenken andererseits führt möglicherweise dazu, dass das Individuum seine Wichtigkeit und Präsenz behält, die Systeme, in denen es sich bewegt – auch wenn diese sich zunächst als „undurchsichtig“ oder „verworren“ darstellen – aber nicht als ausgeschlossen, sondern vielmehr als ressourcenbringend angesehen werden. Es wird also Abstand von der herkömmlichen, „problemzentrierten Denkweise“ genommen und ein Schwerpunkt auf den Zusammenhang, die Wechselwirkungen und die Muster von problematischen Weisen des Denkens, Handelns und Fühlens des Individuums im Kontext eines komplexen Systems gelegt. Hier kann eine Sichtweise, die sich immer nur mit einem Problemsystem befasst, sehr erfolgversprechend sein, zumal sich der Fokus nicht auf Unmengen hochkomplexer einzelner Systeme, sondern auf Lösungen bestimmter Aspekte richtet. Es ist jene Idee, die den Anstoß zu dieser Arbeit gab.
Die Frage, die sich nun hieraus ergibt, lässt sich etwa so formulieren: Welche Konzepte und Methoden gibt es in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die zu einer Lösung bestimmter Auffälligkeiten führen? Und: Ist jedes Konzept für jede Hilfeform in der Kinder- und Jugendhilfe geeignet und sinnvoll oder gibt es möglicherweise Probleme oder Grenzen in der Anwendung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder- und Jugendhilfe
- Rechtliche Grundlagen
- Die Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe
- Familienunterstützende Hilfen
- Familienergänzende Hilfen
- Familienersetzende Hilfen
- Geschichtliches und Theoretisches zum Systemischen Arbeiten
- Kernfragen systemischer Theorie
- System und was bewirkt es?
- Problemsysteme
- Prinzipien systemtheoretischer Praxis
- Krankheitskonzepte und Diagnosen aus systemischer Sicht
- Systemtherapeutische Grundhaltungen
- Systemische Frage- und Interviewtechniken
- Umdeutungstechniken, positive Konnotation und die Externalisierung von Problemen
- Repräsentationsformen für Systeminformationen und metaphorische Techniken
- Schlussinterventionen
- Grundlagen des systemischen Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen
- Spezifische Formen der Kontaktgestaltung
- Räumliches Setting
- Bekanntmachung der Grundregeln
- Erhebung physischer, psychischer und sozialer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in intensiv- und individualpädagogischen Maßnahmen
- Fragestellung
- Methode
- Befragte
- Quantitative Auswertung
- Fazit
- Durch die Hilfeform bedingte Spezifitäten in der systemischen Bearbeitung ausgewählter Störungsbilder
- Somatische Beschwerden
- Essstörungen
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Essstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Essstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
- Schlafstörungen und Alpträume
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Schlafstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Schlafstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
- Sprachstörungen
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Sprachstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Sprachstörungen in familienersetzenden Settings
- Kopfschmerzen
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von primären Kopfschmerzen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von primären Kopfschmerzen in familienersetzenden Hilfeformen
- Essstörungen
- Psychische Beschwerden
- Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
- Stimmungsschwankungen
- Zur Bearbeitung von Stimmungsschwankungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Stimmungsschwankungen in familienersetzenden Hilfeformen
- Wahrnehmungsstörungen
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Wahrnehmungsstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Wahrnehmungsstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
- Ängste
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Ängsten in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Ängsten in familienersetzenden Hilfeformen
- Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen
- Soziale Auffälligkeiten
- Lügen
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Lügen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Lügen in familienersetzenden Hilfeformen
- Distanzlosigkeit
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von Distanzlosigkeit in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von Distanzlosigkeit in familienersetzenden Hilfeformen
- Aggressives und gewalttätiges Verhalten
- Beziehungsmuster
- Zur Bearbeitung von aggressivem und gewalttätigem Verhalten in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
- Zur Bearbeitung von aggressivem und gewalttätigem Verhalten in familienersetzenden Hilfeformen
- Lügen
- Abschlussbemerkungen
- Somatische Beschwerden
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Vereinbarkeit systemischer Methoden mit Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel ist es, herauszufinden, welche Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen in intensivpädagogischen Maßnahmen am häufigsten auftreten und welche systemischen Ansätze zur Bearbeitung in verschiedenen Hilfeformen geeignet sind.
- Vereinbarkeit systemischer Methoden und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe
- Häufigkeit spezifischer Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen in intensivpädagogischen Maßnahmen
- Geeignete systemische Methoden zur Bearbeitung verschiedener Störungsbilder
- Anwendbarkeit systemischer Methoden in unterschiedlichen Hilfeformen
- Ressourcenorientierung und Lösungsfokussierung in der systemischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Anwendung systemischen Denkens und Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere die Frage nach geeigneten Methoden zur Lösung spezifischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Hilfeformen. Sie stellt die Verbindung zwischen Pädagogik und Systemdenken heraus und untersucht die Grenzen und Möglichkeiten der Anwendung systemischer Konzepte.
2. Kinder- und Jugendhilfe: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte und rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, beginnend mit den Sozialreformen des Kaiserreichs bis zum heutigen SGB VIII. Es beschreibt verschiedene Hilfeformen, gegliedert nach ihrer Intensität des Eingriffs in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen (familienunterstützend, familienergänzend, familienersetzend). Die Kapitel 2.1 und 2.2 liefern die Grundlage für die anschließende Betrachtung systemischer Konzepte im Kontext der verschiedenen Hilfeformen.
3. Geschichtliches und Theoretisches zum Systemischen Arbeiten: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung der systemischen Therapie und Beratung, von den Anfängen der Familientherapie bis hin zu lösungsorientierten Kurzzeittherapien. Es erläutert zentrale Konzepte der systemischen Theorie wie Konstruktivismus, Rekursivität und die Bedeutung von Beziehungsmustern. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Problemen und deren Chronifizierung im Kontext sozialer Systeme.
4. Prinzipien systemtheoretischer Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die Grundprinzipien systemischer Praxis, darunter Neutralität, Irreverenz, Zirkularität und Ressourcenorientierung. Es diskutiert das systemische Krankheitsverständnis und den Umgang mit medizinischen Diagnosen. Es werden wichtige Methoden wie Umdeutungstechniken, positive Konnotation, Externalisierung, Genogramme und Systemzeichnungen vorgestellt. Schlussinterventionen als Übergangsrituale zur Veränderung von Systemen werden ebenfalls erläutert.
5. Grundlagen des systemischen Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel widmet sich den Besonderheiten systemischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es behandelt spezifische Aspekte der Kontaktgestaltung, des räumlichen Settings und der Bekanntmachung von Grundregeln, um eine kind- und jugendgerechte Therapie- bzw. Beratungssituation zu schaffen.
6. Erhebung physischer, psychischer und sozialer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in intensiv- und individualpädagogischen Maßnahmen: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Erhebung mittels Fragebogen, die Aufschluss über die häufigsten Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen in intensivpädagogischen Maßnahmen geben soll. Die quantitative Auswertung der Ergebnisse liefert Daten zur Häufigkeit verschiedener somatischer, psychischer und sozialer Auffälligkeiten.
Schlüsselwörter
Systemisches Arbeiten, Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII, Familientherapie, Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung, Beziehungsmuster, Störungsbilder (Essstörungen, Schlafstörungen, Sprachstörungen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Wahrnehmungsstörungen, Ängste, Lügen, Distanzlosigkeit, aggressives Verhalten, Konzentrationsstörungen), Genogramm, Systemzeichnung, Interventionen, Intensivpädagogik, Individualpädagogik.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Systemisches Arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Vereinbarkeit systemischer Methoden mit Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Im Fokus steht die Frage, welche Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen in intensivpädagogischen Maßnahmen am häufigsten auftreten und welche systemischen Ansätze zur Bearbeitung in verschiedenen Hilfeformen (familienunterstützend, familienergänzend, familienersetzend) geeignet sind.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendbarkeit systemischer Methoden in der Kinder- und Jugendhilfe zu prüfen und geeignete systemische Ansätze für verschiedene Störungsbilder zu identifizieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ressourcenorientierung und Lösungsfokussierung in der systemischen Praxis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die Vereinbarkeit systemischer Methoden und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, die Häufigkeit spezifischer Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen in intensivpädagogischen Maßnahmen, geeignete systemische Methoden zur Bearbeitung verschiedener Störungsbilder, die Anwendbarkeit systemischer Methoden in unterschiedlichen Hilfeformen und die Ressourcenorientierung und Lösungsfokussierung in der systemischen Praxis.
Welche Störungsbilder werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene somatische (Essstörungen, Schlafstörungen, Sprachstörungen, Kopfschmerzen) und psychische (Hyperaktivität, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen, Wahrnehmungsstörungen, Ängste) Beschwerden sowie soziale Auffälligkeiten (Lügen, Distanzlosigkeit, aggressives und gewalttätiges Verhalten) bei Kindern und Jugendlichen.
Wie werden die verschiedenen Hilfeformen der Kinder- und Jugendhilfe berücksichtigt?
Die Arbeit differenziert zwischen familienunterstützenden, familienergänzenden und familienersetzenden Hilfeformen und untersucht, wie systemische Methoden in diesen unterschiedlichen Kontexten angewendet werden können.
Welche systemischen Methoden werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt zentrale Konzepte der systemischen Theorie wie Konstruktivismus und Rekursivität und erläutert wichtige Methoden wie Umdeutungstechniken, positive Konnotation, Externalisierung, Genogramme und Systemzeichnungen. Der Umgang mit medizinischen Diagnosen aus systemischer Sicht wird ebenfalls diskutiert.
Welche empirischen Methoden werden eingesetzt?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Erhebung mittels Fragebogen, um die Häufigkeit verschiedener Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen in intensivpädagogischen Maßnahmen zu ermitteln. Die Ergebnisse werden quantitativ ausgewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Kinder- und Jugendhilfe, Geschichtliches und Theoretisches zum Systemischen Arbeiten, Prinzipien systemtheoretischer Praxis, Grundlagen des systemischen Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen, Erhebung physischer, psychischer und sozialer Auffälligkeiten, Durch die Hilfeform bedingte Spezifitäten in der systemischen Bearbeitung ausgewählter Störungsbilder, Fazit und Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Systemisches Arbeiten, Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII, Familientherapie, Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung, Beziehungsmuster, verschiedene Störungsbilder, Genogramm, Systemzeichnung, Interventionen, Intensivpädagogik, Individualpädagogik.
- Quote paper
- Katharina Lioba Kurzmann (Author), 2010, Systemisches Arbeiten in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160403