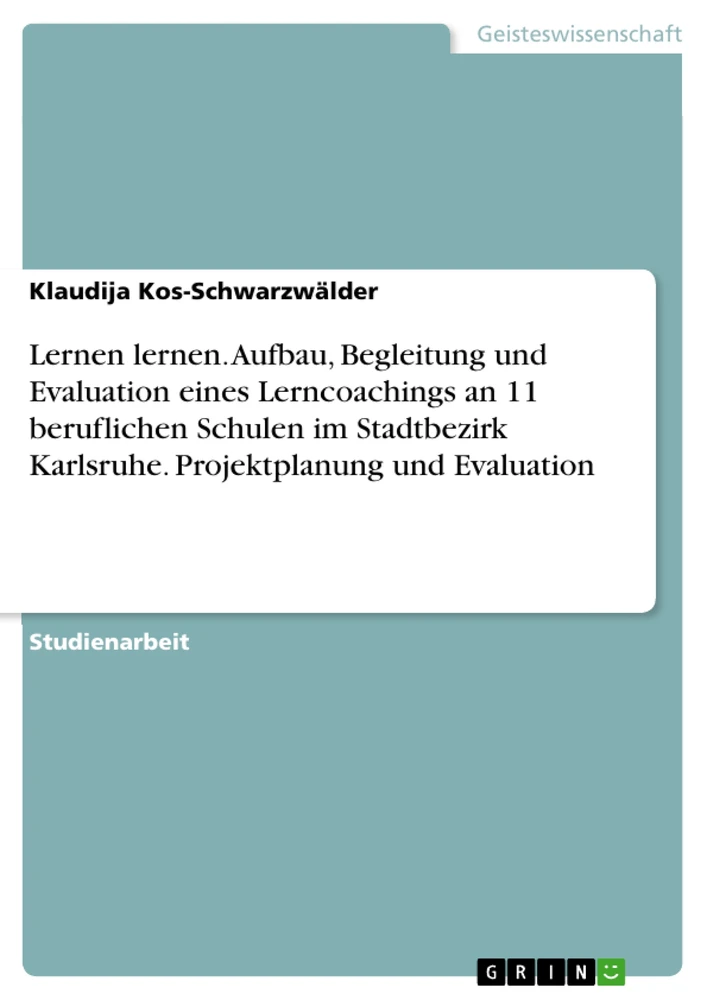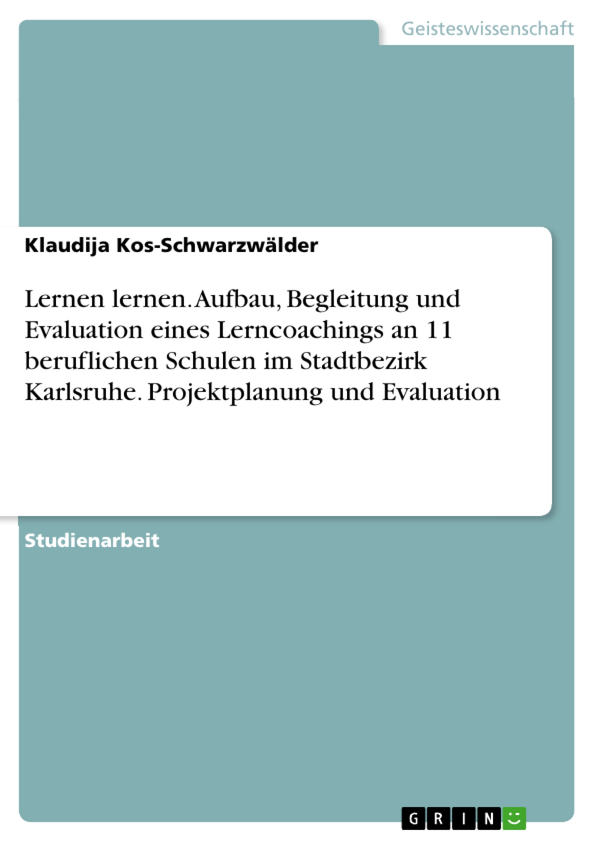Der Fachtext widmet sich dem innovativen Ansatz des Lerncoachings zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen an beruflichen Schulen. Ausgehend von der Vielzahl individueller Lernprobleme und heterogenen Eingangsvoraussetzungen bei Schülerinnen werden Herausforderungen des erfolgreichen Lernens systematisch analysiert. Das Projekt „Lernen lernen“ an elf Karlsruher Schulen wird als vielseitiges Entwicklungsprojekt beschrieben, das durch individuelle Lernberatung, Förderung von Methodenkompetenzen und gezielte Begleitung einen effektiven und nachhaltigen Lernerfolg erzielen will. Im Zentrum steht ein personenzentrierter, prozessorientierter Coaching-Ansatz, der über klassische Nachhilfe hinausgeht und eigenverantwortliches, reflektiertes Lernen, Selbstorganisation, Resilienz und die Entwicklung persönlicher Ressourcen fördert. Neben der praxisnahen Darstellung von Zielgruppen-, Bedarfs- und Stakeholderanalyse wird auf systematische Wirkungsziele, Evaluation und die konkrete Projektdurchführung eingegangen. Die Verknüpfung zwischen individueller Unterstützung, institutionenübergreifender Kooperation und systematischer Wirkungskontrolle macht den Ansatz zu einem Modell nachhaltiger Projektarbeit in der Bildungslandschaft. Die Analyse liefert fundierte Einblicke und praktische Empfehlungen für Fachkräfte der Schulsozialarbeit, Lehrkräfte, Pädagoginnen und Entscheidungsträger*innen im Bildungs- und Sozialwesen, wie individuelle Lernförderung systematisch zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Projektbeschreibung
- 2.1 Begründung
- 2.2 Bedarfs- und Umfeldanalyse
- 2.2.1 Bedarf
- 2.2.2 Zielgruppen
- 2.2.3 Stakeholderanalyse
- 2.2.4 Problembaum
- 3. Wirkungsziele
- 3.1 Entwicklung von Wirkungszielen
- 3.1.1 Zentrales Wirkungsziel
- 3.1.2 Wirkungsziel auf gesellschaftlicher Ebene
- 3.2 Lösungsbaum
- 4. Wirkungslogik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschreibt das Projekt „Lernen lernen“, ein Lerncoaching an elf beruflichen Schulen in Karlsruhe. Ziel ist die Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen aufgrund von Lernschwierigkeiten. Das Projekt zielt auf die Verbesserung der Lernumgebungen und die Vermittlung von Lerntechniken ab, um die Schüler*innen bei der Entwicklung eigenverantwortlichen Lernens zu unterstützen.
- Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen
- Verbesserung der Lernumgebungen an beruflichen Schulen
- Förderung eigenverantwortlichen Lernens
- Vermittlung von Lerntechniken und Methodenkompetenzen
- Analyse von Lernschwierigkeiten und deren Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Problematik von Lernschwierigkeiten bei Schüler*innen und Auszubildenden und deren Auswirkungen. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit von Interventionen zur Verbesserung der Lernsituationen und betont die individuelle Vielfalt des Lernprozesses. Die Einleitung legt den Grundstein für das Projekt „Lernen lernen“ und dessen Notwendigkeit, indem sie die Herausforderungen gelingenden Lernens aufzeigt und die Bedeutung individueller Förderung hervorhebt.
2. Projektbeschreibung: Dieses Kapitel beschreibt das Projekt „Lernen lernen“ umfassend. Es erläutert Lerncoaching als personenzentrierten Ansatz zur Verbesserung des individuellen Lernverhaltens und der Lernfähigkeiten. Die Projektidee entstand aus der Zusammenarbeit von Schulsozialarbeiter*innen, Beratungslehrkräften und Ausbildungsbegleiter*innen. Das Kapitel beschreibt den Kontext, die Ziele und die angestrebte Wirkung des Lerncoachings, wobei es auf die steigende Heterogenität der Schülerschaft eingeht und Lerncoaching als integraler Bestandteil individueller Förderung positioniert. Die Begründung für die Projektwahl wird durch die Erfüllung von Kriterien eines klassischen Projekts untermauert.
2.1 Begründung: Dieser Abschnitt rechtfertigt die Einordnung des Lerncoaching-Projekts als Projekt im Sinne des Projektmanagements. Anhand der Kriterien eines Projekts (zeitlich befristet, innovativ, risikobehaftet, komplex) wird die Eignung des Lerncoachings als Projekt belegt. Die Herausforderungen, die das Projekt stellt, werden in Bezug auf Organisationsstruktur, Konzeptentwicklung, Materialerstellung und Abstimmung der beteiligten Akteure erläutert. Die Punkte (konkrete Herausforderungen, Identifikation der Beteiligten, Problemidentifizierung, Interventionen und Lösungsbeschreibung, Formulierung von Wirkungszielen und Indikatoren, zeitliche Planung und Evaluation) werden als Begründung für den Projektcharakter genutzt.
2.2 Bedarfs- und Umfeldanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden der Bedarfsanalyse, die durchgeführte Datenerhebung mittels digitaler Tools und den Austausch mit relevanten Stakeholdern (Ausbilder*innen, Eltern, Schüler*innen, Kammern). Es werden verschiedene Studien und statistische Erhebungen zu Ausbildungsabbrüchen und deren Ursachen herangezogen, um den Bedarf an Lerncoaching zu belegen. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung von Lernschwierigkeiten, die Klärung des Bedarfs und die Definition der Zielgruppen und Stakeholder. Der Abschnitt zeigt auf, wie die Ergebnisse der Datenanalyse in die Konzeption des Projekts eingeflossen sind.
Schlüsselwörter
Lerncoaching, Ausbildungsabbruch, Lernschwierigkeiten, berufliche Schulen, individuelle Förderung, Projektplanung, Evaluation, methodische Kompetenzen, Selbstorganisation, Resilienz.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Projekt "Lernen lernen"?
Das Projekt "Lernen lernen" ist ein Lerncoaching-Programm an elf beruflichen Schulen in Karlsruhe. Ziel ist es, Ausbildungsabbrüche aufgrund von Lernschwierigkeiten zu vermeiden, die Lernumgebungen zu verbessern und eigenverantwortliches Lernen bei den Schüler*innen zu fördern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen, die Verbesserung der Lernumgebungen an beruflichen Schulen, die Förderung eigenverantwortlichen Lernens, die Vermittlung von Lerntechniken und Methodenkompetenzen sowie die Analyse von Lernschwierigkeiten und deren Ursachen.
Was beinhaltet die Einleitung?
Die Einleitung beleuchtet die Problematik von Lernschwierigkeiten bei Schüler*innen und Auszubildenden und deren Auswirkungen. Sie betont die Notwendigkeit von Interventionen zur Verbesserung der Lernsituationen und die Bedeutung individueller Förderung.
Was wird im Kapitel "Projektbeschreibung" erläutert?
Dieses Kapitel beschreibt das Projekt "Lernen lernen" umfassend, einschließlich Lerncoaching als personenzentrierten Ansatz, den Kontext, die Ziele und die angestrebte Wirkung. Es geht auf die steigende Heterogenität der Schülerschaft ein und positioniert Lerncoaching als integralen Bestandteil individueller Förderung.
Warum wird das Lerncoaching-Projekt als Projekt betrachtet?
Der Abschnitt "Begründung" rechtfertigt die Einordnung des Lerncoaching-Projekts als Projekt im Sinne des Projektmanagements anhand der Kriterien: zeitlich befristet, innovativ, risikobehaftet und komplex.
Was wird in der Bedarfs- und Umfeldanalyse untersucht?
Die Bedarfs- und Umfeldanalyse beschreibt die Methoden der Bedarfsanalyse, die Datenerhebung, den Austausch mit Stakeholdern und die Heranziehung von Studien zu Ausbildungsabbrüchen. Sie konzentriert sich auf die Identifizierung von Lernschwierigkeiten, die Klärung des Bedarfs und die Definition der Zielgruppen und Stakeholder.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Lerncoaching, Ausbildungsabbruch, Lernschwierigkeiten, berufliche Schulen, individuelle Förderung, Projektplanung, Evaluation, methodische Kompetenzen, Selbstorganisation, Resilienz.
- Quote paper
- Klaudija Kos-Schwarzwälder (Author), 2023, Lernen lernen. Aufbau, Begleitung und Evaluation eines Lerncoachings an 11 beruflichen Schulen im Stadtbezirk Karlsruhe. Projektplanung und Evaluation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1602695