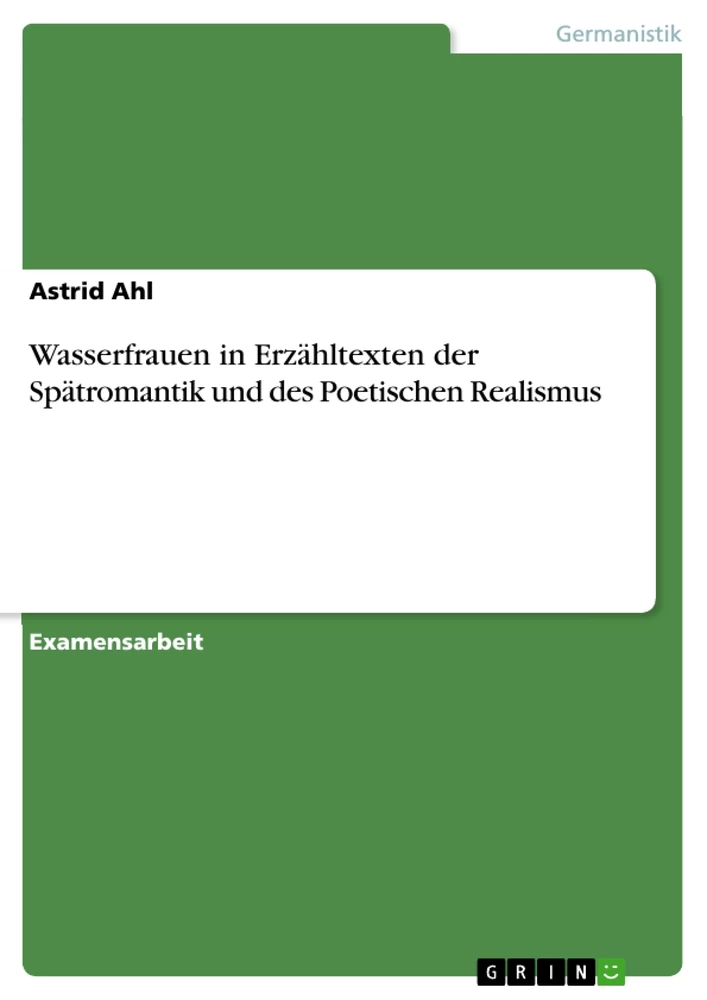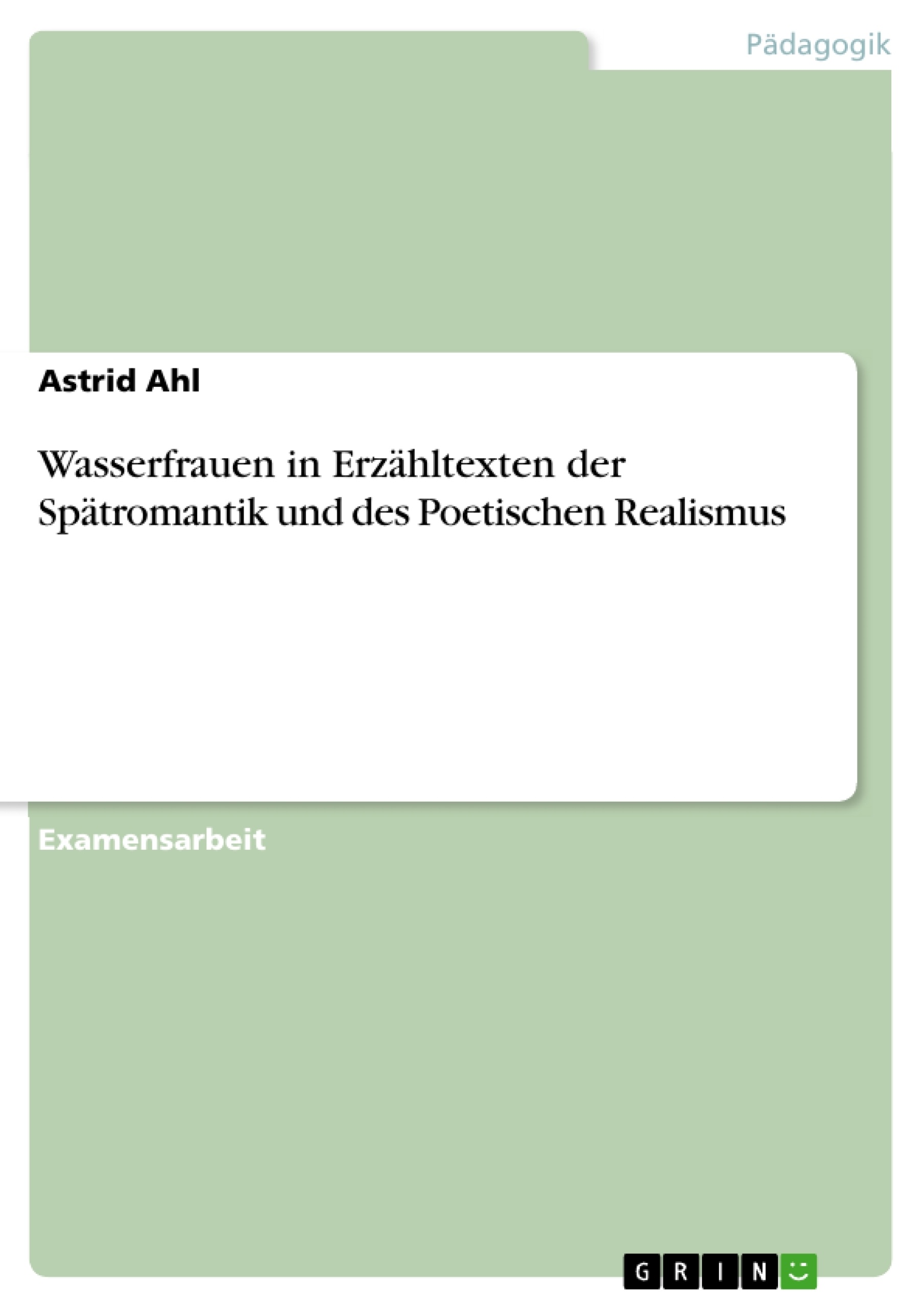Wasserfrauen weckten seit jeher das Interesse der Dichter und Schriftsteller. In vielen Kulturen und Zeiten lassen sich Erzählungen über sie ausfindig machen: In den antiken Mythen faszinierten die noch namenlosen Nymphen und Sirenen, im Mittelalter wurde mit dem Mythos um Melusine und Undine die Grundlage einer langen literarischen Tradition geschaffen, die ihren Höhepunkt in der Romantik finden sollte und bis in die Gegenwart reicht. Die Wasserfrau inspirierte jedoch nicht allein in der Literatur zu Nachbildung und Ausformung, sondern auch in den Bereichen Kunst und Musik.
Diese Examensarbeit hat die Analyse von „Wasserfrauen“ in der Erzählliteratur der Spätromantik und des Poetischen Realismus zum Ziel. Inspiriert wurde die Themenstellung durch Theodor Fontanes Roman Effi Briest, der zur Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im ausgehenden 19. Jahrhundert anregte. Auffallend bei Effi ist ihre Affinität zum Element Wasser, die sie mit den gesellschaftlichen Konventionen jener Zeit in Konflikt bringt. Gleich Effi imaginiert Fontane in seinen Werken zahlreiche Frauengestalten als Naturwesen, als Wasserfrauen. Diese Verknüpfung von Wasser und Weiblichkeit ist in den Werken der Romantik und des Realismus zu finden. Dabei ist auffallend, dass die von Männern imaginierte Wasserweiblichkeit als männermordende Dämonin, verführerische Kindfrau oder morbide Frau nicht mit der sozialen Rolle der Frau in der Gesellschaft übereinstimmte. Dieser Divergenz soll in der vorliegenden Untersuchung der Wasserfrau mit Blick auf die geschlechtlichen Disparitäten im 19. Jahrhundert nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zum Stand der Forschung
- 1.2 Zur Symbolik des Wassers
- 1.3 Wasser und Weiblichkeit: Die Frau als Wasser
- 2. Die Wasserfrau in der Literatur: Von der Antike bis zur Romantik
- 2.1 Paracelsus und die Lehre der Elementargeister
- 2.2 Exkurs: Die Wasserfrau im Volksmärchen der Brüder Grimm
- 3. Die Wasserfrau in der Spätromantik
- 3.1 Friedrich de la Motte Fouqués Undine
- 3.1.1 Undine die Wasserfrau
- 3.1.2 Die Landschaft als Allegorie der beiden Liebenden
- 3.1.3 Von der Kindfrau zur domestizierten Weiblichkeit
- 3.2 Hans Christian Andersens Die kleine Meerjungfrau
- 3.2.1 „Dreiecksgeschichte [...] aus der Perspektive des Opfers“
- 3.3 Eduard Mörikes Historie von der schönen Lau
- 3.3.1 Die verbannte Wasserfrau oder Wie die Lau in den Topf kam
- 3.3.2 Die Historie als Machtkampf zwischen Patriarchat und Matriarchat
- 4. Die Wasserfrau im Poetischen Realismus
- 4.1 Die Wasserfrau in den Werken Theodor Fontanes
- 4.1.1 Die Verbundenheit der Wasserfrau zu ihrem Element
- 4.1.2 Die (Wasser-)Frau als das Andere, das Aparte
- 4.1.3 Weiblichkeitsentwürfe bei Fontane
- 4.2 Wilhelm Raabes Die Innerste
- 4.2.1 Die Gefährdung der Ordnung durch das „Andere“
- 4.3 Theodor Storms Auf der Universität
- 4.3.1 Idealisierung der (Wasser-)Frau als Angst vor Selbstverlust
- 5. „Bilder und immer wieder Bilder.“ Zur Imagination des Weiblichen.
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von „Wasserfrauen“ in der Erzählliteratur der Spätromantik und des Poetischen Realismus. Die Untersuchung zielt darauf ab, die literarischen Konzeptionen der Wasserfrau im Kontext der geschlechtlichen Disparitäten des 19. Jahrhunderts zu beleuchten und den Einfluss männlicher Imaginationen des Weiblichen aufzuzeigen. Dabei wird der Fokus auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen aquatischen Frauengestalten gelegt.
- Die Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs von der Antike bis zur Romantik
- Die Darstellung der Wasserfrau in ausgewählten Werken der Spätromantik (Fouqué, Andersen, Mörike)
- Die überraschende Präsenz der Wasserfrau im Poetischen Realismus (Fontane, Raabe, Storm)
- Der Einfluss zeitgenössischer Weiblichkeitsbilder auf die literarischen Konzeptionen der Wasserfrau
- Die Konstruktion der Wasserfrau als Spiegelbild männlicher Wünsche und Ängste
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wasserfrau in der Literatur ein und skizziert den Forschungsstand. Sie hebt die besondere Verbindung von Wasser und Weiblichkeit hervor und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Analyse der literarischen Konzeptionen der Wasserfrau im Kontext der geschlechtlichen Disparitäten des 19. Jahrhunderts und den Einfluss männlicher Imaginationen. Der Antagonismus des Wassers als lebensspendend und lebensbedrohend wird als konstitutiv für die Verbindung von Wasser und Weiblichkeit erörtert.
2. Die Wasserfrau in der Literatur: Von der Antike bis zur Romantik: Dieses Kapitel verfolgt die Motivgeschichte der Wasserfrau von der Antike bis zur Romantik. Es beleuchtet die Bedeutung der Elementargeisterlehre des Paracelsus als Grundlage für die romantische Auffassung der Wasserfrau und analysiert die Darstellung von Wasserfrauen in Volksmärchen der Brüder Grimm. Die Entwicklung des Wasserfrauenmotivs wird über verschiedene Epochen hinweg nachgezeichnet, um einen umfassenden Kontext für die Analyse der Spätromantik und des Poetischen Realismus zu schaffen.
3. Die Wasserfrau in der Spätromantik: Dieses Kapitel analysiert die Wasserfrau in ausgewählten romantischen Kunstmärchen von Fouqué (Undine), Andersen (Die kleine Meerjungfrau) und Mörike (Historie von der schönen Lau). Besonderes Augenmerk liegt auf Mörikes Werk, das in der Forschung bislang weniger Beachtung fand. Die Analyse von Andersens Märchen strebt nach neuen Interpretationen, die homoerotische Aspekte beleuchten.
4. Die Wasserfrau im Poetischen Realismus: Im Gegensatz zur Romantik wird die überraschende Präsenz der Wasserfrau im Poetischen Realismus untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf Theodor Fontanes Werken, insbesondere seinen Melusine-Fragmenten. Vergleichend werden Wilhelm Raabes Die Innerste und Theodor Storms Auf der Universität analysiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Wasserfrau im Kontext der realistischen Literatur und der Frage, wie sie mit der Darstellung der Wirklichkeit vereinbart werden kann.
5. „Bilder und immer wieder Bilder.“ Zur Imagination des Weiblichen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss zeitgenössischer Weiblichkeitsbilder auf die literarischen Konzeptionen der Wasserfrau im 19. Jahrhundert. Die Analyse fokussiert auf die Figur der femme fatale und der femme fragile, um die Diskrepanz zwischen vorgestellter und real existierender Weiblichkeit aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Wasserfrau, Weiblichkeit, Romantik, Poetischer Realismus, Wasser, Symbolik, Männliche Imagination, Literatur, Fontane, Fouqué, Andersen, Mörike, Raabe, Storm, Geschlechterrollen, 19. Jahrhundert, Mythos, Märchen, Kunstmärchen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Wasserfrau in der Literatur der Spätromantik und des Poetischen Realismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von „Wasserfrauen“ in der Erzählliteratur der Spätromantik und des Poetischen Realismus. Der Fokus liegt auf der literarischen Konzeption der Wasserfrau im Kontext der geschlechtlichen Disparitäten des 19. Jahrhunderts und dem Einfluss männlicher Imaginationen des Weiblichen. Die Analyse untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener aquatischer Frauengestalten.
Welche Epochen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Darstellung der Wasserfrau von der Antike bis zur Romantik und konzentriert sich im Hauptteil auf die Spätromantik und den Poetischen Realismus.
Welche Autoren und Werke werden analysiert?
Die Analyse umfasst Werke von Fouqué (Undine), Andersen (Die kleine Meerjungfrau), Mörike (Historie von der schönen Lau), Fontane (verschiedene Werke, insbesondere Melusine-Fragmente), Raabe (Die Innerste) und Storm (Auf der Universität). Darüber hinaus wird die Bedeutung von Volksmärchen der Brüder Grimm und der Elementargeisterlehre des Paracelsus beleuchtet.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs, die Darstellung der Wasserfrau in verschiedenen literarischen Epochen, der Einfluss zeitgenössischer Weiblichkeitsbilder, die Konstruktion der Wasserfrau als Spiegelbild männlicher Wünsche und Ängste, sowie die Analyse der Geschlechterrollen im 19. Jahrhundert.
Welche Fragestellungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie die Wasserfrau literarisch konzipiert wurde, wie sich diese Konzeptionen im Kontext der geschlechtlichen Disparitäten des 19. Jahrhunderts entwickelten, und welchen Einfluss männliche Imaginationen auf die Darstellung der Wasserfrau hatten. Die Analyse beleuchtet auch die Symbolik des Wassers und dessen Verbindung zur Weiblichkeit.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Wasserfrau von der Antike bis zur Romantik, zur Spätromantik, zum Poetischen Realismus, ein Kapitel zur Imagination des Weiblichen und ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert spezifische Aspekte der Wasserfrauendarstellung in den ausgewählten Werken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wasserfrau, Weiblichkeit, Romantik, Poetischer Realismus, Wasser, Symbolik, Männliche Imagination, Literatur, Fontane, Fouqué, Andersen, Mörike, Raabe, Storm, Geschlechterrollen, 19. Jahrhundert, Mythos, Märchen, Kunstmärchen.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die zentralen Argumente und Ergebnisse jedes Kapitels beschreibt.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis mit detaillierter Gliederung der Kapitel und Unterkapitel findet sich im HTML-Dokument.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, welches sich für die Literatur der Spätromantik und des Poetischen Realismus, die Darstellung von Frauen in der Literatur und die Symbolik des Wassers interessiert.
- Quote paper
- Astrid Ahl (Author), 2007, Wasserfrauen in Erzähltexten der Spätromantik und des Poetischen Realismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160039