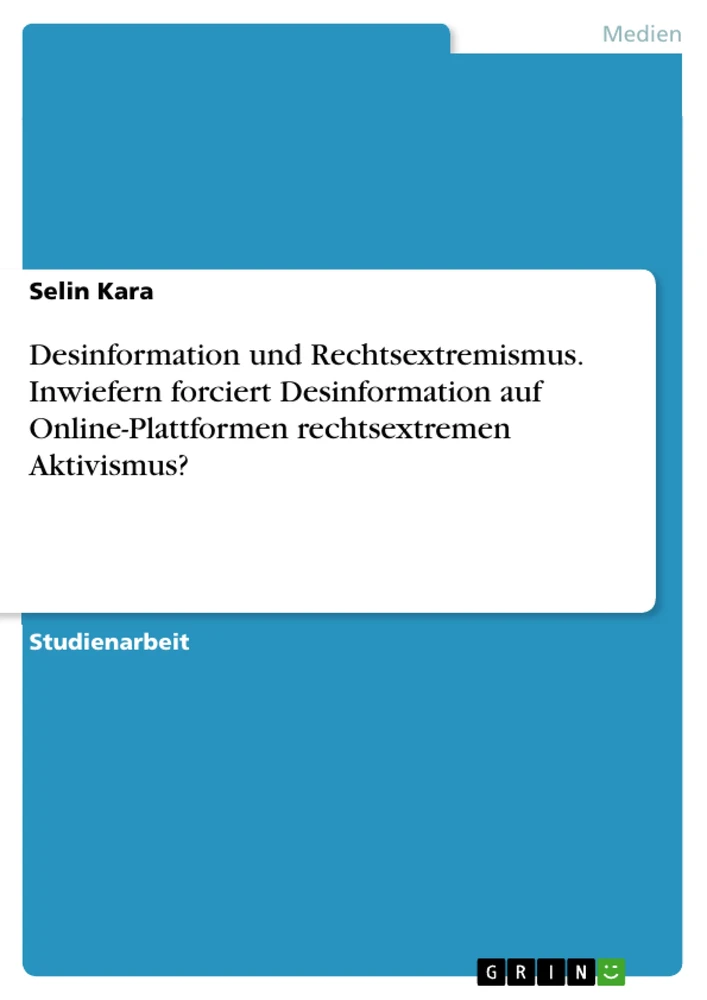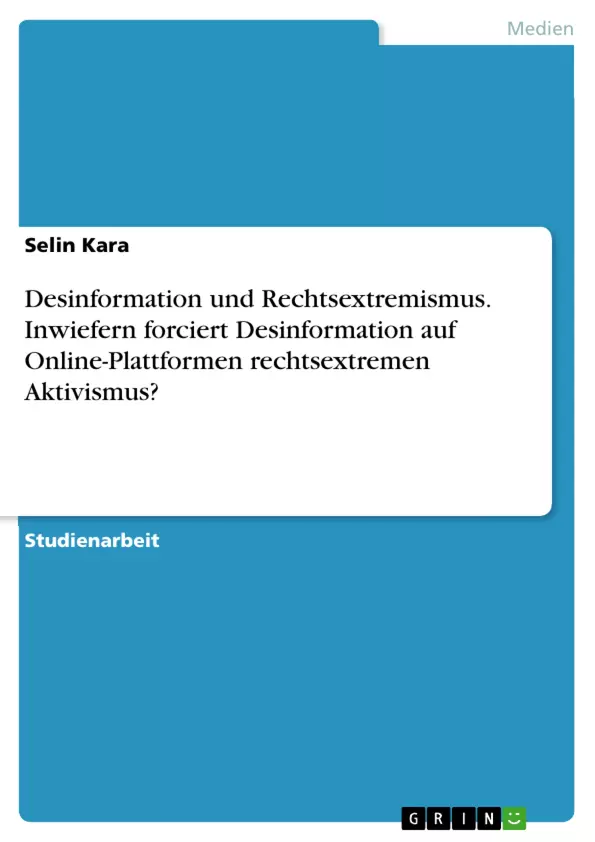Am 19. Februar 2020 ermordete ein rechtsextremer Terrorist neun Menschen in Hanau, mitten in Deutschland. Diese Seminararbeit wurde kurz nach dem 3. Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses verfasst und beschäftigt sich damit, wie solch ein Höhepunkt rechter und rassistischer Kontinuitäten erreicht werden konnte. Es ist eine stets kontemporäre Thematik, die im Zeitalter der Digitalisierung die Frage aufwirft, wie sich rechtes Gedankengut auch im Netz initial verbreitet, da die Verbreitung von Falschinformation in den letzten Jahren besonders in der politischen Sphäre zugenommen hat. Im rechten Spektrum wird Desinformation oft strategisch genutzt, um bestimmte ideologische Auffassungen zu festigen und Mitbürger:innen zu mobilisieren. Desinformation in diesem Kontext führt zu Vorurteilen, Hass, Hetze und Diskriminierung, was oftmals gewaltbereites Verhalten initiiert. Laut des Verfassungsschutzberichtes des Bundesinnenministeriums gab es 2020 in Deutschland schätzungsweise 33.300 Rechtsextremist:innen, von denen 13.300 gewaltorientiert gewesen sind (Suhr 2021). Im Jahr 2021 wurden knapp 22.000 Straftaten rechter Kriminalität erfasst (Bocksch 2022). Mit einer zunehmenden Anzahl an in Deutschland lebenden Ausländer:innen und Menschen mit Migrationshintergrund, sind dies sehr beunruhigende Zahlen. Weitergehend wird abgehandelt, inwiefern Desinformation, die auf Online-Plattformen verbreitet wird, dazu führen kann, dass xenophobe und diskriminierende Haltungen an Zuwachs gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mediensysteme und ihre Online-Affinität
- 2.1 Desinformation und Online-Plattformen
- 3. Der aktuelle Forschungsstand
- 4. Fazit
- 5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Desinformation auf Online-Plattformen und rechtsextremen Aktivismus in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet, wie Desinformation dazu beitragen kann, xenophobe und diskriminierende Haltungen zu verstärken und rechtsextreme Ideologien zu verbreiten.
- Der Einfluss von Online-Plattformen auf die Verbreitung von Desinformation
- Die Rolle von Desinformation bei der Verstärkung rechtsextremer Ideologien
- Die verschiedenen Formen und Strategien der Desinformation im rechten Spektrum
- Der aktuelle Forschungsstand zum Thema rechte Desinformation online
- Die Auswirkungen von Desinformation auf die öffentliche Meinung und das gesellschaftliche Klima
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit dem Hanau-Attentat als Ausgangspunkt, um die Aktualität und Bedeutung der Thematik von rechtem Gedankengut und dessen Verbreitung im digitalen Zeitalter zu betonen. Sie definiert Mis- und Desinformation und hebt deren strategische Nutzung im rechten Spektrum hervor, um ideologische Auffassungen zu festigen und zu mobilisieren. Die Einleitung führt alarmierende Statistiken zu Rechtsextremismus und rechter Kriminalität in Deutschland an und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Inwiefern fördert die Online-Verbreitung von Desinformation xenophobe und diskriminierende Haltungen?
2. Mediensysteme und ihre Online-Affinität: Dieses Kapitel definiert das Mediensystem und betont die Bedeutung von Medien als Kommunikationsinstrumente für den gesellschaftlichen Diskurs. Es analysiert den Wandel des Mediensystems durch die Digitalisierung und Plattformisierung, der zu neuen Kommunikationsverflechtungen und einer Herausforderungen der traditionellen Medienhierarchie führt. Der Begriff der Dissonanz wird eingeführt, um die Vielfalt und Synchronität der Stimmen im öffentlichen Kommunikationsraum zu beschreiben. Die zunehmende Bedeutung ziviler Akteure und Online-Aktivismus im digitalen Raum wird hervorgehoben.
2.1 Desinformation und Online-Plattformen: Dieses Kapitel behandelt die Verbreitung rechter und extremistischer Ideologien auf Online-Plattformen, die als dissonante Räume betrachtet werden. Es nennt WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram und Twitter als relevante Plattformen für die Verbreitung von Mis- und Desinformation. Unter Bezugnahme auf Möller et al. (2020) wird die Unterscheidung zwischen Mis- und Desinformation anhand der Intention des Verfassers und der Faktizität der Information erläutert. Verschiedene Desinformationstypen werden vorgestellt, darunter unautentischer Pseudojournalismus, Propaganda und bewusste Dekontextualisierung, die die öffentliche Meinung beeinflussen können. Emotionalisierende Inhalte und die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften werden als besonders wirksam beschrieben.
Schlüsselwörter
Desinformation, Online-Plattformen, Rechtsextremismus, Online-Aktivismus, Mediensystem, Digitalisierung, Plattformisierung, Hassrede, Xenophobie, Diskriminierung, Rechte Ideologie, Misinformation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Desinformation auf Online-Plattformen und rechtsextremen Aktivismus in Deutschland. Sie beleuchtet, wie Desinformation dazu beitragen kann, xenophobe und diskriminierende Haltungen zu verstärken und rechtsextreme Ideologien zu verbreiten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte:
- Der Einfluss von Online-Plattformen auf die Verbreitung von Desinformation
- Die Rolle von Desinformation bei der Verstärkung rechtsextremer Ideologien
- Die verschiedenen Formen und Strategien der Desinformation im rechten Spektrum
- Der aktuelle Forschungsstand zum Thema rechte Desinformation online
- Die Auswirkungen von Desinformation auf die öffentliche Meinung und das gesellschaftliche Klima
Was ist das Kernthema der Einleitung (Kapitel 1)?
Die Einleitung beginnt mit dem Hanau-Attentat als Ausgangspunkt und betont die Aktualität und Bedeutung von rechtem Gedankengut und dessen Verbreitung im digitalen Zeitalter. Sie definiert Mis- und Desinformation und hebt deren strategische Nutzung im rechten Spektrum hervor. Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage: Inwiefern fördert die Online-Verbreitung von Desinformation xenophobe und diskriminierende Haltungen?
Was wird im Kapitel "Mediensysteme und ihre Online-Affinität" behandelt (Kapitel 2)?
Dieses Kapitel definiert das Mediensystem und seine Bedeutung für den gesellschaftlichen Diskurs. Es analysiert den Wandel des Mediensystems durch Digitalisierung und Plattformisierung. Der Begriff der Dissonanz wird eingeführt, um die Vielfalt der Stimmen im öffentlichen Kommunikationsraum zu beschreiben.
Welche Online-Plattformen werden im Zusammenhang mit Desinformation genannt (Kapitel 2.1)?
WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram und Twitter werden als relevante Plattformen für die Verbreitung von Mis- und Desinformation genannt.
Wie wird zwischen Misinformation und Desinformation unterschieden (Kapitel 2.1)?
Die Unterscheidung zwischen Mis- und Desinformation erfolgt anhand der Intention des Verfassers und der Faktizität der Information. Desinformation ist absichtlich falsch, während Misinformation unbeabsichtigt falsch sein kann.
Welche Arten von Desinformation werden vorgestellt (Kapitel 2.1)?
Es werden verschiedene Desinformationstypen vorgestellt, darunter unautentischer Pseudojournalismus, Propaganda und bewusste Dekontextualisierung.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Desinformation, Online-Plattformen, Rechtsextremismus, Online-Aktivismus, Mediensystem, Digitalisierung, Plattformisierung, Hassrede, Xenophobie, Diskriminierung, Rechte Ideologie, Misinformation.
- Quote paper
- Selin Kara (Author), 2023, Desinformation und Rechtsextremismus. Inwiefern forciert Desinformation auf Online-Plattformen rechtsextremen Aktivismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1594630