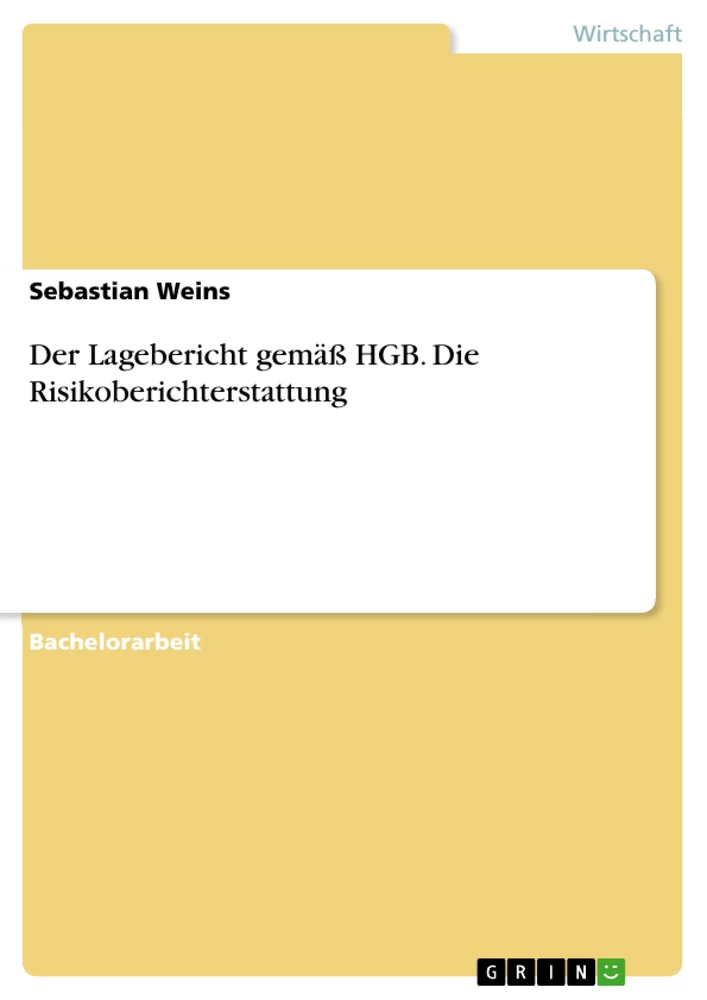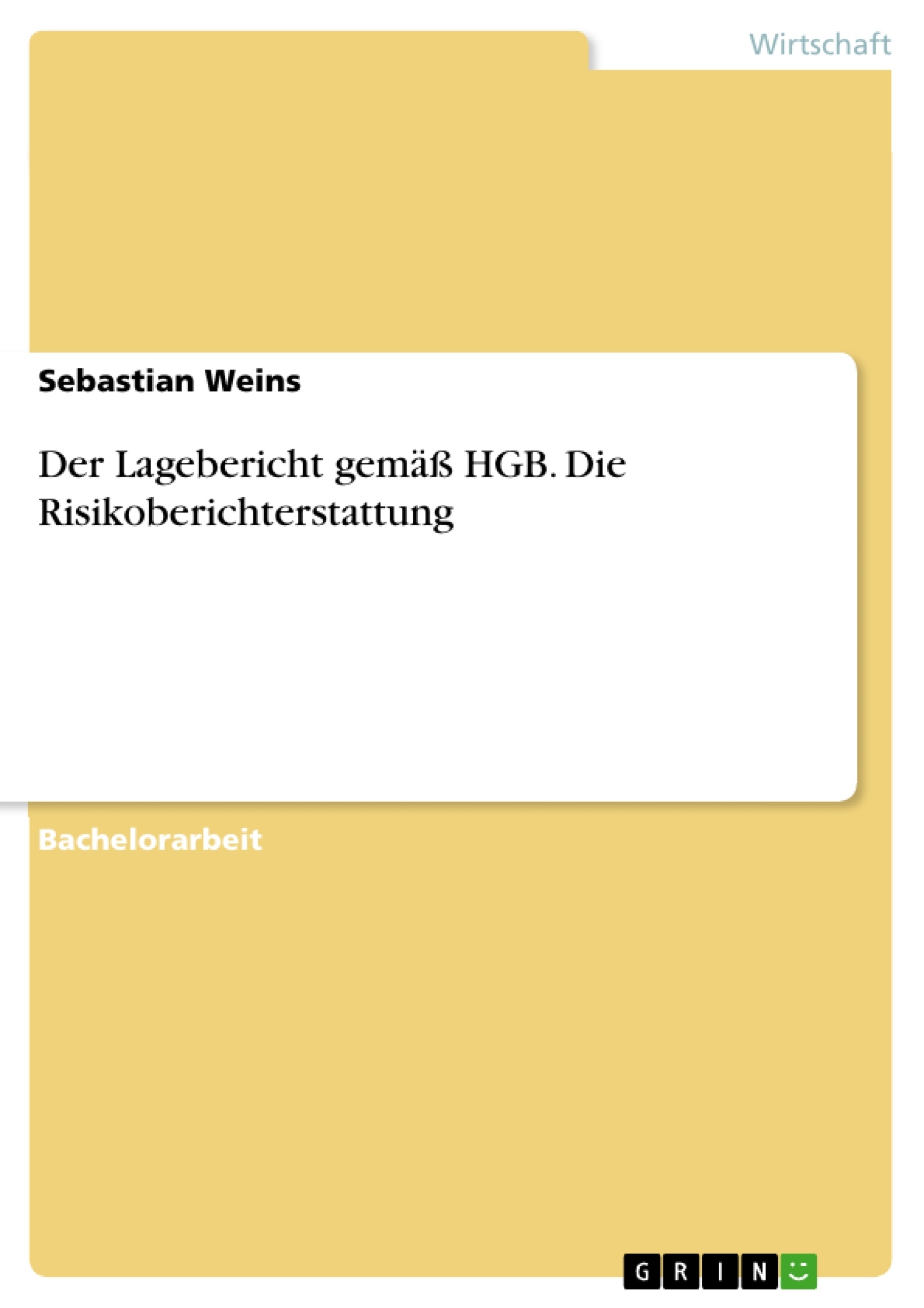Als eine Begleiterscheinung der Globalisierung und der dadurch bedingten Verbindung verschiedener Wirtschaftsräume gilt die zunehmende Entstehung nationaler wie internationaler Großkonzerne. Damit einher geht ein enormer Kapitalbedarf, der nicht mehr allein von den nationalen Finanzmärkten abgedeckt werden kann, sondern einer Unterstützung durch internationale Kapitalmärkte bedarf. Die Konzerne befinden sich dabei gegenseitig im Wettbewerb um Kapitalgeber. Investoren fordern deshalb für ihre Anlageentscheidung eine Rechnungslegung, die internationalen Standards entspricht und die vor allem zukunftsorientierte, entscheidungsrelevante Informationen enthält.
Vor diesem Hintergrund hat sich auch die Funktion des externen Rechnungswesens weiterentwickelt. Zählte früher die Dokumentation aller vergangenen Vorgänge sowie die Bemessung der Steuerschuld und der Ausschüttung zur Hauptaufgabe des externen Rechnungswesens, so besteht heutzutage das vordergründige Ziel in der Vermittlung von anlegerbezogenen, wertorientierten und entscheidungsrelevanten Informationen. Dies wird als Übergang vom financial accounting zum business bzw. value reporting bezeichnet. Dieser Wandel zeigt sich auch anhand der Instrumente des Rechnungswesens. Durch die Einführung des Lageberichts im Aktiengesetz von 1965 (AktG 1965) sowie nachfolgenden Gesetzesänderungen hat der Gesetzgeber diese Entwicklung berücksichtigt und auf diesem Wege ein eigenständiges Medium geschaffen, welches im Kontrast zur Bilanz und GuV steht. Während es sich bei Letzteren vor allem um vergangenheitsorientierte Rechenwerke handelt, enthält der (Konzern-)Lagebericht investitionsrelevante Informationen über nicht finanzielle Größen und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst die Grundlagen der (Konzern-) Lageberichterstattung zu erläutern, bevor im zweiten Abschnitt eine empirische Analyse der Risikoberichterstattung durchgeführt wird, wobei aufgezeigt werden soll, in welchem Maße die Berichterstattung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der (Konzern-)Lageberichterstattung
- 2.1 Historie des (Konzern-)Lageberichts
- 2.1.1 Ursprung der (Konzern-)Lageberichterstattung
- 2.1.2 Das Aktiengesetz von 1965
- 2.1.3 Das Bilanzrichtliniengesetz
- 2.1.4 Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
- 2.1.5 Das Bilanzrechtsreformgesetz und weitere Änderungen
- 2.1.6 Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- 2.1.7 Zusammenfassung
- 2.2 Funktion der (Konzern-)Lageberichterstattung
- 2.2.1 Die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernlageberichts
- 2.2.2 Zweck der (Konzern-)Lageberichterstattung
- 2.2.2.1 Die Verdichtungsaufgabe
- 2.2.2.2 Die Ergänzungsfunktion
- 2.2.2.3 Die Rechenschaftsfunktion
- 2.2.3 Abgrenzung des Konzernlageberichts vom Konzernabschluss
- 2.2.4 Adressatenkreis des Konzernlageberichts
- 2.3 Gesetzliche Regelungen zur Konzernlageberichterstattung
- 2.3.1 Vorschriften des Handelsgesetzbuches
- 2.3.1.1 Der Unterschied zwischen § 289 HGB und § 315 HGB
- 2.3.1.2 Zusammengefasster Konzernlagebericht nach § 315 Abs. 3 HGB
- 2.3.1.3 Das Verhältnis von § 315 Abs. 1 HGB zu § 315 Abs. 2 HGB
- 2.3.2 Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung
- 2.3.2.1 Der Grundsatz der Vollständigkeit
- 2.3.2.2 Der Grundsatz der Richtigkeit
- 2.3.2.3 Der Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
- 2.3.2.4 Weitere Grundsätze
- 2.3.3 Die Deutschen Rechnungslegungsstandards
- 2.3.3.1 Stellung der deutschen Rechnungslegungsstandards
- 2.3.3.2 Der deutsche Rechnungslegungsstandard 15
- 2.3.1 Vorschriften des Handelsgesetzbuches
- 2.4 Inhalt des Konzernlageberichts
- 2.4.1 Perspektive der Konzernlageberichterstattung
- 2.4.2 Überblick über die verschiedenen Berichtsteile
- 2.1 Historie des (Konzern-)Lageberichts
- 3 Empirische Analyse der Risikoberichterstattung der DAX-30-Konzerne
- 3.1 Darstellung der Vorgehensweise
- 3.2 Untersuchungsergebnisse
- 3.2.1 Der Risikobericht
- 3.2.2 Formale Analyse
- 3.2.2.1 Bezeichnung und Stellung der Risikoberichte
- 3.2.2.2 Umfang der Risikoberichte
- 3.2.3 Inhaltliche Analyse
- 3.2.3.1 Angaben zu Einzelrisiken
- 3.2.3.2 Risikokategorisierung
- 3.2.3.3 Beurteilung und Erläuterung der Risiken
- 3.2.3.4 Darstellung des Risikomanagements
- 3.3 Kritische Würdigung der Ergebnisse
- 4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch den Lagebericht gemäß HGB, mit besonderem Fokus auf die Risikoberichterstattung. Ziel ist es, die gesetzlichen Regelungen und die praktische Umsetzung im Kontext der DAX-30-Konzerne zu untersuchen.
- Entwicklung und gesetzliche Rahmenbedingungen der Lageberichterstattung
- Funktion und Zweck des Lageberichts
- Analyse der Risikoberichterstattung in der Praxis
- Kritische Bewertung der Qualität der Risikoberichterstattung
- Zusammenfassende Schlussfolgerungen und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz des Lageberichts und der Risikoberichterstattung im modernen Unternehmensmanagement. Sie skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit.
2 Grundlagen der (Konzern-)Lageberichterstattung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Funktionen des Lageberichts gemäß HGB. Es beleuchtet die gesetzlichen Regelungen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung und den Inhalt des Konzernlageberichts im Detail. Die verschiedenen gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis werden eingehend diskutiert, um ein fundiertes Verständnis der rechtlichen Anforderungen zu schaffen. Die Abgrenzung zum Konzernabschluss und die unterschiedlichen Adressaten des Berichts werden ebenfalls behandelt.
3 Empirische Analyse der Risikoberichterstattung der DAX-30-Konzerne: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Untersuchung der Risikoberichterstattung von DAX-30-Unternehmen. Es beschreibt detailliert die Methodik der Analyse und präsentiert die Untersuchungsergebnisse sowohl formal als auch inhaltlich. Die Ergebnisse werden kritisch bewertet und analysiert, wobei sowohl die Bezeichnung und die Stellung der Risikoberichte, als auch deren Umfang und inhaltliche Ausgestaltung im Fokus stehen. Die Analyse berücksichtigt die Angaben zu Einzelrisiken, die Risikokategorisierung, die Beurteilung und Erläuterung der Risiken sowie die Darstellung des Risikomanagements. Schließlich werden die Ergebnisse kritisch gewürdigt und in den Kontext der bestehenden Literatur eingeordnet.
Schlüsselwörter
Lagebericht, HGB, Risikoberichterstattung, Konzernlagebericht, DAX-30, gesetzliche Regelungen, Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung, empirische Analyse, Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Analyse der Risikoberichterstattung im Lagebericht gemäß HGB
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch den Lagebericht nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), mit besonderem Fokus auf die Risikoberichterstattung. Sie untersucht die gesetzlichen Regelungen und deren praktische Umsetzung in den Lageberichten der DAX-30-Konzerne.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und gesetzlichen Rahmenbedingungen der Lageberichterstattung, die Funktion und den Zweck des Lageberichts, eine Analyse der Risikoberichterstattung in der Praxis, eine kritische Bewertung der Qualität der Risikoberichterstattung sowie zusammenfassende Schlussfolgerungen und einen Ausblick.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bildet die Einleitung. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der (Konzern-)Lageberichterstattung, inklusive historischer Entwicklung, rechtlicher Grundlagen und Funktionen des Lageberichts. Kapitel 3 präsentiert eine empirische Analyse der Risikoberichterstattung der DAX-30-Konzerne mit detaillierter Methodik und Ergebnisdarstellung. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte der (Konzern-)Lageberichterstattung werden im Detail untersucht?
Kapitel 2 untersucht detailliert die historische Entwicklung des Lageberichts (inkl. Aktiengesetz von 1965, Bilanzrichtliniengesetz, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Bilanzrechtsreformgesetz, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz), seine Funktion (Verdichtungsaufgabe, Ergänzungsfunktion, Rechenschaftsfunktion), die gesetzlichen Regelungen im HGB (§ 289 HGB, § 315 HGB), die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit), die Deutschen Rechnungslegungsstandards und den Inhalt des Konzernlageberichts.
Wie wird die Risikoberichterstattung der DAX-30-Konzerne analysiert?
Die empirische Analyse in Kapitel 3 umfasst eine formale Analyse (Bezeichnung, Stellung, Umfang der Risikoberichte) und eine inhaltliche Analyse (Angaben zu Einzelrisiken, Risikokategorisierung, Beurteilung und Erläuterung der Risiken, Darstellung des Risikomanagements) der Risikoberichte der DAX-30-Unternehmen. Die Ergebnisse werden kritisch gewürdigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lagebericht, HGB, Risikoberichterstattung, Konzernlagebericht, DAX-30, gesetzliche Regelungen, Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung, empirische Analyse, Risikomanagement.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die gesetzlichen Regelungen der Lageberichterstattung und deren praktische Umsetzung, insbesondere die Risikoberichterstattung der DAX-30-Konzerne, zu untersuchen und kritisch zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Weins (Autor:in), 2010, Der Lagebericht gemäß HGB. Die Risikoberichterstattung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/159406