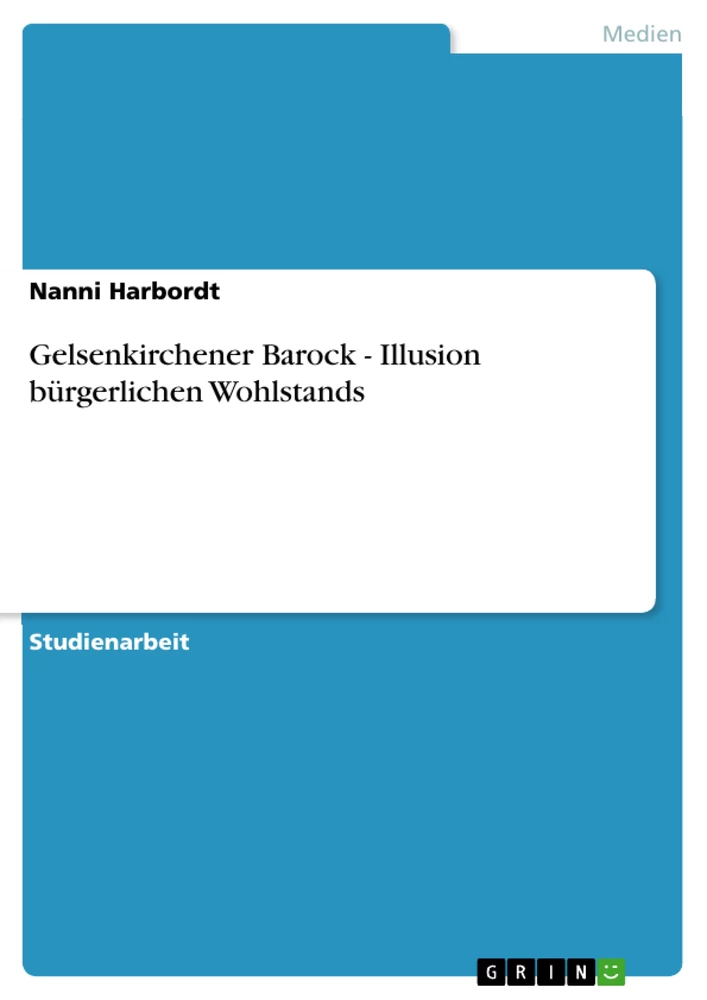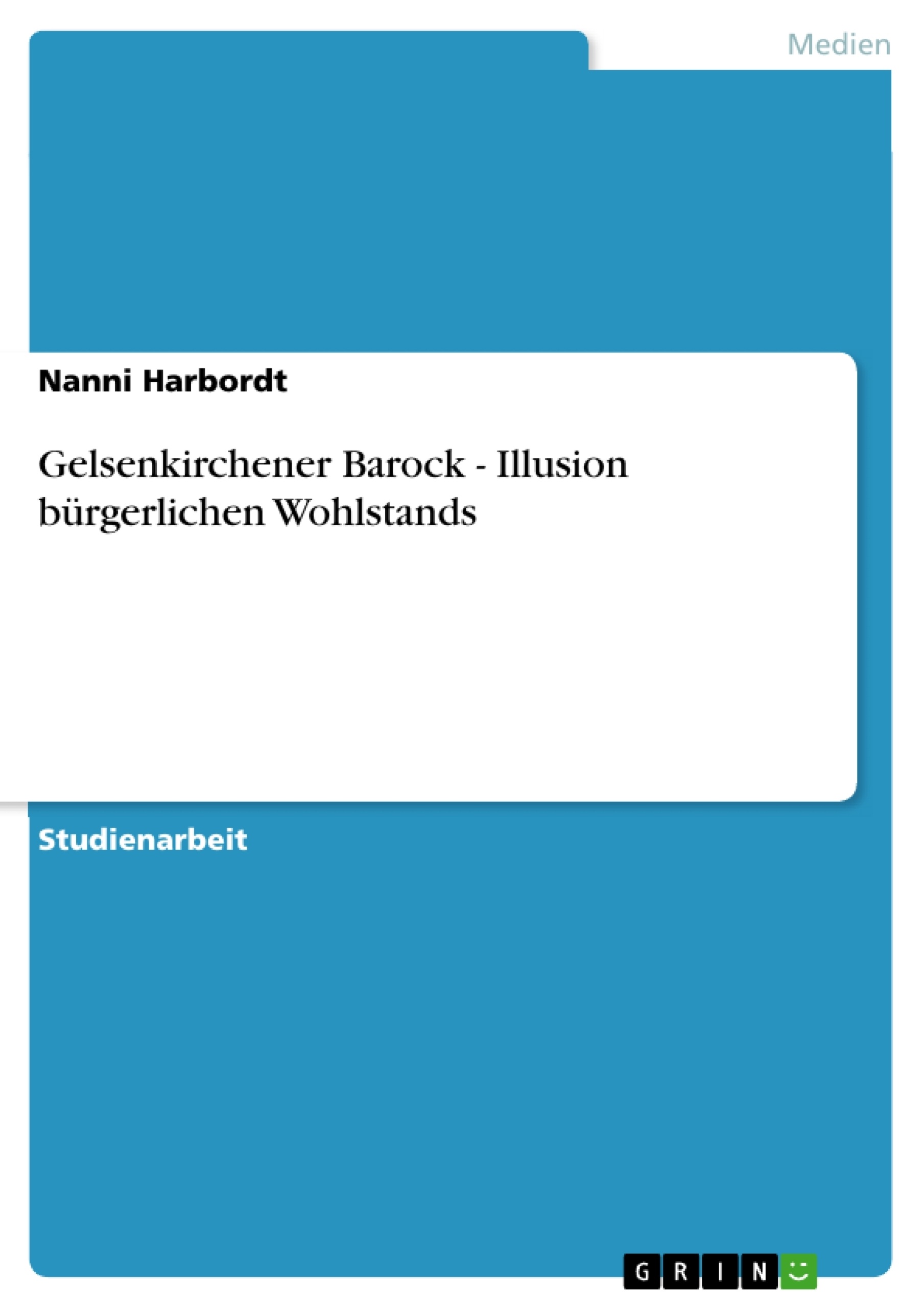Schon der Ausdruck Gelsenkirchener Barock lässt auf schwere und ausladende Formen schließen. Und tatsächlich war ein Möbel dieses Stils insbesondere in den 50er Jahren, in dem es sich recht großer Beliebtheit erfreute, ein Wiederaufgreifen eines bereits sichtlich überkommenen Repräsentationsstils des Bürgertums.
Wo Designer und Werkbund bemüht waren, eine zweckdienliche, praktische und zeitgemäße Einrichtung zu vermitteln, welche sich in den Wohnungstypus einer zeitgenössischen Arbeiterwohnung integrieren ließ, stieg der Absatz von üppigem Mobiliar der Marke Gelsenkirchener Barock im ersten Jahrzehnt der Nachkriegszeit bei den breiten Massen wieder entschieden an.
Die Möbel trugen zunehmend das Etikett kleinbürgerliches Bergarbeitermöbel und wurden zum Inbegriff von unzeitgemäßem Kitsch und schlechtem Geschmack.
Dennoch wurden bis zu drei Monatsöhne gezahlt um die eigenen vier Wände mit einem typischen Schrank des Gelsenkirchener Barock für die Wohnküche oder später das Wohnzimmer auszustatten.
Innerhalb der Arbeit soll die Entstehung des Begriffes und die damit in Zusammenhang stehende Produktion im Hintergrund von Mechanisierung und dem Einsatz neuer Holzwerkstoffe aufgezeigt werden. Weiterhin sollen an ausgewählten Beispielen die Motive der Beliebtheit und auch die Argumente für die Missbilligung dieser Möbel erörtert werden.
Da die Forschungsliteratur zu diesem Thema leider sehr spärlich ist, hat mir der 1991 erschienene Ausstellungskatalog zu der Ausstellung „Gelsenkirchener Barock“ im Städtischen Museum Gelsenkirchen als wesentliche Quelle gedient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wohnungseinrichtung in den 50er Jahren – Leitbilder und Vorlieben
- Zum Begriff Gelsenkirchener Barock
- Luxuriös wirkende Bauch- und Glanzmöbel durch maschinelle Produktion
- Der Wohnküchenschrank – Jahrzehnte Ausdruck gediegener Küchengemütlichkeit
- Von der Wohnküche zur Einbauküche
- Mit und ohne Barfach
- Musik versteckt in einem Schrank
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Popularität des „Gelsenkirchener Barock“, eines Möbelstückstils der 1950er Jahre. Sie beleuchtet die Produktionsmethoden im Kontext der Mechanisierung und neuer Werkstoffe, analysiert die Gründe für die Beliebtheit und Kritik dieses Stils und betrachtet ihn im Kontext der Wohnungseinrichtung der Nachkriegszeit.
- Der Begriff „Gelsenkirchener Barock“ und seine Entwicklung
- Die Rolle der maschinellen Produktion und neuer Werkstoffe
- Die Beliebtheit und Kritik des Gelsenkirchener Barock im Kontext der Wohnkultur der 1950er Jahre
- Der Wohnküchenschrank als repräsentatives Beispiel des Stils
- Die Integration von Unterhaltungselektronik in Möbel im Stil des Gelsenkirchener Barock
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Gelsenkirchener Barock“ ein und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie beschreibt den Gelsenkirchener Barock als einen Stil, der trotz seiner Kritik als kitschig und unzeitgemäß empfunden, in den 1950er Jahren große Beliebtheit genoss und zeigt auf, dass die Arbeit sich mit der Entstehung des Begriffs, den Produktionsmethoden und den Gründen für die Beliebtheit und Ablehnung auseinandersetzt, unter Hinweis auf die begrenzte Forschungsliteratur und die Verwendung des Ausstellungskatalogs von 1991 als Hauptquelle.
Wohnungseinrichtung in den 50er Jahren – Leitbilder und Vorlieben: Dieses Kapitel beschreibt die Leitbilder des Wohnungsbaus und der Einrichtung in den 1950er Jahren. Sozial verantwortliches Bauen mit klaren Linien und Transparenz stand im Vordergrund. Die Nachkriegswohnungen waren oft klein, und das Wohnzimmer wurde zum zentralen Raum. Einbaumöbel wurden als moderne, platzsparende Lösung propagiert, stießen aber bei vielen Arbeitern auf Ablehnung, die stattdessen traditionelle Möbel bevorzugten, darunter der Gelsenkirchener Barock.
Zum Begriff Gelsenkirchener Barock: Dieses Kapitel klärt den Begriff „Gelsenkirchener Barock“. Der Begriff, der heute oft abwertend verwendet wird, war ursprünglich ein scherzhafter Ausdruck für wilhelminische Hausfassaden und wurde später auf einen bestimmten Möbelstil angewendet. Der Text widerlegt frühere Annahmen zur Entstehung des Begriffs und betont den Wunsch der Region, sich von den negativen Konnotationen zu distanzieren.
Luxuriös wirkende Bauch- und Glanzmöbel durch maschinelle Produktion: Dieses Kapitel beschreibt die maschinelle Produktion des Gelsenkirchener Barock. Die scheinbar handwerkliche Aufmachung der Möbel stand im Gegensatz zur industriellen Massenproduktion. Die Entwicklung von neuen Werkstoffen wie Sperrholz ermöglichte eine rationellere Fertigung und neue Gestaltungsmöglichkeiten, die jedoch von Designern als unehrlich kritisiert wurden, da sie traditionellen Stilen nachempfanden, ohne dessen handwerkliche Qualität aufzuweisen.
Der Wohnküchenschrank – Jahrzehnte Ausdruck gediegener Küchengemütlichkeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Wohnküchenschrank als typisches Beispiel des Gelsenkirchener Barock. Es beschreibt die Entwicklung von der traditionellen Wohnküche zur modernen Einbauküche und die anhaltende Beliebtheit des Wohnküchenschranks, der auch nach dem Wandel in das Wohnzimmer integriert wurde. Drei verschiedene Modelle aus den 1950er Jahren werden detailliert beschrieben, um die Vielfalt der Ausführungen und den anhaltenden Preis zu veranschaulichen.
Musik versteckt in einem Schrank: Dieses Kapitel behandelt die Integration von Unterhaltungselektronik wie Radios und Plattenspielern in Schränke im Stil des Gelsenkirchener Barock. Die Geräte wurden oft hinter Türen versteckt, um den Eindruck von Wert und Tradition zu verstärken. Der Text kontrastiert diese versteckte Präsentation mit dem späteren Trend zur offenen Präsentation moderner Technik.
Schlüsselwörter
Gelsenkirchener Barock, Nachkriegsmoderne, Wohnungseinrichtung, Massenproduktion, Mechanisierung, Holzwerkstoffe, Wohnkultur, Konsum, Kitsch, Geschmack, soziale Klassen, Einbaumöbel, Wohnküche, Unterhaltungselektronik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Gelsenkirchener Barock
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Popularität des „Gelsenkirchener Barock“, eines Möbelstückstils der 1950er Jahre in Deutschland. Sie analysiert die Produktionsmethoden, die Beliebtheit und Kritik dieses Stils und betrachtet ihn im Kontext der Wohnungseinrichtung der Nachkriegszeit. Die Arbeit stützt sich unter anderem auf den Ausstellungskatalog von 1991.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Begriffs „Gelsenkirchener Barock“, die Rolle der maschinellen Produktion und neuer Werkstoffe (z.B. Sperrholz) bei der Herstellung dieser Möbel, die Beliebtheit und Kritik des Stils im Kontext der Wohnkultur der 1950er Jahre, den Wohnküchenschrank als repräsentatives Beispiel und die Integration von Unterhaltungselektronik (Radio, Plattenspieler) in die Möbel.
Wie wird der „Gelsenkirchener Barock“ definiert?
Der Begriff „Gelsenkirchener Barock“, heute oft abwertend verwendet, war ursprünglich ein scherzhafter Ausdruck für wilhelminische Hausfassaden. Später wurde er auf einen bestimmten, oft opulenten Möbelstil angewendet. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung und die regionale Bedeutung des Begriffs.
Welche Rolle spielte die maschinelle Produktion?
Die maschinelle Produktion ermöglichte die Herstellung von scheinbar handwerklich gefertigten Möbeln in Massen. Neue Werkstoffe wie Sperrholz erlaubten eine rationellere Fertigung und neue Gestaltungsmöglichkeiten. Diese industrielle Produktion wurde jedoch von Designern auch kritisiert, da sie traditionelle Stile nachahmte, ohne deren handwerkliche Qualität zu erreichen.
Welche Bedeutung hatte der Wohnküchenschrank?
Der Wohnküchenschrank wird als typisches Beispiel des Gelsenkirchener Barock betrachtet. Die Arbeit beschreibt dessen Entwicklung von der traditionellen Wohnküche zur modernen Einbauküche und die anhaltende Beliebtheit des Schranks, der auch nach dem Wandel in das Wohnzimmer integriert wurde. Die Analyse umfasst detaillierte Beschreibungen verschiedener Modelle.
Wie wurde Unterhaltungselektronik integriert?
Geräte wie Radios und Plattenspieler wurden oft hinter Türen in Schränken versteckt, um den Eindruck von Wert und Tradition zu verstärken. Die Arbeit vergleicht diese versteckte Präsentation mit dem späteren Trend zur offenen Präsentation moderner Technik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Wohnungseinrichtung der 1950er Jahre, zum Begriff „Gelsenkirchener Barock“, zur maschinellen Produktion, zum Wohnküchenschrank, zur Integration von Unterhaltungselektronik und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel fasst die jeweiligen Schwerpunkte zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gelsenkirchener Barock, Nachkriegsmoderne, Wohnungseinrichtung, Massenproduktion, Mechanisierung, Holzwerkstoffe, Wohnkultur, Konsum, Kitsch, Geschmack, soziale Klassen, Einbaumöbel, Wohnküche, Unterhaltungselektronik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und Popularität des Gelsenkirchener Barock zu untersuchen und dessen Bedeutung im Kontext der Wohnkultur der 1950er Jahre zu beleuchten. Sie analysiert den Stil, seine Produktionsmethoden und die Gründe für seine Beliebtheit und Ablehnung.
- Arbeit zitieren
- Nanni Harbordt (Autor:in), 2009, Gelsenkirchener Barock - Illusion bürgerlichen Wohlstands, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/157576