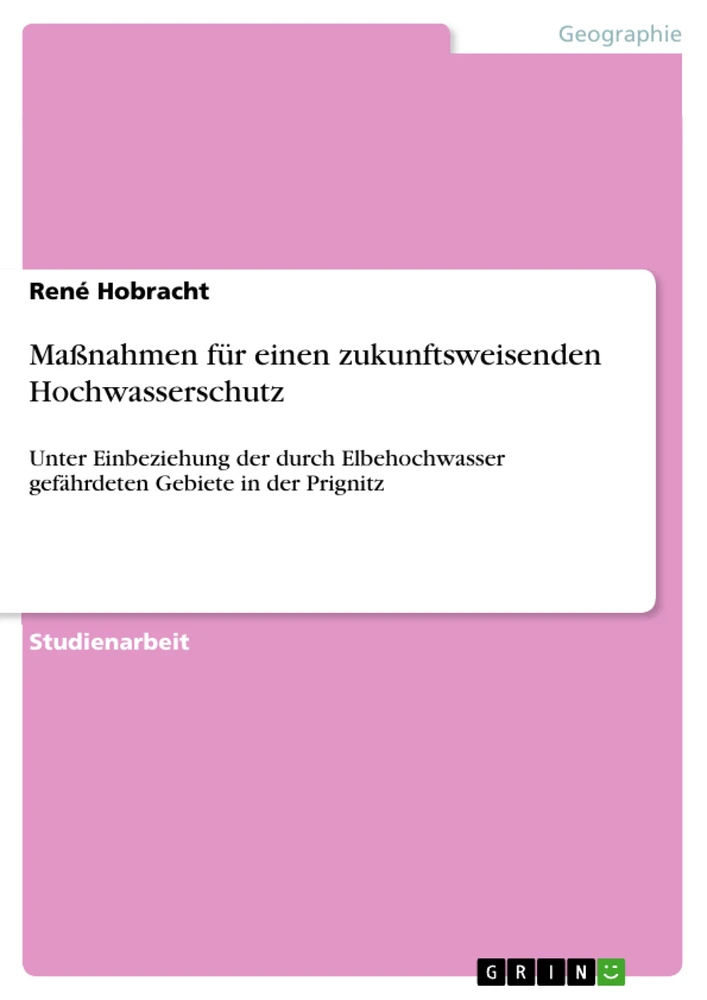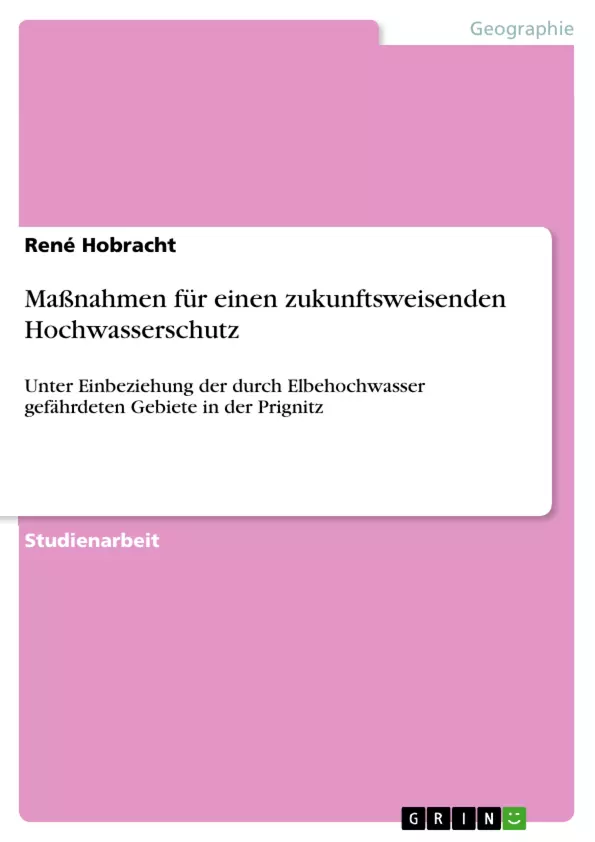Im Sommer 2002 bildeten sich nach Starkniederschlägen an mehreren großen Flüssen Flutwellen mit extrem hohen Pegelständen aus, die zu großflächigen Überschwemmungen in den Unterläufen führten. In Deutschland waren vor allem der Süden und der Osten betroffen. Diese Überschwemmungen führten insgesamt zu der teuersten Naturkatastrophe der Bundesrepublik Deutschland.
Menschen haben über Jahrhunderte hinweg an Flussläufen gesiedelt, die ihnen eine Reihe von Vorteile brachten, sei es zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage oder zum Transport der verschiedensten Güter. Flüsse beeinflussen das Leben der Menschen seit jeher, aber auch die Menschen durch ihre Siedlungstätigkeiten haben versucht, die Flussläufe zu ihrem Nutzen umzugestalten. Die größte Gefahr, die von einem Fluss ausgehen kann, ist wohl ohne Zweifel die des Hochwassers. Um jedoch weiterhin am Fluss siedeln zu können, musste der Gefahr des Hochwassers entgegnet werden. Auch die Elbe blieb nicht von Hochwassern verschont und wird es in Zukunft auch nicht bleiben. Das letzte große Hochwasserereignis an der Elbe fand im August 2002 statt. Ich konzentriere mich in erster Linie auf die Gegebenheiten und Strukturen in der brandenburgischen Prignitz. Im Vergleich zu anderen Regionen waren die durch das Hochwasser verursachten Schäden relativ gering. Welche Faktoren bei der Hochwasserabwehr zum Tragen kommen, wird Bestandteil der folgenden Darstellungen sein.
Diese Arbeit geht darauf ein, wie der Mensch die natürlichen Flussläufe zu seinem eigenen, vor allem wirtschaftlichen, Nutzen umgestaltet hat und welche Einflüsse eben diese Veränderungen auf das Ausmaß von Hochwassern haben. Ob Hochwasser nun natürliche Ereignisse sind oder ob sie erst durch anthropogenes Handeln verursacht werden, spielt keine Rolle beim vorsorgenden Hochwasserschutz, denn festzuhalten bleibt, dass der potentiellen Gefahr des Hochwassers entgegen getreten werden muss. Dafür stehen einige Akteure und Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die in den folgenden Kapiteln ausführlich dargestellt werden.
Oft werden aus Katastrophen weitreichende Konsequenzen gezogen, jedenfalls auf dem Papier. Die Realität sieht oft erschreckend anders aus. Auch aus den Hochwasserereignissen an der Elbe von 2002 wurden Konsequenzen gezogen. Dies verdeutlichen diverse Richtlinien, Programme und Gesetze.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Hochwasser - Naturereignis oder hausgemacht?
- Akteure, Grundsätze und Ziele im Hochwasserschutz
- Europäische Ebene
- Wasserwirtschaft
- Raumordnung auf Bundesebene
- Landesplanung
- Regionalplanung
- Bauleitplanung
- Fachplanungen
- Individuelle Bauvorsorge
- Konsequenzen aus den Hochwasserereignissen von 2002
- Möglichkeiten und Grenzen der Hochwasserbeeinflussung
- Retentionsraumsicherung- und erweiterung
- Freie Flutung ausgedehnter Auenbereiche (Deichrückverlegung)
- Ungesteuerte Sommerpolderflutung
- Gesteuerte Polderflutung
- Rückhalt von Niederschlagswasser in der Fläche
- Rückhalt von Niederschlagswasser in Siedlungsflächen und im Freiraum
- Speicherung in Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken
- Verminderung der Schadenspotentiale
- Retentionsraumsicherung- und erweiterung
- Kennzeichnung der durch Elbehochwasser gefährdeten Areale in Brandenburg
- Die Ereignisse im August 2002 an der Elbe
- Hochwasserschutzmaßnahmen in der Prignitz
- Deichrückverlegung Lenzen
- Deichsanierung im Rühstädter Bogen
- Fazit: Lektion gelernt?
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Hochwasserschutz an der Elbe, insbesondere in der Prignitz, und beleuchtet die Frage, ob Hochwasserereignisse zu einem Umdenken in der Politik und bei den Bürgern führen. Sie analysiert die Einflüsse anthropogener Eingriffe auf das Ausmaß von Hochwassern und stellt die verschiedenen Akteure und Handlungsmöglichkeiten im Hochwasserschutz vor.
- Analyse der anthropogenen Einflüsse auf Hochwasserereignisse
- Untersuchung der Auswirkungen von Hochwasserereignissen auf die Prignitz
- Bewertung von Hochwasserschutzmaßnahmen und deren Wirksamkeit
- Diskussion der Rolle von Politik und Bürgern im Hochwasserschutz
- Bewertung des Umdenkens in der Politik und bei den Bürgern nach den Hochwasserereignissen von 2002
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Hochwasserereignisse von 2002 an der Elbe erläutert und die Relevanz des Themas für die Prignitz hervorhebt. Kapitel 2 befasst sich mit der Frage, ob Hochwasser ein Naturereignis oder eine Folge menschlicher Eingriffe ist. Es werden die natürlichen Faktoren, die Hochwasser verursachen, wie meteorologische und hydrologische Bedingungen, sowie die durch den Menschen verursachte Beeinflussung der Flüsse beleuchtet. Kapitel 3 stellt die verschiedenen Akteure, Grundsätze und Ziele im Hochwasserschutz vor. Dabei werden die Ebenen von der europäischen bis zur lokalen Ebene betrachtet, sowie die verschiedenen Akteure wie Wasserwirtschaft, Raumordnung und Fachplanungen. Kapitel 4 diskutiert die Konsequenzen aus den Hochwasserereignissen von 2002 und beleuchtet die Reaktion der Politik und der Gesellschaft auf die Katastrophe. Kapitel 5 analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Hochwasserbeeinflussung. Dabei werden verschiedene Maßnahmen wie Retentionsraumsicherung, Rückhalt von Niederschlagswasser und Verminderung der Schadenspotentiale vorgestellt. Kapitel 6 kennzeichnet die durch Elbehochwasser gefährdeten Gebiete in Brandenburg. Kapitel 7 beschreibt die Ereignisse im August 2002 an der Elbe. Kapitel 8 präsentiert die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Prignitz, insbesondere die Deichrückverlegung in Lenzen und die Deichsanierung im Rühstädter Bogen.
Schlüsselwörter
Hochwasserschutz, Elbe, Prignitz, Hochwasserereignisse, anthropogene Einflüsse, Retentionsraum, Deichrückverlegung, Wasserwirtschaft, Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung, Fachplanungen, Politik, Bürger, Umdenken
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts (B.A.) René Hobracht (Autor:in), 2009, Maßnahmen für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/157047