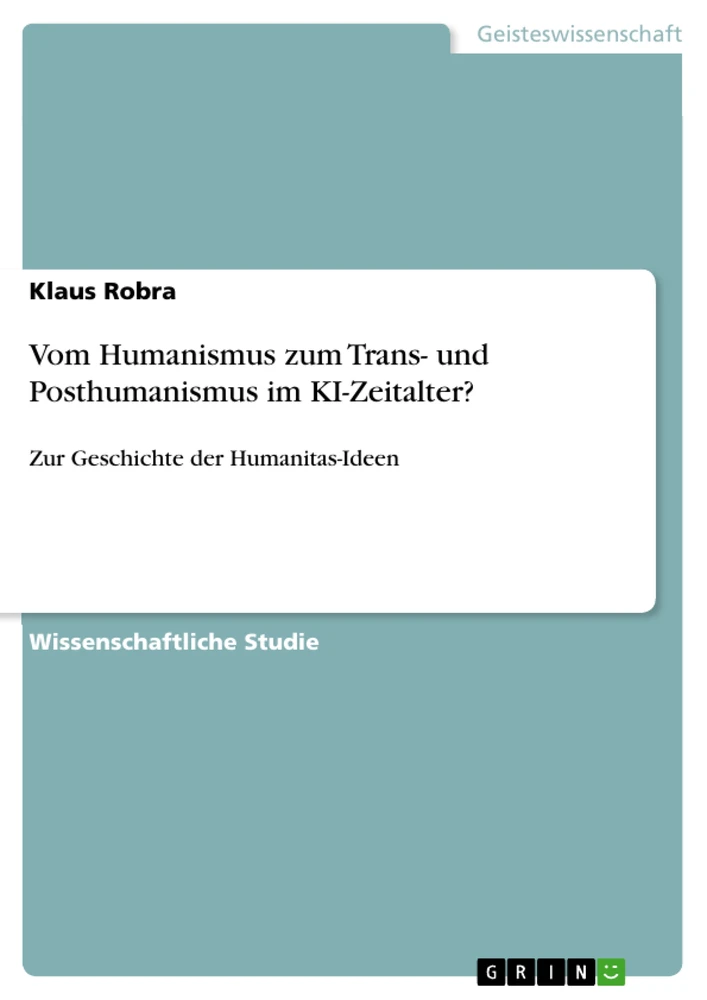Alles ist für uns vorbei, wenn die „Singularity“ eintritt, die Ray Kurzweil für das Jahr 2045 vorausgesagt hat. Denn dann werde die Menschheit durch superintelligente KI-Roboter ersetzt. Das aber wäre wohl das Ende jeglicher konkreter Utopie, jeglicher Sinnstiftung, wie sie in den mehr als 2000 Jahren Geschichte des Humanismus immer wieder versucht worden sind. Zu fragen ist daher u.a.: Bedeutet KI wirklich das Ende der Menschheit und damit des Humanismus? Oder ist ein vernünftiger, sinnvoller Umgang mit der KI denk- und machbar? Wie ist die KI überhaupt einzuschätzen? Und: Welche Alternativen stellt der Humanismus dem Trans- und Posthumanismus und der „Singularity“ entgegen? Können Natur und Kultur im Humanismus vereint werden?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
A) Was Humanismus nicht ist
1. Nietzsches Antihumanismus
2. Zu Heideggers Brief über den Humanismus
3. Zu Michel Foucault(1926-1984)
B) Antike Vorläufer und Vorbilder des Humanismus
Zu den Menschenbildern einzelner Philosophen
Heraklit(ca. 520-460 v.Ch.)
Demokrit(ca. 460-370 v.Chr.)
Platon(427-347 v.Chr.)
Aristoteles(ca. 384-322 v.Chr.)
Epikur(ca. 342-271 v.Chr.)
Lukrez(ca. 99-54 v.Chr.)
Sonderfälle: die Sophistik, die Stoa und der Skeptizismus
Religiöse Faktoren
Kritische Würdigung
C) Renaissance-Humanismus
Giotto(ca. 1266-1337)
Petrarca(1304-1374)
Giovanni Boccaccio(1313-1375)
Renaissance-Kunst
Erasmus von Rotterdam(1467-1536)
D) Von der Renaissance bis zur Romantik
Zwischen Renaissance und Barock: die Utopisten Morus und Campanella
Descartes‘ Menschenbild
Jean-Jacques Rousseau(1712-78)
Kants Menschenbild
Die Toleranz-Idee bei Voltaire, Lessing, Goethe u.a
Zum Humanitäts-Ideal des Deutschen Idealismus
Der Neuhumanismus von Wilhelm von Humboldt(1767-1835)
Zum Menschenbild der Romantik
E) Atheistischer und sozialistischer Humanismus: von Marx zu Bloch
Karl Marx(1818-1883)
Ernst Bloch(1885-1977)
F) Andere Konzepte
Sartres Humanismus: existenzialistisch? marxistisch? anarchistisch?
Albert Camus(1913-60)
Humanistik,
Julian Nida-Rümelin(geb. 1954)
G) Trans- und Posthumanismus
Update Kurzweil 2024: ‚ Die nächste Stufe der Evolution‘
H) Unabdingbar: Digitalisierung und Anthropologie im KI-Zeitalter, Grund- und Leitsätze des Humanismus
„Digitaler Humanismus“
Anthropologie für das KI-Zeitalter
Grund- und Leitsätze des Humanismus
Literaturhinweise
Einleitung
„Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“ So beginnt Ernst Bloch seine Tübinger Einleitung in die Philosophie (Frankfurt a.M. 1963/1970, S. 11). Wer den Autor nicht kennt, könnte wohl fragen, warum er vom „Ich bin“ zum „Ich habe mich nicht“ und sodann vom Ich zum Wir wechselt. Oder auch: Was sind wir denn und wie werden wir es? Antworten hierauf sind natürlich nicht nur in der zitierten Einleitung, sondern auch im Gesamtwerk Blochs zu finden, das als durch und durch humanistisch aufgefasst werden kann (s.u.). Nur so viel: Was uns „hat“, sind nicht wir, sondern die Natur und mit ihr die Materie in ihrer „unvollendeten Entelechie“, wie es Bloch ausdrückt. Was wir sind und wie wir es werden können, steht keineswegs endgültig fest.
Aber: Alles ist für uns vorbei, wenn die „Singularity“ eintritt, die Ray Kurzweil für das Jahr 2045 vorausgesagt hat. Denn dann werde die Menschheit durch superintelligente KI-Roboter ersetzt. Das aber wäre wohl das Ende jeglicher Konkreter Utopie, jeglicher Sinnstiftung, wie sie in den mehr als 2000 Jahren Geschichte des Humanismus immer wieder versucht worden sind. Weitere Fragen lauten daher: Bedeutet KI wirklich das Ende der Menschheit und damit des Humanismus? Oder ist ein vernünftiger, sinnvoller Umgang mit der KI denk- und mach-bar? Wie ist die KI überhaupt einzuschätzen? Und: Welche Alternativen stellt der Humanismus dem Trans- und Posthumanismus und der „Singularity“ entgegen? Können Natur und Kultur im Humanismus vereint werden? Hierzu mehr im Folgenden.
A) Was Humanismus nicht ist
1. Nietzsches Antihumanismus
In einem Beitrag zum Sammelband Humanistik (2012) stellt Hubert Cancik fest:
„Nietzsches Programm für die Schule eines „neuen Adels“. Das Modell für diesen Adel liefert ihm eine historische Konstruktion, Nietzsches griechischer Staat. Dieser Staat ist nicht das klassische Athen, geschweige denn die Weltreiche des Hellenismus, sondern die archaische, vorklassische Zeit von Homer bis zu den Perserkriegen, also das 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr. Hier, in der griechischen Archaik, findet Nietzsche Klassenstaaten und Raubstaaten, die von Krieg und unfreier Arbeit leben. Da diese Staaten erfolgreich, kulturell und künstlerisch kreativ waren, geben sie der Gegenwart die folgenden Lehren:
- „Würde der Arbeit“ gibt es nicht, Arbeit ist Mühsal und entehrend; deshalb ist der Arbeiter würdelos
- die „Würde des Menschen“ ist ein „Phantom“, Würde haben nur die „höheren Menschen“,
- „Grundrechte des Menschen“ – „sogenannte“ – sind „Lüge“. “ (a.a.O.)
Dementsprechend lehnt Friedrich Nietzsche (1844-1900) nicht nur das allgemeine Stimmrecht ab, sondern ist auch „für die Vorbereitung von Kriegen und gegen den Pazifismus der „internationalen heimatlosen Geldeinsiedler“ (Börse).
Nietzsche ist gegen die Verkürzung der Arbeitszeit in Basel 1872 von zwölf auf elf Stunden für Erwachsene. Die Arbeitszeit für Kinder beträgt 1870 in Basel zehn bis zwölf Stunden. Nietzsche ist für die Begrenzung der Schulpflicht, gegen die Verbreitung von Bildung, ins- besondere gegen Arbeiterbildungsvereine, gegen die Zulassung von Mädchen zum Gymna-sium, gegen das Frauenstimmrecht.
Nietzsches politische Grundsätze und Forderungen werden von ihm historisch und philoso- phisch begründet und illustriert – mit einer archaisierten, aufs Aristokratische verengten An- tike, mit Platons Staatslehre und dionysischem Irrationalismus. Seine Kritik an Gymnasium, Philologie und aufgeklärtem Humanismus steigert sich zur Negation von Menschenwürde und Menschenrechten. Durchaus mit den Mitteln humanistischer Gelehrsamkeit entwickelt schon der frühe Nietzsche einen aggressiven Antihumanismus.
Antihumanismus kann verschiedene Wissensgebiete, Philosophien und historische Muster be- nutzen. Nietzsches Antihumanismus ist der spezifische Antihumanismus eines Gelehrten, eines Künstlers, eines Philhellenen. Die besonderen Züge seines Antihumanismus lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- er negiert ausdrücklich die Aprioris des aufgeklärten und humanitären Humanismus: die Würde des Menschen, die Gleichheit der Menschen als Menschen, die Menschenrechte,
- er unternimmt es, seinen Antihumanismus auch aus antiken Texten und mit Beispielen aus antiker Geschichte zu begründen,
- er führt partiell (alt-)humanistische Traditionen fort, z. T. hyperaffirmativ, ultrakonservativ (Renaissancismus): er setzt auch für den „neuen Adel“ stark auf Erziehung; er artikuliert sich primär literarisch.“
Cancik endet mit der folgenden Zusammenfassung des ganzen Textes:
„Leben und Werk Nietzsches sind ein Exempel für christliche und humanistische Bildung im 19. Jahrhundert. Gegen einen aufgeklärten, bürgerlichen, fortschrittsfreundlichen Humanis-mus entwickelt Nietzsche einen aggressiven Antihumanismus. Gegen das liberale pro-testantische Christentum steht sein Antichrist. Nietzsches Humanismuskritik ist zunächst eine Kritik der Bildungsanstalten, die ihn geformt haben, im Namen einer wahren humanistischen Erziehung, die den „ganzen“ Menschen bildet, nicht nur gelehrte Fertigkeiten vermittelt. Hiermit verbunden ist die Kritik an einer Altertumswissenschaft, die dem Unterricht und dem humanistischen Weltbild das falsche Paradigma vom Altertum zugrunde legt: das bürgerliche, demokratische, sokratische Athen des 5.-4. Jahrhunderts statt einer imaginären aristokrati-schen Archaik. Nietzsches Anti-Humanismus bedeutet Negierung von Menschenwürde und allgemeinen Menschenrechten, Verstärkung und Rechtfertigung von Ungleichheit, Unter-drückung und Erniedrigung. Die Vertierung des unvornehmen Teils der Menschheit und seine Deklaration zum Werkzeug gehören zu Topik und Logik des Antihumanismus bei Nietzsche.“ (a.a.O.)
Tatsächlich hat Nietzsche den Menschen als „das nicht festgestellte Tier bezeichnet“, das seit Beginn der Neuzeit „vom Mittelpunkt ins X“ gerückt sei; ohnehin sei der Mensch etwas, das „überwunden“ werden müsse – hin zu dem mit unumschränktem „Willen zur Macht“ ausge-statteten „Übermenschen“. (Was ein Grund dafür sein mag, dass der Zarathustra bei den Trans- und Posthumanisten des Silicon Valley als Pflichtlektüre gilt.)
Was bei Cancik zu kurz kommt, ist Nietzsches massive Kritik an Kant, am Christentum und am Sozialismus – was Hauptmotive seines Antihumanismus sein dürften. Denn er übt radikale Kritik nicht nur an den frühchristlichen Werten, sondern am Christentum und der Kirche im Ganzen der Geschichte. Auf diese Kritik gründet er auch seine berühmte Forderung nach der „Umwertung aller Werte“, nachzulesen in seinen Schriften „Zur Genealogie der Moral“ (1887) und „Der Antichrist“ (1888).
Dabei dürfte Nietzsche in einigen Aspekten – trotz teilweise völlig übertriebener Polemik – durchaus Recht haben, so, wenn er bestimmte Auswüchse brandmarkt, insbesondere dieje-nigen der seit dem vierten Jahrhundert n.Chr. mit der Würde einer Staatsreligion aus-gestatteten ‚Ecclesia triumphans‘, der triumphierenden Kirche (Kreuzzüge, lebensfeindliche Scheinmoral der „asketischen Priester“, Kulturverfall usw.). Als einen für solche Fehl-entwicklungen Hauptverantwortlichen bezeichnet Nietzsche allerdings den Apostel Paulus, den er gegen Jesus auszuspielen versucht.1
Grundlage seiner umfassenden Kritik am Christentum ist zweifellos seine radikale Ablehnung der frühchristlichen Werte. Dies gilt zunächst für seine Stellungnahme zur Bergpredigt. Sein Vor-Urteil hierzu lautet, in der Psychologie des Neuen Testamentes fehlten völlig die Begriffe Schuld, Strafe und Belohnung – ein Fehlurteil, wie ein Blick auf die tatsächlichen Aussagen der Evangelisten und Apostel zeigt.
Gleiches gilt für Nietzsches Ablehnung des christlichen Gottesbegriffs, den er – entgegen der Logos-Lehre – als völlig lebensfeindlich, nämlich als „zum Widerspruch des Lebens abge-artet“ missversteht. Zudem erkennt er in keiner Weise die Schutzfunktion der Bergpredigt und anderer Aussagen Jesu zur Verteidigung der Armen, Schwachen und Unterprivilegierten. Stattdessen polemisiert er dagegen, dass der Christ „dem, der böse gegen ihn ist, weder durch Wort, noch im Herzen Widerstand leistet. Daß er keinen Unterschied zwischen Fremden und Einheimischen, zwischen Juden und Nicht-Juden macht (>der Nächste< eigentlich der Glaubensgenosse, der Jude). Daß er sich gegen niemanden erzürnt, niemanden geringschätzt. Daß er sich bei Gerichtshöfen weder sehen läßt, noch in Anspruch nehmen läßt “.2 Nietzsche sieht offenbar nicht, dass Jesus nicht nur eine neue Moral verkündet, sondern den – oftmals höchst gefährdeten – Gläubigen durch und durch pragmatische Verhaltensregeln mit auf den Weg gibt.
Die Moral Jesu wertet Nietzsche ohnehin als „Moral des gemeinen Mannes“ und sogar als „Sklavenmoral“ ab. Diese beruhe auf einem „Aufstand“ der Schwachen und Armen gegen die „Herrenmoral“ der Herrschenden, was letztlich auf ein „Ressentiment“, ein rachsüchtiges Minderwertigkeitsgefühl, zurückzuführen sei. Der unterdrückte „kleine Mann“ wolle Rache nehmen dafür, dass er von den herrschenden, „vornehmen“ Tatmenschen zur Untätigkeit gezwungen werde (a,a,O. S. 192-195). Als den „größten Wert-Gegensatz, den es gibt“ erkennt Nietzsche denjenigen zwischen „christlichen“ und „vornehmen“ Werten (ebd. S. 514).
Dahinter steht jedoch nichts anderes als der anscheinend unüberwindliche Gegensatz von Arm und Reich, Unterdrückern und Unterdrückten, Herren und Knechten. Diesen Gegensatz erhebt Nietzsche quasi zu einem Naturgesetz, an dem nicht zu rütteln sei, so dass die „Sklaven-moral“ – und mithin die Moral der frühchristlichen Werte – auf keinen Fall die Oberhand gewinnen dürfe. Damit entpuppt Nietzsche sich nicht nur in ideologischer und sozialer, sondern auch in politischer Hinsicht als radikaler Widersacher der Ideale des Evangeliums. Für Nächsten-, Fernsten- und Feindesliebe hat er fast nur Hohn und Spott übrig. Wie sehr er den berechtigten Kampf Jesu gegen Unterdrückung, Machtmissbrauch und Korruption verkennt, geht aus der folgenden Bibelstelle hervor, in der es heißt, Jesus habe die Jünger zu sich gerufen und ihnen erklärt: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ (Matth. 20, 25-28).
Unmittelbar verstehbar wird hieraus, woher Nietzsches Begriff „Sklavenmoral“ stammt. Unmissverständlich ist jedoch auch Jesu mitreißende Botschaft, die ich für durchaus revo-lutionär halte. Eine Liebes-Gemeinschaft ohne Herrschaft von Oberen über Untergebene ist möglich; Willkür und Machtmissbrauch können durch eine neue Moral des Dienens und der Nächstenliebe ersetzt werden. Mit jeglicher Oben-Unten-Hierarchie, wie sie z.B. der von Nietzsche ausdrücklich gelobte Platon in seiner Staatslehre anpreist, ist Jesu neue Gemeinschafts-Ordnung, sein Neuer Bund, unvereinbar. Ebenso natürlich auch Nietzsches Verehrung und Verherrlichung von Gewaltfanatikern und Massenmördern wie Cäsar und Napoleon.
Ebenso schwer wiegen diejenigen Analysen und Konzepte Nietzsches, die als eindeutig anti-sozialistisch bzw. anti-marxistisch einzustufen sind. Während Marx u.a. anhand seiner Kritik letztlich das Individuum mit der Gesellschaft versöhnen will, sieht Nietzsche genau darin eine unverzeihliche „Gleichmacherei“, eine „Dystopie, die alle Menschen gleichermaßen zu Sklaven macht“, einen „Zustand <der tiefsten Vermittelmäßigung und Chineserei>“ (Nietzsche ebd.). Womit Nietzsche allerdings, mir nichts, dir nichts, Marxens Ziel einer „freien Assoziation freier Individuen“ ins Gegenteil verkehrt. Marx und Engels als Ziel die „Vernichtung des Individuums“ zu unterstellen, bedeutet nichts anderes als die völlige Verkennung und maßlose Diffamierung des Sozialismus! Den Nietzsche ebenso schroff ablehnt wie die Demokratie, hinter deren Prinzip der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz er, wohl zu Recht, den Einfluss des Christentums ausmacht, durch das in der Antike erstmals die Gleichheit aller Menschen vor Gott proklamiert wurde.
Eine herrschaftsfreie Gesellschaft ist für Nietzsche undenkbar; Ausbeutung und ständige Unterdrückung der „Sklaven“ durch die ausbeutenden Herren hält er für naturgemäß und unabänderlich. Was im Ganzen durchaus wie eine Vorwegnahme des Faschismus wirkt.
Zur Herrenmoral passt vortrefflich Nietzsches aggressiver Anti-Feminismus, im ‚Zarathustra‘ kurz und bündig: „So will ich Mann und Weib: kriegstüchtig den Einen, gebärtüchtig das Andre“ (S. 55), wobei er überdies Frauen zumutet, ständig „in sklavenähnlichen Verhältnissen leben“ zu müssen (S. 54). – Ebenso vortrefflich passt dazu Nietzsches Verehrung und Verherrlichung von Gewalt-Herrschern wie Cäsar und Napoleon. Entscheidend ist für ihn stets „der Wille zur Macht“ und das „Recht des Stärkeren“ – im Privaten ebenso wie in Politik und Gesellschaft, wobei er stets auch „die Gewaltsamkeit und Grausamkeit des Willens zur Macht“ betont (S. 90). Er sieht darin sogar ein Grundprinzip der Natur: „Leben selbst ist wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigner Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens, Ausbeutung – “ (S. 90 f.). Auch dieses Bekenntnis zur Gewalt-herrschaft wirkt zweifellos wie eine Vorwegnahme des Faschismus (s.o.)!
Nicht verwunderlich ist daher auch Nietzsches Ablehnung der marxistischen Kritik des Klassenkampfes, der im Kapitalismus auf der Ausgestaltung der Produktionsverhältnisse beruht. Diese interessieren jedoch Nietzsche überhaupt nicht. Stattdessen entwirft er eine fragwürdige Theorie der „Tauschökonomie“. Die ökonomischen Tauschverhältnisse hält er sogar für die „Grundlage aller menschlichen Zivilisation“ (S. 92). Das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer sei das älteste und ursprünglichste aller Personen-Verhältnisse. Der Mensch sei – auf Grund seines ständigen Wertens und Messens aller Dinge – das „abschätzende Thier an sich“ (ebd.), das dabei stets auch „Macht an Macht“ vergleiche. Aus marxistischer Perspektive: ein durch und durch bürgerlich-kapitalistisches Denken! Nietzsche sieht zwar, ähnlich wie Marx und Engels, den Ursprung der Geschichte in der Klassengesellschaft, hält aber deren Beseitigung nicht für den Beginn des (Marxschen) Reichs der Freiheit, sondern das „Ende“ der Geschichte „im negativen Sinne“ (S. 94).
Hauptgründe dafür, dass Nietzsche nicht fähig bzw. nicht bereit war, Kriterien für gesellschaftliche Normen, z.B. in Form einer Allgemeinen Gesetzgebung, zu entwickeln, sehe ich in seiner Haltung gegenüber Kants Ethik, die teilweise auf seiner Schopenhauer-Kritik beruht. Mein Kommentar hierzu: „Schopenhauer erlaubte sich die Eulenspiegelei, Kants ‚Ding an sich‘ wörtlich zu nehmen, d.h. es mit dem Willen gleichzusetzen, der sich sinnfällig an den Genitalien manifestiere Im Übrigen wertete Schopenhauer den Willen als „Welt-knoten“ schlechthin und zugleich als dessen Lösung, d.h. keineswegs nur als Erscheinung des (Unter-) Bewusstseins, sondern als allenthalben in der Natur, im Kosmos überhaupt, vorherrschend. Er fragt nicht, ob die außermenschliche Natur überhaupt etwas wollen kann. (Was will denn die Blume, was die Amöbe, was die Galaxie?) Nein, der Wille ist für ihn der nicht hinterfragbare Urgrund, gleichbedeutend mit Kants Ding an sich.
Genau hieran nimmt allerdings Nietzsche Anstoß, obwohl er den Willensbegriff seines Lehrmeisters ansonsten nahezu kritiklos übernimmt und immer weiter ausarbeitet. Nietzsches Haltung zu Kants Ding an sich ist uneinheitlich. Während er es in seinem Frühwerk noch als ein Verdienst Kants angesehen hatte, das Ding an sich als eine der Grundlagen der Moral anzunehmen, lehnt er es in seinem Spätwerk entschieden ab, hält es sogar für „widersinnig“.
Gründlich missverstanden hat er aber wohl den Kategorischen Imperativ. Er schreibt nämlich: „Wie? Du bewunderst den kategorischen Imperativ in dir? Diese „Festigkeit“ deines sogenannten moralischen Urteils? Diese „Unbedingtheit“ des Gefühls, „so wie ich, müssen hierin alle urteilen“? Bewundere vielmehr deine Selbstsucht darin! Und die Blindheit, Klein-lichkeit und Anspruchslosigkeit deiner Selbstsucht! Selbstsucht nämlich ist es, sein Urteil als Allgemeingesetz zu empfinden; ... Wer noch urteilt „so müsste in diesem Falle jeder handeln“, ist noch nicht fünf Schritt weit in der Selbsterkenntnis gegangen; ...“3 – Daran anschließend versucht der Autor, den Nachweis zu führen, dass Handlungen grundsätzlich „unerkennbar“ seien, und zwar schon infolge der je subjektiven Meinungen und Wertungen, von denen sie begleitet werden, so dass sie keinesfalls als Urteilskriterien zu verwenden seien.
Nietzsches Missverständnis: Kant habe gefordert, die je eigene, subjektive Maxime zum allgemeinen Gesetz zu erheben; womit er Kants Forderung jedoch ins Gegenteil verkehrt, um sie ad absurdum zu führen. Tatsächlich hatte Kant doch lediglich eine Überprüfung der subjektiven Maximen durch die Allgemeine Gesetzgebung gefordert! Dagegen will Nietzsche die Autonomie der Person nicht mehr an irgendeine gesellschaftliche bzw. staatliche Gesetzlichkeit binden, vielmehr sollen alle Menschen „die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden“ werden (in: Gerhardt a.a.O. S. 82), um sodann erst als „Physiker ... Schöpfer“ werden zu können, mit der Begründung: „Hoch die Physik! Und höher noch das, was uns zu ihr zwingt – unsere Redlichkeit.“ (ebd.) – Womit Nietzsche den Menschen nunmehr nach eigenem Gutdünken bindet, und zwar a) an die „Physik“ und b) an seinen eigenen Logos der „Redlichkeit“, mithin seine eigene Weltanschauung. Womit er aber zunächst wieder genau dort landet, wo Kant schon längst erfolgreich war: bei dem Versuch, Autonomie, Moralität und Gesetzlichkeit mit-einander in Einklang zu bringen. Dies mit dem gewichtigen Unterschied, dass Nietzsche dabei nachweislich gescheitert ist, während Kants Ethik zwar nicht vollständig Bestand hat, aber auch nicht als obsolet bezeichnet werden kann, zumal sie weiterhin die Diskussion über Grundfragen der Ethik beflügelt.4
2. Zu Heideggers Brief über den Humanismus
In diesem Brief aus dem Jahr 1947 verwendet Martin Heidegger (1889-1976) immer wieder den Begriff ‚Sein‘, d.h. auf fast jeder der 54 Seiten des Textes. Das ist bemerkenswert, zumal keineswegs klar ist, was der Autor unter dem Begriff Sein versteht. In Sein und Zeit (1927) hatte er das Sein strikt von allem Seienden getrennt und dennoch versucht, den Begriff Sein vom Dasein des Menschen her zu interpretieren, wobei er dieses Dasein auch als „In-der-Welt-sein“ bezeichnete. Auch dies jedoch ohne den wünschenswerten Klärungserfolg. Wozu Nicolai Hartmann im Jahre 1934 in seiner Grundlegung der Ontologie (also der Lehre vom Sein) erklärt, mit dem subjektivistischen Ansatz beim Dasein des Menschen sei Heidegger hinter die Objekt -Begriffe Kants und des Deutschen Idealismus zurückgefallen.5 Heidegger sei daher nicht in der Lage gewesen, den Objekt -Charakter des Seins zu würdigen, eines Seins, das bekanntlich sehr lange vor dem evolutionsgeschichtlichen Auftreten des Menschen existiert hat und diesem zu Grunde liegt. – Auch Ernst Bloch kritisiert – in Erbschaft dieser Zeit (1935, Frankfurt a.M. 1977, S. 306 ff.) – ausführlich Heideggers Seinsbegriff. Was Heidegger als „das Sein“ ausgebe, sei nichts anderes als die bürgerliche Subjektivität in ihrer verkorksten Innerlichkeit – mit dem Gegenpol des „Nichts“, in das speziell der Großbürger „hinaus gehalten“ sei. Das „Sein der Angst“ habe Heidegger selbst produziert und zu verallgemeinern versucht. Angst und Sorge seien aber eher Chiffren bürgerlicher Befindlichkeit.
Wohl auch als Reaktion auf diese und andere Kritiken verkündet Heidegger in den 1930er Jahren „die Kehre“, in der er das Sein anders, d.h. vor allem auf Grund dichterisch-fiktionaler Texte, zu ergründen sucht; allerdings erneut ohne Erfolg, wozu Walter Schulz bemerkt:
„Fragen wir nun, ob und wie die beim frühen Heidegger herausgestellten philoso-phischen Grundsätze beim späten Heidegger aufgenommen werden, so zeigt sich, daß sie weitergedacht werden in Richtung auf eine » Übermetaphysik «. Die Seinsfrage wird nicht mehr als ein auf das Subjekt und sein Selbstverständnis bezogenes Grundpro-blem angesehen. Das Sein ist zu einer nicht faßbaren Größe erhoben worden, die es in ihren Entscheidungen anzuerkennen gilt. Eine vom Menschen ausgehende Einstellung auf es ist nicht möglich. Das besagt: ebensowenig wie es eine philosophische Onto-logie geben kann, kann es eine metaphysische Seinslehre geben. Philosophie als be-gründendes Denken ist am Ende. “ (Schulz 1992, S. 229 f.,Hervorhebungen KR.)
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass Heidegger sich im ‚Brief über den Humanismus‘ unablässig auf „das Sein“ beruft, ohne den Bedeutungs-Inhalt des Begriffs zufriedenstellend beschreiben zu können. Einige Beispiele:
„Das Denken wird nicht erst dadurch zur Aktion, daß von ihm eine Wirkung ausgeht oder daß es angewendet wird. Das Denken handelt, indem es denkt. Dieses Handeln ist vermutlich das Einfachste und zugleich das Höchste, weile es den Bezug des Seins zum Menschen angeht. Alles Wirken aber beruht im Sein und geht auf das Seiende aus. Das Denken dagegen läßt sich vom Sein in den Anspruch nehmen, um die Wahrheit des Seins zu sagen. Das Denken vollbringt dieses Lassen.“ (Heidegger 1981 (1947), S. 5, Hervorhebungen KR)
Solches schreibt Heidegger auf der ersten Seite des Briefes, wobei er – scheinbar – plötzlich wieder Sein und Seiendes miteinander verbindet, und zwar in dem „Wirken“, das im Sein beruhe und „auf das Seiende aus“ gehe. Demgegenüber solle das Denken „sich vom Sein in den Anspruch nehmen, um die Wahrheit des Seins zu sagen“. (Ein ehrgeiziges Vorhaben, zumal dann, wenn der Seins-Begriff gar nicht geklärt ist!)
Nichtsdestoweniger redet Heidegger im Folgenden von der „Geschichte des Seins“, wobei dessen Sagen „rein im Element des Seins“ bleibe (S. 6 f.). (Also im Nirgendwo?) Immerhin solle das dem Sein angehörende Denken auf das Sein hören. Denn das Sein sei nicht nur „das Mögliche“ als das „Vermögend-Mögende“, sondern auch maßgebend für das Wesen des Menschen. Will sagen: Mit dem Unbestimmten des Seins will Heidegger das Wesen des Men-schen bestimmen! Im Originalton Heidegger:
„Soll aber der Mensch noch einmal in die Nähe des Seins finden, dann muß er zuvor lernen, im Namenlosen zu existieren. Der Mensch muß, bevor er spricht, erst vom Sein sich wieder ansprechen lassen auf die Gefahr, daß er unter diesem Anspruch wenig oder selten etwas zu sagen hat. Nur so wird dem Wort die Kostbarkeit seines Wesens, dem Menschen aber die Behausung für das Wohnen in der Wahrheit des Seins wiedergeschenkt.“ (S. 10 f.)
Und er scheut sich nicht, mit solchem Nicht-Sinn (bzw. Unsinn) den herkömmlichen Humanismus in Grund und Boden zu verdammen, wobei er dessen griechische und römische Vorgeschichte – und auch den klassischen Humanismus seit der Renaissance – mehr oder weniger kursorisch abhandelt. Den klassischen Humanismus lehnt er ab, weil dieser in Meta-physik erstarrt sei. Daher gelte es, den Humanismus neu zu begründen, und zwar aus der „Wahrheit des Seins“ bzw.:
„Die Wahrheit des Seins denken, heißt zugleich: die humanitas des homo humanus denken. Es gilt die Humanitas zu Diensten der Wahrheit des Seins, aber ohne den Humanismus im metaphysischen Sinne.“ (S. 43)
Auch hier kümmert den Autor nicht der Unsinn, der darin besteht, die „Wahrheit des Seins“ zu beschwören – und gegen den herkömmlichen Humanismus ins Feld zu führen! –, ohne zu wissen, wovon die Rede ist, weil er das dauernd beschworene Sein nicht erklären kann.
Ähnlich widersprüchlich äußert Heidegger sich zur Sprache und zur „Ek-sistenz des Men-schen“ als dessen eigentlicher, „wahrer“ Seinsform. Zur „Ek-sistenz“, d.h. zu der These, der Mensch sei das aus allem Seienden „herausgehobene“ Wesen (was Sartre in seinem Ver-harren bei der ‚existence‘ nicht erkannt habe), erklärt Heidegger:
„ der Mensch west so, daß er das »Da«, das heißt: die Lichtung des Seins, ist. Dieses »Sein« des Da, und nur dieses, hat den Grundzug der Ek-sistenz, das heißt des ekstatischen Innestehens in der Wahrheit des Seins. Das ekstatische Wesen des Men-schen beruht in der Ek-sistenz, die von der metaphysisch gedachten existentia ver-schieden bleibt.“ (S. 17)
Nunmehr soll also der Mensch in die „Lichtung des Seins“ eintreten können, und zwar auf Grund seines „ekstatischen Innestehens in der Wahrheit des Seins“. Plötzlich vermeint Heid-egger also – trotz des Scheiterns der Seins-Analyse als Daseins-Analyse in Sein und Zeit – das „Da“ des Menschen – auch aller Evidenz zum Trotz – mit der „Wahrheit des Seins“ ver-knüpfen zu können. Mehr noch:
„Gesetzt daß der Mensch inskünftig die Wahrheit des Seins zu denken vermag, dann denkt er es aus der Ek-sistenz. Ek-sistierend steht er im Geschick des Seins. Die Ek-si-stenz des Menschen ist als Ek-sistenz geschichtlich, nicht aber erst deshalb, oder gar nur deshalb, weil mit dem Menschen und den menschlichen Dingen mancherlei im Verlauf der Zeit geschieht. Weil es gilt, die Ek-sistenz des Da-seins zu denken, des-halb liegt dem Denken in »S. u. Z.« so wesentlich daran, daß die Geschichtlichkeit des Daseins erfahren wird.“ (S. 27)
Und Heidegger fügt hinzu, im „Da“ ereigne sich „die Lichtung als Wahrheit des Seins selbst“, nämlich als „Schickung des Seins“ und „Geschick der Lichtung“. (Erneut also in der apodikti-schen Setzung angeblich „wahrer“ Leerformeln ! Abgesehen davon, dass Heidegger hier offenbar verzweifelt versucht, den verfehlten Anspruch von ‚Sein und Zeit‘ zu erneuern.)
Zum Phänomen Sprache. Diese ist laut Sein und Zeit das „Haus des Seins“. Und auch an diesem Widersinn hält Heidegger im ‚Brief über den Humanismus‘ fest, indem er schreibt:
„Der Mensch muß, bevor er spricht, erst vom Sein sich wieder ansprechen lassen auf die Gefahr, daß er unter diesem Anspruch wenig oder selten etwas zu sagen hat,“ (s.o. S. 2)
Will sagen: Das Sein (die große Unbekannte!) ermöglicht erst die Sprache des Menschen, aber nicht vollumfänglich, denn vom Sein her habe der Mensch „wenig oder selten etwas zu sagen“. Und in solcher Kümmerlichkeit bestehe sogar die „Kostbarkeit“ des Mensch-Seins. Wobei das Sein selbst nunmehr als „Behausung“ des Menschen und seiner Sprache diene. Womit Heidegger schließlich das genaue Gegenteil dessen aussagt, was er in ‚Sein und Zeit‘ über die Sprache als „Haus des Seins“ behauptet hat. Und er bekräftigt diesen widersinnigen Standpunkt gegen Ende des ‚Briefes‘, wo er konstatiert:
„Das Sein kommt, sich lichtend, zur Sprache. Es ist stets unterwegs zur ihr. Dieses Ankommende bringt das ek-sistierende Denken seinerseits in seinem Sagen zur Spra-che. Diese wird so selbst in die Lichtung des Seins gehoben. Erst so ist die Sprache in jener geheimnisvollen und uns doch stets durchwaltenden Weise. Indem die also voll ins Wesen gebrachte Sprache geschichtlich ist, ist das Sein in das Andenken verwahrt. Die Ek-sistenz bewohnt denkend das Haus des Seins. In all dem ist es so, als sei durch das denkende Sagen gar nichts geschehen.“ (S. 52)
Womit Heidegger einräumt:
1. Die „Lichtung des Seins“ kommt zur Sprache.
2. Dabei kommt auch das „ek-sistierende Denken“ zur Sprache.
3. Sprache wird so der „Lichtung des Seins“ teilhaftig.
4. All dies, obwohl anscheinend durch dieses „denkende Sagen gar nichts geschehen“ ist.
Und warum dann das Ganze?, fragt man sich, verdutzt und bass erstaunt.
Einen Erklärungsversuch findet man in der Abhandlung ‚ Humanismus‘ von Hans G. Müsse, in der es am Ende des Kapitels zu „Martin Heideggers Humanismusbrief“ heißt:
„Das Sein selbst habe den Menschen „in die Wahrheit des Seins »geworfen«, daß er, dergestalt ek-sistierend, die Wahrheit des Seins hüte“ (Martin Heidegger: Über den Humanismus, 10. Aufl., 2000, S. 22). Heidegger bezeichnet den Menschen deshalb als Hirten des Seins. Das Denken vollbringe zugleich das Wesen des Menschen. Darum ruhe im Denken die Menschlichkeit. Das Denken des Seins ereigne sich noch vor der Unterscheidung von Theorie und Praxis. Es habe weder Ergebnis noch Wirkung. Es sei ein Tun, das alle Praxis übertreffe. Die Philosophie habe dagegen aus der Sprache ein Herrschaftsinstrument über das Seiende gemacht und das Denken damit falsch interpretiert. Das /animal rationale/ gebärde sich als Herr des Seienden und kreise heimatlos um sich selbst. Es sei ausgestoßen aus der Wahrheit des Seins.“6
Wobei Müsse leider den Umstand ignoriert, dass Heidegger gar nicht weiß, wovon er redet, wenn er „die Wahrheit des Seins“ beschwört. Tatsächlich ist Heideggers Argumentation – und insbesondere seine Kritik am Humanismus – im Ganzen hinfällig, weil er nicht in der Lage ist, seine Prämisse, das Sein, zu erklären. Dies auch dann nicht, wenn er behauptet, die Technik (die er auch als „das Ge-Stell“ bezeichnet) sei „mit dem Sein im Sinne des Willens zur Macht identisch“. Und auch nicht, wenn er das Graphem ‚Sein‘ mit einem dicken, querliegenden Kreuz durchstreicht7, wodurch sich das Sein tatsächlich als letztlich „un-fassbare Größe“ erweist, wie Walter Schulz es ausdrückt (s.o.).
Unverständlich bleibt ohnehin, warum ein Philosoph vom Format Heideggers den relativ einfachen, aber engen Zusammenhang von Sein und Seiendem leugnet (oder übersieht) und sich dadurch zu widersinnigen „Erklärungsversuchen“ (um nicht zu sagen: Phantastereien) verleiten lässt. Das Sein – ursprünglich eine Substantivierung des Verbs ‚sein‘ – offenbart sich doch u.a. immer dann, wenn man das Wort ‚sein‘ verwendet. Wenn ich z.B. frage: „Bist du traurig?“, impliziert diese Frage das Sein eines Du und eines Ichs. Sage ich: „Das ist ein Krückstock und kein Schlagstock“, weise ich auf das tatsächlich seiende Sein des Krück-stocks und des Schlagstocks hin. Oder wenn ich sage: „Wir sind hier vielleicht nicht im Recht“, setze ich sowohl unser eigenes seiendes Sein als auch das seiende Sein des Rechts voraus. Wir sind, das heißt: wir sind im Sein selbst. Sein können wir nur im Sein selbst. Und es gilt auch: „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“ (Ernst Bloch). Sein manifestiert sich u.a. im Werden, was schon Hegel in seiner Wissenschaft der Logik thematisierte. Insofern hat es die von Heidegger angeprangerte „Seinsvergessenheit“ nie gegeben. Nie wurde das Sein des Seienden geleugnet oder vergessen.
Es sind Wahrheiten, auf denen Wissenschaft und Philosophie nach wie vor aufbauen können; was auch Herbert Cysarz in seinem im Jahre 1948 erschienenen Buch ‚Das seiende Sein‘ gewürdigt und thematisiert hat. In dessen Vorwort schreibt er:
„Nur dieses größte Ganze, rätselhaft und täglich offenbar, darf das S e i n heißen: kein diesseitiges Sein im Sinn der pantheistischen Ästhetik oder der positivistischen Gleichsetzungen von Sein und Wirklichkeit; kein jenseitiges Sein wie viele Schola-stiker und Neuscholastiker es unterstellen, kein introvertiertes Sein wie die meisten Existenzialphilosophen es auslegen; sondern ein ebenso unermeßliches wie bestimm-tes, ebenso transzendierendes wie reelles Sein. Und nur das konkret ineinsgefaßte, je und je als ganzes sich verwirklichende nennen wir das s e i e n d e S e i n. Es ist nicht Realisation eines Begriffs, eines geistigen Vorentwurfs; es ist die Welt in der Wirk-lichkeit, das All in jeder schöpferisch erfüllten Gegenwart, es ist der durchgängigste Schaffensgang und -fug der Dinge. Gewißheit und Geheimnis ineins, will es gedacht und geschaut, geglaubt und erlebt und verkörpert sein.“ (a.a.O. S. XIII)
Was er damit meint, verdeutlicht Cysarz auf insgesamt 338 Seiten in fünf Kapiteln mit den Titeln: „I. Die Welt in den Wirklichkeiten II. Natur und Geschichte III. Menschliche Wesenheit IV. Gemeinschaft und Inswerksetzung V. Sein und Geist“. – Auch dies ist Heideggers Phantasmen entgegenzusetzen, neben den bekannten Seinslehren, zu denen sicherlich auch Hegels Wissenschaft der Logik und Nicolai Hartmanns Grundlegung der Ontologie gehören. Und last not least: Von allen zutreffenden Seinsbestimmungen – überprüf-bar durch die Korrespondenz-, Kohärenz- und Konsens-Theorien der Wahrheit und neuer-dings auch durch KI-Suchmaschinen – profitiert immer auch der Humanismus.
Offen bleibt die Frage, warum Heidegger mit solcher Akribie und Hartnäckigkeit immer wieder versucht, das Sein als solches bzw. das Sein an sich – und nicht etwa das seiende Sein – zu ergründen. Vermuten lässt sich, dass hierbei eine These von Karl Marx eine Rolle gespielt hat, nämlich die These, wonach das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme. Wenn dem so ist, bestünde ein erster Fehler Heideggers darin, in dem Marxschen Satz das Adjektiv ‚gesellschaftlich‘ zu ignorieren und das Sein zu verabsolutieren; wozu allenfalls dann ein Grund bestehen kann, wenn „das Sein“ tatsächlich jeglichem Bewusstseinsinhalt als bestimmende Größe und Substanz zu Grunde läge – wovon Heidegger überzeugt und faszi-niert ist. – Aber was heißt ‚bestimmen‘? Kant versteht darunter das synthetische Urteilen, das „reine oder empirische Anschauung“ erfordert. Erkenntnis ist für ihn „die Beziehung eines Bestimmbaren, zu Bestimmenden auf ein Bestimmendes, eine bestimmende Form des Denkens; das Bestimmende ist das Denken; bestimmen = bloße Form der Erkenntnis“. Marx deutet diese Auffassung materialistisch um. Auch das Denken und erst recht die „empirische Anschauung“ gibt es für ihn nicht ohne materielle, u.a. neuronale Grundlage – und nicht ohne die gesamten gesellschaftlichen Aktivitäten, einschließlich der Interdisziplinarität. Wenn nun aber, wie Marx lehrt, das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein „bestimmt“, bleiben Denken und Erkennen durchaus in ihren Funktionen des Bestimmens erhalten, zumal die Gesellschaft aus denkenden und erkennenden Individuen besteht, wenn auch mit speziellen körperlichen und geistig-seelischen Bedürfnissen. – Heidegger lässt dies anscheinend außer Acht, zumal er letztendlich auch das Denken dem Sein unterstellt, wobei er das Sein verabsolutiert, obwohl er es weder zu bestimmen noch zu erklären vermag.
3. Zu Michel Foucault (1926-1984)
Foucault erklärt seine Haltung zum Humanismus folgendermaßen:
„Ich verstehe unter Humanismus die Gesamtheit der Diskurse, in denen man dem abendländischen Menschen eingeredet hat: Auch wenn du die Macht nicht ausübst, kannst du sehr wohl souverän sein. [...] Je besser du dich der Macht unterwirfst, die über dich gesetzt ist, umso souveräner wirst du sein. Der Humanismus ist die Gesamtheit der Erfindungen, die um diese unterworfenen Souveränitäten herum auf-gebaut worden ist: die Seele (souverän gegenüber dem Leib, Gott unterworfen), das Gewissen (frei im Bereich des Urteils, der Ordnung der Wahrheit unterworfen), das Individuum (souveräner Inhaber seiner Rechte, den Gesetzen der Natur oder den Regeln der Gesellschaft unterworfen).“ (Michel Foucault: Von der Subversion des Wissens, 1974, S.114)
Hierzu kommentiert Hans G. Müsse:
„Für Foucault gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur relative Wahrheiten. Jede Form von metaphysischem Denken lehnt er ab. Humanismus ist für ihn nichts Anderes als eine Säkularisierung idealistischer Gedanken. Es gebe weder ein Wesen des Menschen noch objektive und universelle Menschenrechte. Es bestehe auch keine überhistorische Norm, die das Wesen des Menschen bestimmen könne. Der Versuch, eine solche Norm aufzustellen, führe zu einer Uniformierung des Menschen. Die moderne Anthropologie setze noch immer das Ideal eines „homo dialecticus“ voraus, der seine innere Wahrheit und seinen inneren Wert
erkennen könne. Aber nicht mehr der Mensch sei das Objekt der Wissenschaften, sondern vielmehr die nur äußeren Beziehungen und Vernetzungen von Elementen, die frei von jeder Vorstellung eines souveränen Subjekts und Bewusstseins seien. Der Organismus funktioniere.
Einen Zweck gebe es nicht. Alle Rechtfertigungsversuche durch Gott oder die Idee der Menschheit seien überflüssige Selbsttäuschungen und Fehlausbildungen der Kontrollmög-lichkeiten, die jedes Funktionssystem in sich trage. Es handele sich beim Humanismus um den trügerischen Versuch von Selbstrechtfertigungen, die davon ablenken sollen, dass es dem Menschen wie allen Lebewesen um das bloße Funktionieren ohne irgendwelche höheren Zwecke gehe. Den Gedanken des Humanismus, dass der Mensch sich selbst Zweck sein könne, weist Foucault ab.
/Tatsächlich hat die Menschheit keine Zwecke. Sie funktioniert, sie kontrolliert ihr Funktionieren und bringt ständig Rechtfertigungen für diese Kontrolle hervor. Wir müssen uns damit abfinden, dass es nur Rechtfertigungen (d.h. keine Wahrheiten) sind. Der Humanismus ist nur eine von ihnen, die letzte. //(Michel Foucault: Von der Subversion des Wissens, 1974, S. 30)./
Bei Sartre ist der Mensch zugleich Deuter und Programmierer des Sinns gewesen. Für Foucault ist Sinn nichts als eine Art Oberflächenwirkung, eine Spiegelung oder ein Schaum. Was uns im Tiefsten durchdringe, was vor uns da sei, was uns in der Zeit und im Raum halte, sei das System.
Nicht der Mensch dürfe an die Stelle Gottes gesetzt werden, sondern ein anonymes Denken, Erkenntnis ohne Subjekt, Theoretisches ohne Identität. Die noch von Sartre verfochtene Freiheit sei letztlich eine Illusion. Tatsächlich denke man innerhalb eines anonymen und zwingenden Gedankensystems einer bestimmten Sprache und Epoche. Mit dieser Erkenntnis werde die Idee vom Menschen in der Forschung und im Denken überflüssig. Sie sei nur ein Hindernis, die wahren Zusammenhänge zu erkennen. Das am meisten belastende Erbe, das uns aus dem 19. Jahrhundert zufalle, sei der Humanismus. Alle politischen Regime des Ostens oder des Westens brächten ihre schlechte Ware unter der Flagge des Humanismus durch.
All diese Herzensschreie, alle diese Ansprüche der menschlichen Person, der Existenz sind abstrakt: d.h. abgeschnitten von der wissenschaftlichen und technischen Welt, die nämlich unsere wirkliche Welt ist. Was mich gegen den Humanismus aufbringt, ist der Umstand, dass er nur noch der Wandschirm ist, hinter den sich reaktionärstes Denken flüchtet, hinter dem ungeheuerliche und undenkbare Bündnisse geschlossen werden: so will man beispielsweise Sartre und Teilhard verbinden. [...]
Der Versuch, der gegenwärtig von einigen unserer Generation unternommen wird, besteht daher nicht darin, sich für den Menschen gegen die Wissenschaft und gegen die Technik einzusetzen, sondern deutlich zu zeigen, dass unser Denken, unser Leben, unsere Seinsweise bis hin zu unserem alltäglichsten Verhalten Teil des gleichen Organisationsschemas sind und also von den gleichen Kategorien abhängen wie diewissenschaftliche und technische Welt. Es ist das „menschliche Herz“, das abstrakt ist. Wir aber bemühen uns, den Menschen mit seiner Wissenschaft, mit seinen Entdeckungen, mit seiner Welt, die konkret ist, zu verbinden.//(Michel Foucault, Interview in: La Quinzaine littéraire, Nr. 5 vom 15. Mai 1966)/“8
Kritische Würdigung
Um Foucaults Kritik am Humanismus einzuordnen und zu bewerten, weise ich zunächst darauf hin, dass Foucault in seinem Denken nachweislich nicht nur von Nietzsche, sondern auch von Heidegger stark beeinflusst worden ist. Hierzu schreibt Ulrich J. Schneider:
„Erst in seinem allerletzten Interview bekennt Foucault 1984, daß die Auseinander-setzung mit Heidegger sein eigenes philosophisches Denken angestoßen habe. Heidegger sei so wichtig für ihn, daß er nie über ihn geschrieben habe: »Heidegger ist für mich immer der wesentliche Philosoph gewesen. ( ... ) Mein ganzes philosophisches Werden ist durch meine Lektüre Heideggers bestimmt worden.« (RM: 140f.)“9
Unter diesen Aspekten fällt es weniger schwer, Foucaults Kritik am Humanismus zu bewerten. Hierzu greife ich im Folgenden eine Reihe wesentlicher Kernsätze von und zu Foucault heraus, in denen die Kritik erkennbar wird:
1. „Ich verstehe unter Humanismus die Gesamtheit der Diskurse, in denen man dem abendländischen Menschen eingeredet hat: Auch wenn du die Macht nicht ausübst, kannst du sehr wohl souverän sein. [...] Je besser du dich der Macht unterwirfst, die über dich gesetzt ist, umso souveräner wirst du sein.“ (Foucault s.o.)
Bei dieser Äußerung könnte man meinen, Nietzsche selbst reden zu hören, hatte dieser doch den „Willen zur Macht“ bzw. das Denken in Macht-Kategorien zur eigentlichen und wesens-gemäßen Triebfeder der menschlichen Natur und jeglichen Handelns erklärt. Im Übrigen trifft Foucaults Kritik nicht auf den in der Renaissance entstandenen Humanismus zu, wohl aber auf die Herrschaftsverhältnisse des Mittelalters, in dem der Mensch völlig dem angeblichen Willen Gottes unterworfen wird, eines Gottes, der u.a. als Garant des Gottesgnadentums gilt.
Erst im Humanismus der Renaissance vollzieht sich ein bedeutsamer Perspektiven-Wechsel: weg von der Top-down-Richtung Gott ˃ Mensch, hin zu der neuen Sicht Ich und Welt. Da hiervon bei Foucault nicht die Rede ist, wirkt seine Kritik unplausibel und unglaubwürdig.
2. „Für Foucault gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur relative Wahrheiten.“ (Müsse, s.o.)
Auch diese Auffassung findet sich schon bei Nietzsche, der damit allerdings vor allem den kirchlichen Anspruch auf absolute Wahrheit und die scholastische ‚adaequatio rei et intellec-tus‘ kritisiert, wonach die Wahrheit in der Übereinstimmung von „Sache und Verstand“ beste-he. Letzteres ist aber auch die Grundlage der modernen Korrespondenz-Theorie der Wahrheit, die man allerdings nicht mehr mit einem Anspruch auf absolute Gültigkeit verbindet. Auch dies haben Nietzsche und Foucault außer Acht gelassen: Es gibt anscheinend objektive, vor-läufig gültige Wahrheiten – zumal es mentale Objekte10 gibt.
3. „Humanismus ist für ihn nichts Anderes als eine Säkularisierung idealistischer Gedanken.“ (Müsse, s.o.)
Der im Renaissance-Humanismus vollzogene Perspektiven-Wechsel hin zu ‚Ich und Welt‘ (s.o.) ist originell und authentisch und sollte daher nicht mit einer Säkularisierung von Idealismus verwechselt werden. Außerdem erschöpft sich der Humanismus natürlich nicht in dem besagten Perspektiven-Wechsel.
4. „Es gebe weder ein Wesen des Menschen noch objektive und universelle Menschenrechte. Es bestehe auch keine überhistorische Norm, die das Wesen des Menschen bestimmen könne.“ (Müsse, s.o.)
Zweifellos gibt es weder ein einziges, uniformes „Wesen des Menschen“ noch eine einzige, absolut gültige, überhistorische Norm hierfür. Bestimmbar sind aber unterschiedliche We-senszüge von Menschen, so durch die Analyse spezieller Merkmale und Eigenschaften. Normen gibt es demgemäß im Plural, wenn auch nicht mehr als „kategorisch“, absolut gültige. „Objektive und universelle Menschenrechte“ sind vorhanden bzw. einzufordern, zumal der Mensch als Rechtsperson hierauf einen unabweisbaren Anspruch hat.
5. „Die moderne Anthropologie setze noch immer das Ideal eines „homo dialecticus“ voraus, der seine innere Wahrheit und seinen inneren Wert erkennen könne. Aber nicht mehr der Mensch sei das Objekt der Wissenschaften, sondern vielmehr die nur äußeren Beziehungen und Vernetzungen von Elementen, die frei von jeder Vorstellung eines souveränen Subjekts und Bewusstseins seien.“ (Müsse, s.o.)
Hierbei verkennt Foucault – ähnlich wie Heidegger – die Tatsache, dass im Menschen nach wie vor dialektische Beziehungen zwischen Subjekt und (mentalem) Objekt bestehen (was u.a. Schelling näher beschrieben hat). Zweifellos ist auch der Mensch – unter einzelnen und allgemeinen Aspekten – weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Aktivitäten, wissenschaft-licher und philosophischer Anthropologien. Auch zum Bewusstsein sind aufschlussreiche neue Theorien erschienen. (Vgl. meine eigenen Beiträge hierzu im GRIN-Verlag, München.) Inwiefern wir „souveräne“ Subjekte sind, ist allerdings kaum entscheidbar.
6. „Es handele sich beim Humanismus um den trügerischen Versuch von Selbstrecht-fertigungen, die davon ablenken sollen, dass es dem Menschen wie allen Lebewesen um das bloße Funktionieren ohne irgendwelche höheren Zwecke gehe.“ (Müsse, s.o.)
Träfe dies zu, wäre keinerlei Reflexion möglich, und zwar weder über Zwecke noch über alles andere. Fast jede konkrete Utopie fragt nach möglichen, höheren, neuen Zwecksetzungen. Ernst zu nehmende Humanisten argumentieren nicht selbstgefällig oder selbstgerecht, sondern selbstkritisch, wenn nötig.
7. „Bei Sartre ist der Mensch zugleich Deuter und Programmierer des Sinns gewesen. Für Foucault ist Sinn nichts als eine Art Oberflächenwirkung, eine Spiegelung oder ein Schaum. Was uns im Tiefsten durchdringe, was vor uns da sei, was uns in der Zeit und im Raum halte, sei das System.“ (Müsse, s.o.)
Sartre hat spätestens 1961 einen Übergang vom Existenzialismus zum Marxismus vollzogen, wobei er sich nicht scheute, indirekt sogar den Leninismus zu rechtfertigen. Sinnsuche schützt also nicht vor Irrtum. Trotzdem steht sie hoch über jeglicher bloßen „Oberflächenwirkung, Spiegelung oder Schaum“.11 Dagegen bietet auch der System-Gedanke keine sinnvolle Alternative. Denn ein System (die Zusammenstellung von Fakten, Faktoren usw.) ermöglicht immer nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Einen solchen Ausschnitt vollziehen kann aber offensichtlich nur der Mensch, so dass vor dem Menschen kaum irgendein System exi-stiert haben kann. Mensch erfinden Systeme, nicht die Systeme den Menschen. Nicht beweisbar ist auch die Behauptung, das System halte uns „in der Zeit und im Raum“. Umge-kehrt: Menschen erstellen Systeme in und für Raum und Zeit.
8. „ so will man beispielsweise Sartre und Teilhard verbinden.“ (Foucault, s.o.)
Die beiden Autoren zusammenbringen zu wollen, ist weniger abwegig als Foucault es an-nimmt. Denn immer wieder wurde versucht, Kommunismus und Christentum miteinander zu verbinden. Entwickelt wurde sowohl ein marxistischer als auch ein christlicher Humanismus. Teilweise Recht hat Foucault jedoch, weil es unmöglich ist, Marxismus und Christentum voll-ständig zu vereinigen, zumal Atheismus und Gottesglaube unvereinbar sind, auch wenn Ernst Bloch in ‚Atheismus im Christentum‘ (1968) anderes behauptet.12 Ähnliche Aporien sind zu erwarten, wenn man versucht, eine Synthese aus Sartre und Teilhard de Chardin herzustellen. Davon ist bei Foucault aber nicht die Rede. Die Mängel seines Anti-Humanismus bleiben evi-dent und relevant.
9. Gegen Foucault: (Willens-)Freiheit ist keine Illusion, Erkenntnis ohne Subjekt nicht denkbar. Gedankensysteme sind nicht anonym. Die Idee vom Menschen ist daher nicht überflüssig, politischer Missbrauch des Humanismus kein Argument gegen die tatsächlich durch den Humanismus erfolgenden Sinngebungen.
10. „Es ist das „menschliche Herz“, das abstrakt ist.“ (Foucault, s.o.)
Ebenfalls eine unbewiesene Behauptung. Natürlich sind menschliche Herzen konkret, nach-weislich dem Menschen zugehörig.
Alles in allem: Fast keines der von Foucault gegen den Humanismus vorgebrachten Argu-mente erweist sich als stichhaltig. Demgegenüber wird es im Folgenden darauf ankommen, das mit dem Humanismus geschichtlich tatsächlich Gemeinte wieder in Erinnerung zu rufen – um sodann den Humanismus mit dem Transhumanismus zu konfrontieren.
Eine „Kritik des Anti-Humanismus“ hat auch Julian Nida-Rümelin (2016) in seinen ‚Humanistischen Reflexionen‘ geleistet, und zwar in je einem Kapitel über Sophistik, Ökono-mismus, Kollektivismus, Naturalismus, Postmoderne und Fundamentalismus (S. 384-409). Sein Fazit:
„Humanisten versuchen in ihrer konkreten Praxis, die Menschheit als ganze zu achten und Respekt gegenüber jedermann, unabhängig von der religiösen oder weltanschau-lichen Gemeinschaft, der er sich zugehörig fühlt, zu zeigen. Humanisten verharren nicht in der polemischen Attitüde der Besonderheit, sie versuchen zu verstehen und die Kommunikation auch über große inhaltliche Differenzen hinweg aufrechtzuerhal-ten. Sie haben Respekt vor kultureller und religiöser Differenz und instrumentalisieren diese nicht zum geistigen Bürgerkrieg, der oft genug in den realen umschlägt. Funda-mentalismus und Humanismus sind unvereinbar.“ (a.a.O. S. 409)
B) Antike Vorläufer und Vorbilder des Humanismus
Eine der frühesten altgriechischen Verlautbarungen mit humanistischem Anspruch ist der ‚Homo-mensura-Satz‘ des Protagoras (ca. 490-411 v.Chr.). Er lautet: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind.“ Hierzu kommentiert Hans G. Müsse (a.a.O.):
„Protagoras hat den Homo-mensura-Satz selbst wohl primär erkenntnistheoretisch und nicht individuell ethisch gemeint, möglicherweise aber kollektivistisch ethisch in dem Sinne, dass die Menschen einer Polis gemeinsam entscheiden, was bei ihnen gelten soll. „Aller Dinge Maß ist der Mensch“ führt in der Konsequenz gleichwohl zu einem Relativismus in der Ethik (vgl. zur Entdeckung des Relativismus Thomas A. Szlezák, a.a.O., insbes. S. 169 f.).“
Und in einem Wikipedia-Artikel über Protagoras heißt es:
„Platon, bei dem der Satz überliefert ist, interpretiert: „Nicht wahr, er meint dies so: Wie ein jedes Ding mir erscheint, ein solches ist es auch mir, und wie es dir erscheint, ein solches ist es wiederum dir.“[...] Es wäre dann aber schwer, auch nur die Behauptung aufzustellen, dass es sich bei einem Wind um einen kalten handle, da er dem einen möglicherweise kalt erscheine, der andere ihn als warm wahrnehme. Und auch eine allgemein gültige Definition, was Gerechtigkeit sei, wäre schwer zu geben: „Wie einer jeden Stadt Gerechtes und Gutes scheint, so ist es für sie, solange sie davon überzeugt ist.“[...] Eine ganz andere Interpretation geht beispielsweise davon aus, dass der Mensch gemeint sei. Nicht die einzelne Person, sondern „der Mensch allgemein“ wäre dann das Maß aller Dinge. Die Dinge wären so, wie sie „dem Menschen“ erscheinen; eine Position, die an die Erkenntnistheorie Kants erinnert. [...] Eine wiederum andere Interpretation liefert der Nationalökonom Leopold Kohr. Demnach ist der einzelne Mensch das Maß aller Dinge, nicht die Nation, die Ethnie, die Partei, das Universum, die Zeit usw. Deshalb sollten alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Unternehmungen des Menschen dieses Maß „der einzelne Mensch“ im Auge behalten, da sie sonst in Maßlosigkeit ausufern würden.“
Außerdem kann man wohl die Frage stellen, ob der Satz sich überhaupt auch auf Personen beziehen kann, denn der Mensch ist ja kein „Ding“. Bezieht der Satz sich aber nur auf „alle Dinge“ – und nicht auf die Menschen –, lässt sich ein ethischer Anspruch zweifellos nicht aus ihm ableiten. – Und auch die erkenntnistheoretische Relevanz des Satzes halte ich für zweifel-haft. Das „Maß“ der Dinge liegt a priori in ihrer objektiven Beschaffenheit. Diese wird aber nicht unbedingt erst vom Menschen erzeugt, sondern existiert, jedenfalls bei den Naturdingen, unabhängig von ihm in den jeweiligen Merkmalen und Eigenschaften der Dinge, die aber weder bei natürlichen noch bei künstlichen Dingen rein subjektiv erforschbar sind, sondern in dialektischen Subjekt-Objekt-Bezügen. Dagegen ist der Ansatz des Protagoras sub- jektivistisch bzw. anthropozentrisch.
Vor allem der Spätzeit der altgriechischen Philosophie verdankt der Humanismus nichts-destoweniger eine Vielzahl wertvoller Impulse, so auch durch das hohe Bildungs-Ideal, die Paideia, die von den Römern mit ‚humanitas‘ („Menschlichkeit, Menschenfreundlichkeit,, echte Bildung, (feiner) Geschmack, Anstand“13) übersetzt wurde. Hierzu bemerkt Heidegger:
„In Rom begegnen wir dem ersten Humanismus. Er bleibt daher im Wesen eine spezifisch römische Erscheinung, die aus der Begegnung des Römertums mit der Bildung des späten Griechentums entspringt. Die sogenannte Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts in Italien ist eine renascentia romanitatis. Weil es auf die romanitas ankommt, geht es um die humanitas und deshalb um die griechische παιδεία. Das Griechentum wird aber stets in seiner späten Gestalt und diese selbst römisch gesehen.“14
Näheren Aufschluss hierüber vermittelt Julian Nida-Rümelin, der (2016) drei antike „Grund-bausteine humanistischen Denkens“ unterscheidet, und zwar „(1) Autarkie, (2) Rationalität, (3) Universalität “.15 Bei der Autarkie geht es zunächst um Selbstbeherrschung: „Wer nicht beherrscht werden will, muss sich selbst beherrschen.“ (S. 215) Nur unter dieser Voraus-setzung ist Autonomie möglich, die „Gestaltung des Lebens nach eigenen Vorstellungen und Wertungen“ (ebd.). Unter Rationalität verstehen die alten Griechen die stets philosophisch an-geleitete Erkenntnisfähigkeit des Menschen, die vorrangig im praktischen Leben erprobt und geübt werden müsse. Und zwar vor allem durch das vernünftige Urteil, das sich nicht an vor-gegebenen Autoritäten oder „Heiligen Schriften“, sondern vor allem an der Fähigkeit orien-tiert, zwischen guten und schlechten Argumenten zu unterscheiden. Universalität wird als philosophische Kategorie erst von den Stoikern entwickelt, die alles mit Gleichmut betrachten (und akzeptieren?). Jedenfalls gilt: Der Stoiker „nimmt die Dinge, die er selbst nicht verändern kann, mit Gleichmut hin und übernimmt Verantwortung für das, was seiner Kon-trolle untersteht“. (S. 217) Bei Cicero (106-43 v.Chr.) steht die ‚dignitas hominis‘, die Würde des Menschen, im Zentrum einer universalistischen Anthropologie.
Einen weiteren Überblick über antike Vorformen des Humanismus vermittelt Hans G. Müsse, indem er schreibt (a.a.O.):
„Der delphische Spruch gnothi seauton (erkenne dich selbst) bedeutete nicht nur: „Erkenne deine Nichtigkeit und denke daran, dass du ein Mensch und kein Gott bist“, sondern auch: „Erkenne deine wunderbare Anlage, deine hohe Bestimmung, deine Würde und deine Pflicht“ (Friedrich Klingner: Humanität und Humanitas, in: Römische Geisteswelt, 1979, S. 728 f.).
Apollon, der Gott von Delphi, war ein Gott der bewusstmachenden Wahrheit, des Maßes, der inneren Ordnung und der Reinheit. Er wies dem Menschen, den er als ein in der Zeit gebundenes und auf den Tod hin entworfenes Wesen ansprach und an seine Grenzen erinnerte, „den ihm zukommenden Ort [...] in der großen Ordnung von Himmel und Erde an“ (Wolfgang Schadewaldt: Der Gott von Delphi und die Humanitätsidee, 1975, S. 25). Nur der richtig orientierte, geordnete und gerechte Mensch ist zum wahren Dienst an der Gottheit fähig.
In der höfischen Kultur zur Zeit Homers wurde ein aristokratisches Menschenbild idealisiert. Die immer wieder auf Bewährungsproben gestellte Leistungskraft führt zu Besitz, Ruhm und Ehre. Der homerische Held vermag die Lanze zu führen. Ebenso ist er zur sachkundigen Rede im Rat und in der Versammlung fähig (Homer, Ilias 9, 442). Er beherrscht wie Achilleus das Lyraspiel. Ritterlichkeit, Höflichkeit, weltmännische Gewandtheit und Einfühlungsvermögen zeichnen ihn aus. In der Zeit der Polis wurden dann ab dem 7. Jahrhundert eher die staatstragenden Tugenden betont. Gehorsam gegenüber den Gesetzen und die Hingabe des Lebens für die Polis dienten als Leit-bilder der Unterordnung unter das Ganze.
Humanitas: der römische Humanismus
Die altrömische Erziehung war ganz auf die Bedürfnisse des /pater familias/ als eines aktiven Mitglieds des römischen Gemeinwesens (civitas) ausgerichtet. Die Praxis (usus) lehrte, was erforderlich war. Buchwissen spielte eine untergeordnete Rolle für die Bildung. Umfang und Inhalt bestimmten sich nach dem Nutzen (utilitas). Der griechische Ursprung der geistigen Humanitas (paideia) lässt sich auf den Kreis um Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus, den jüngeren Scipio, zurückführen. Zum Scipionenkreis gehörten zahlreiche politisch und kulturell bedeutende Persön-lichkeiten. Er beschäftigte sich mit griechischer Literatur und Philosophie. Durch ihn wurde die griechische Bildung mit ihrem spezifischen Bildungsideal in Rom eingebürgert (François Renaud: Humanitas, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 4, 1998, Sp. 81).
Ciceros Ideal des Redners zeichnet sich durch eine hohe Allgemeinbildung und gute Kenntnisse in Geschichte, Philosophie und Recht aus (Cicero, De oratore 1, 46–48; 147–262; 3, 56–90). Maßgeblich von Cicero wurde der Begriff /humanitas/ geprägt, der erstmals in einer anonymen Schrift um 80 v. Chr. mit dem Titel „Rhetorica ad Herennium“ belegt ist. Cicero, bei dem der Begriff in zahlreichen Werken begegnet, knüpft mit ihm an die griechische Paideia an. Humanität ist dem Menschen nicht angeboren, erst durch die Erziehung in den Künsten (artes) wird die Jugend zur huma- nitas geformt und gebildet (Cicero, Rede für Archias 4b: „[...] ab iis artibus, quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet [von den Künsten, durch welche man im Knabenalter gewöhnlich zur humanitas geformt wird]“). Was macht den Menschen zum Menschen und unterscheidet ihn vom Tier? Für Cicero bilden Vernunft und Sprache (/ratio et oratio/) das Fundament der menschlichen Gemeinschaft. Durch sie werden die Menschen miteinander verbunden. Aus Vernunft und Sprache erwächst die menschliche Würde. Würdig ist ein Verhalten, wenn es von der Vernunft gelenkt ist.
Humanität bezeichnet das im Menschen, was ihn eigentlich zum Menschen macht. Bildung als identitätsstiftende Kulturleistung (/paideia/) und Menschenfreundlichkeit (/philanthropia/) vermischen sich in dem Begriff humanitas im Sinne des wahren Menschseins. Die Liebe und Sorgfalt für die geistige Bildung und Veredelung seines Selbst ist unter allen lebenden Wesen nur dem Menschen verliehen (Aulus Gellius, Noctes Atticae XIII, 17). Der Mensch ist etwas Großes und Bejahenswertes. Zur humanitas gehören neben Gerechtigkeit und einer sittigenden Kraft auch liebenswertes Miteinander, Muße, Freude an einer gepflegten Sprache sowie vor allem eine schwerelose und verbindende Geistigkeit (Karl Büchner: Humanitas, in: Der Kleine Pauly, Bd. 2, 1967, S. 1244). Humanus steht im Tonfall und in der Bedeutung dem Wort /urbanus/ nahe. Es bezeichnet keine ernste Besinnung, sondern heitere Selbst-sicherheit. Es geht um das geistreiche, feine, witzige und höfliche Wesen des Stadt-römers (Friedrich Klingner: Humanität und Humanitas, in: Römische Geisteswelt, 1979, S. 719 f.). Es verbinden sich tiefer, unverkrampfter Ernst und anmutiges Scherzen. Die eigenen Wahrheiten werden leicht und elegant hingeworfen, man spottet milde über die eigene Rolle. Es geht um die Freude an einer gelungenen Erkenntnis und um die Freude an einer geistigen Tätigkeit, die ohne Zweck und Nutzen betrieben wird (Friedrich Klingner, a.a.O., S. 722). Der rücksichtslose Mensch, der sich für andere Menschen nicht interessiert, ist nicht human. Arroganz, Dickköp-figkeit, hinterwäldlerische Plumpheit und Brutalität sind mit humanitas unvereinbar. Sie ist dann in Gefahr, wenn der Mensch sich in der Äußerlichkeit verliert oder durch Gewöhnung an das Schlimme abstumpft.“
Zu den Menschenbildern einzelner Philosophen
Heraklit (ca. 520-460 v.Ch.)
Man nannte ihn auch „den Dunklen“. Als seine bekanntesten Aussprüche gelten wohl:
„Im Anfang war der Logos.“ – „Alles fließt.“ – „Man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss.“ – „Der Krieg (‚polemos‘) ist der Vater aller Dinge.“
Zum Logos, mit Bedeutungen wie ‚Wort, Rede, Sprache, Vernunft, Grund, Sinn, Gesetz‘, (dazu heute auch ‚logo‘ (‚logisch‘) und ‚Logo‘, das Firmen-Kennzeichen). Da der Kosmos nach alt-griechischer Auffassung wohl geordnet ist, stellt sich die Frage nach dem Ursprung dieser Ordnung. Dazu heißt es in einem Internet-Artikel:
„Der Logos ist in der Darstellung bei Herakleitos teils Weltprinzip in Form eines vernunftbegabten, feuerähnlichen (bzw. wie ein Glutwind/Äther), unveränderlich mit sich identischen Urstoffes, teils mächtiges allgemeines Weltgesetz, teils alles durchwaltende Weltvernunft bzw. Weltseele.
Der Logos ist sowohl eine Naturgegebenheit als auch ein universales, allgemein gültiges Gesetz.“16
„Alles fließt.“ Das bedeutet wohl auch, dass alles in Bewegung ist, nachgewiesen u.a. in der E-Teilchen-Physik, und zwar auch in der Form der Heisenbergschen Unschärferelation; die E-Teilchen bewegen sich ständig, und zwar wellenförmig, aber nicht genau lokalisierbar. Ist daher alles in Bewegung, auch im Meso- und Makro-Kosmos? Wenn ja, dann wohl in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Aggregatszuständen.
„Man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss.“ Nichts und niemand zwingen uns, in einen Fluss zu steigen. Aber wir wissen: Da anscheinend alles im „Fluss“, d.h. in Bewegung und folglich in Veränderung existiert, können wir uns dem Strom der Veränderungen nicht ent-ziehen.
„Der Krieg (‚polemos‘) ist der Vater aller Dinge.“ ‚Polemos‘ bedeutet aber auch ‚Kampf‘ und ‚Streit‘. Diese begegnen uns in vielfältiger Form. Als Konflikte zwischen Gut und Böse, einzelnen Individuen, Weltanschauungen, Ideologien, Gruppen, Schichten und Klassen der Gesellschaft und schließlich zwischen Völkern, Nationen und Staaten. – Wohl zu Recht gilt Heraklit als einer der Urväter der Dialektik.
Hinzufügen kann man Heraklits Ausspruch: „Mehr als sichtbare gilt unsichtbare Harmonie.“ Dazu heißt es in dem bereits zitierten Internet-Artikel:
„Was die Menschen direkt durch Sinneswahrnehmung erfassen können, ist nur ein Teil der Dinge und bleibt an der Oberfläche. Es gibt wesentliche Zusammenhänge, die eine nicht durch die Sinne wahnehmbare Harmonie bilden und machtvoller sind. Es handelt sich um in der Natur wirkende Kräfte, der Welt zugrundeliegende Strukturen und Gesetzmäßigkeiten. Zusammengenommen nennt Herakleitos dies Logos (). Der Logos lenkt nach seiner Auffassung die Welt. Dies ist eine machtvolle Herrschaft und selbstverständlich eine stärkere Harmonie als sichtbare Harmonie.“ (a.a.O., s. Fußnote Nr. 16!)
Zu seinen Gottesvorstellungen sagt Heraklit in einer Klage über seine Zeitgenossen und -ge- nossinnen:
„Mit dem sie am meisten ununterbrochen verkehren, dem Logos, der das All verwal-tet, von dem sondern sie sich ab, und was ihnen jeden Tag begegnet, kommt ihnen fremd vor.“ Und: „Für dies Wort aber, ob es gleich ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie es vernommen noch sobald sie es vernommen. Alles geschieht nach diesem Wort, und doch gebärden sie sich wie Unerprobte, so oft sie es probieren mit solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach sei-
ner Natur zerlegend und deutend, wie sich's damit verhält. Die anderen Menschen wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe [tun].“
Hierzu bemerkt Pranava Heinz Pauly
"Gott ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Überfluss und Mangel. [...] Tag und Nacht sind ihrem Wesen nach eins. Der Weg nach oben und der Weg nach unten ist ein und derselbe." Gott ist der Logos: "Einmal kamen Besucher zu Heraklit und waren überrascht, ihn am Herdfeuer zu finden, wo er sich wärmte. Er sagte zu ihnen: Auch hier sind die Götter zu Hause. Ich habe mich selbst durchforscht. Die Zeit ist ein Kind, das in einem Brettspiel Steine hin und her schiebt: Königliche Macht eines Kindes! Fanatismus ist die heilige Seuche!"
In diesen Zitaten von Heraklit wird klar, dass Gott überall ist. Gott ist keine Person. Gott ist alles, was ist. Alles ist göttlich, alles ist heilig. In dieser Aussage bezieht sich Heraklit auf die sogenannte "heilige Seuche". Er bezieht sich hier auf Menschen, die die Wahrheit nicht erkannt haben: Jemand, der die Wahrheit erkannt hat, ist nämlich nie fanatisch, nie von einer Ideologie besessen. Wer die Wahrheit kennt, weiß auch, dass die Wahrheit viele Gesichter hat und dass jeder sie auf seine Weise sieht.
Wenn jemand behauptet, seine Wahrheit sei die einzig wahre Wahrheit, ist das laut Heraklit die heilige Seuche. Wahrheit braucht nicht aufzutrumpfen, sie ist einfach da. Ohne etwas zu fordern, ohne zu bekehren.“17
Demokrit (ca. 460-370 v.Chr.)
gilt neben seinem Lehrer Leukipp als Begründer der Lehre von den Atomen als den kleinsten, unteilbaren Teilchen der Materie. In dem Wikipedia-Artikel ‚Demokrit‘ heißt es:
„Schon seine Zeitgenossen nannten Demokrit den „lachenden“ Philosophen, vielleicht weil seine Heimatstadt Abdera in Griechenland den Ruf einer Schildbürgerstadt hatte. Vor allem aber zielte er mit seiner Lehre darauf ab, dass die Seele durch die Betrachtung des Wesens der Dinge eine heitere, gelassene Stimmung erlange und nicht länger von Furcht oder Hoffnung umgetrieben werde. Diese gleichmütige Gestimmtheit nannte er Euthymia (wörtlich: Wohlgemutheit) und bezeichnete sie als höchstes Gut.
Auch die Seele ist ein Atomenaggregat, ein Körper, aber ein solcher, dessen Bestandteile die vollkommensten, das heißt feinsten, glattesten und kugelförmigsten Atome sind, welche der Erscheinung des Feurigen entsprechen. Teile derselben werden, solange das Leben währt, durch Ausatmen an die Luft abgegeben und durch das Einatmen derselben als Ersatz wieder aufgenommen. Ebenso lösen sich von den uns umgebenden Dingen unaufhörlich feine Ausflüsse, die durch die Öffnungen unseres Leibes (die Sinnesorgane) an die in seinem Innern befindliche Seele gelangen und dort durch Eindruck ihnen ähnliche Bilder erzeugen, welches die Sinneswahrnehmungen sind. Letztere bilden die einzige, aber, da jene Ausflüsse auf dem Weg zur Seele mehr oder weniger störende Umbildungen erfahren können, nicht absolut zuverlässige und objektive Quelle unserer Erkenntnis, die sich daher nicht über die Stufe der Wahrscheinlichkeit erhebt.
Zu der Seele, die von Natur aus die Erkenntnis möglich macht, verhält sich der übrige Mensch (sein Leib) nur wie ein „Zelt“; wer die Gaben der ersteren liebt, liebt das Göttliche, wer die des Leibes liebt, das Menschliche. Erkenntnis aber gewährt Einsicht in das Ansich der Dinge, d. h. die Atome und das Leere, und in die gesetzliche Notwendigkeit des Verlaufs der Dinge, die weder einer Leitung durch außenstehende Mächte bedürftig noch einer Störung durch solche zugänglich ist. Während alle Unterschiede für uns nur Einsicht in die sinnlichen Erscheinungen sind, befreit die Erkenntnis von törichter Furcht wie von eitler Hoffnung und bewirkt jene Gelassenheit (Ataraxie), die das höchste Gut und zugleich die wahre Glückseligkeit ist.“
Platon (427-347 v.Chr.)
„Platon geht davon aus, dass das höchste Ziel eines Menschen der Wunsch ist, glücklich zu werden. Dieses Ziel lässt sich, seiner Ansicht nach, nur dann erreichen, wenn jeder das tut, was er am besten kann.
Gemeint ist damit, dass der Mensch das tun muss, worauf sein Wesen ausgelegt ist. Dabei unterscheidet er den Menschen an drei Charakteren, die seine Seele auszeichnen können: die Begierde, den Mut und die Vernunft.
Parallel dazu sieht er die Gesellschaft als eine, die aus Ernährern, Kriegern und Herrschern besteht. Eine gerechte Gesellschaft entsteht dann, wenn jeder das tut, was seiner Seele bzw. seinem Wesen entspricht.
Dieses Menschenbild dehnt Platon auf die ganze Gesellschaft aus, was ihn zu der Schlussfolgerung bringt, dass eine Gemeinschaft nur bestehen kann, wenn sie die Gerechtigkeit fördert und die Unterschiede in den Fähigkeiten ihrer Mitglieder bestehen lässt.
In diesem Zusammenhang kommt er auch zu der Folgerung, dass die Philosophen die Herrschaft über eine Gemeinschaft übernehmen müssten, weil sie am vernünftigsten und weisesten sind.
Seine Vorstellungen von einer Regierung beruhen deshalb auch nicht auf einem demokratischen System, da er in der Gleichheit aller auch eine Gleichmachung sieht und es seinen Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft zuwiderläuft.
Sein Menschenbild lässt sich zusammenfassend als eines beschreiben, dass auf einer natürlichen Ungleichheit der Menschen beruht, die allerdings dann zu einem harmonischen Zusammenleben führen soll, wenn sich alle in ihrem Tun verwirklichen können.“18
Den Ursprung der Begriffe verlagert Platon in den „Ideen-Himmel“. Dazu heißt es in einem ‚Philosophischen Wörterbuch‘: „In unseren Begriffen vollzieht sich die Erkenntnis einer übersinnlichen Welt. Die Begriffe sind Abbilder der Ideen. In der Vielheit der Begriffe spie-gelt sich die der Ideen. Die Teilhabe der Seele an den Ideen durch Begriffe beweist nach P. zugleich die Unsterblichkeit der Seele. Die Begriffsbildung in der menschlichen Seele ist ein Akt der Erinnerung an die Ideen selbst, die die Seele schaute, bevor sie an den Leib gebunden wurde. Höchste Idee ist die der „Schöngutheit“ (› Kalokagathie), oft auch von P. als Gott auf-gefaßt, der als Weltbildner (Demiurg) zunächst die Weltseele als eine unkörperliche, bewe-gende Kraft formte.“ (In: Schmidt/Schischkoff: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 1961)
Aristoteles (ca. 384-322 v.Chr.)
„Aristoteles‘ Menschenbild baut darauf auf, dass der Mensch handelt, um glücklich zu werden. Das Menschenbild stellt das Streben nach Glück in den Mittelpunkt.
Nach Aristoteles versucht jeder Mensch ein „gutes Leben“ zu erhalten und er richtet seine Handlungen auf dieses Ziel. Sogar die Tugenden dienen der Erreichung dieses Ziels.“19
Demgemäß bezieht Aristoteles den Begriff Teleologie, die Ziel- und Zweckgerichtetheit, sowohl auf das Sein als auch auf das Erkennen der gesamten Wirklichkeit. Aus der Teleologie allein kann jedoch nicht auf Wert und Sinn der objektiven und subjektiven Gegenstandswelt geschlossen werden. Handeln kann verweigert werden. Handeln nur um des Handelns willen (wie in einigen Formen von Aktionismus und Voluntarismus) macht wenig oder gar keinen Sinn. Das wusste schon Aristoteles, der sich veranlasst sah, eine Theorie des Wertvollen und des Guten zu entwickeln. Wobei sogleich anzumerken ist, dass Aristoteles die Begriffe ‚Wert‘ und ‚Gut‘ als nahezu gleichbedeutend verwendet (was auch an unterschiedlichen Über-setzungen ins Deutsche, z.B. der Nikomachischen Ethik, zu erkennen ist).
Unmittelbar verständlich wird dabei die Tatsache, dass Aristoteles seine Wertlehre vollständig in seine Ethik integriert hat. Aufschlussreich scheint mir darüber hinaus die Vielzahl unter-schiedlicher Themen, die der Autor in seiner ‚Nikomachischen Ethik‘ behandelt. Da geht es um Demokratie, Gesetz, Staatslehre und Verfassung, aber auch um Kunst, Mut, Gerechtig-keit, Denken, Freundlichkeit und Ehre, letztlich also anscheinend um die gesamte Bandbreite philosophischer Themen und Disziplinen.
Umso mehr interessieren die Differenzierungen des Wert-Begriffs, die Aristoteles vornimmt. Herausfinden will er die „Mittel und Wege zum guten und glücklichen Leben“, und zwar a) auf Grund von Analysen tatsächlicher Lebensweisen seiner Zeitgenossen und b) auf Grund seiner Seelen-Lehre. Daraus erschließt sich eine dreifache Fundierung der Wertlehre, nämlich in der Lebenspraxis, in der Psychologie und in der Ethik bzw. der Philosophie im Ganzen.
„Höhere“ Werte soll der edle Mensch aus eigenem Antrieb, also aus einem Selbstzweck heraus und um ihrer selbst willen, anstreben. Von solchem Streben sagt Aristoteles, es sei „wertvoll und genußreich zugleich“.20 Er warnt also nicht etwa vor jeglichem Genießen, sondern nur vor dem Genuss aus unedlen Motiven, vor dem Genuss um des Genusses willen. Wahres Glück sei nur in einem tugendhaften Leben zu finden, woraus zu schließen sei: „Daher nennen wir billigerweise weder einen Ochsen noch ein Pferd noch sonst ein Tier glückselig. Denn kein Tier ist des Anteils an einer solchen Tätigkeit fähig. Und aus demselben Grunde ist auch kein Kind glückselig, weil es wegen seines Alters noch nicht in der gedachten Weise tätig sein kann, und wenn Kinder hin und wieder doch so genannt werden, so geschieht es in der Hoffnung, daß sie es erst werden. Denn zur Glückseligkeit gehört wie gesagt vollendete Tugend und ein volles Leben. “ (ebd. S. 17, Hervorhebung durch mich). Eine Garantie für dauerhaftes Glück könne es dennoch nicht geben, da Menschen immer wieder, d.h. auch im Alter, schlimmes Leid widerfahren könne.
Was aber meint Aristoteles mit dem „vollen Leben“? (Das ja kein karges, kümmerliches Leben sein kann.) Wir erfahren es erst fast am Ende der ‚Nikomachischen Ethik‘. Tugendhaftes, glückseliges Leben kann nicht in unernstem, leichtfertigem Larifari bestehen, im Gegenteil, es ist „ein Leben ernster Arbeit, nicht lustigen Spiels “, denn: „Das Ernste nennen wir ja besser als das Scherz-hafte und Lustige, und die Tätigkeit des besseren Teiles und Menschen nennen wir immer auch ernster.“ (ebd. S. 248). Tugend und Glück vertragen sich also nicht mit prinzipiellem Unernst, im Gegenteil: ohne gewissenhafte Arbeit, Ernsthaftigkeit, Verbindlichkeit und edle Gesinnung sind sie nicht zu erreichen.
Erst unter solchen Voraussetzungen macht es Sinn, über oberste Glückswerte nachzudenken. Diese findet Aristoteles im Denken selbst, das den Menschen zu stärkster Verinnerlichung, d.h. Konzentration auf seinen Wesenskern und Selbstzweck, befähigt und letztlich in metaphysische und religiöse, wenn nicht mystische Dimensionen führt.21
Bei Schmidt/Schischkoff heißt es zu Aristoteles: „Die Seele des Menschen reicht in seine pflanzenhaften und seine tierhaften Grundlagen hinein als „erste Entelechie des Lebens“; von ihnen frei ist der Intellekt, der passiv ist als Behältnis der Ideen, aktiv und zugleich unsterblich als forschendes Denken. Dieses „theoretische Leben“ ist zugleich auch, wie des A. Ethik lehrt, der Sitz der höchsten, der theoretischen (dianoëtischen) Tugenden und der wahren Glückseligkeit. Die praktischen Tugenden sind dagegen der Herrschaft der Vernunft nicht restlos unterworfen; hier gilt deshalb die Regel: vermeide die Extreme und halte die Mitte ein (> Tugend). In seiner Politik geht A. vom Menschen als „Zoon politicon“ (Lebewesen, das in Gemeinschaft mit anderen existiert) aus, der in den Lebenskreisen: Familie, Gemeinde, Staat lebt.“22
Epikur (ca. 342-271 v.Chr.)
fordert, jedermann, gleich ob jung oder alt, solle sich der Philosophie zuwenden.23 Nicht der grenzenlose Lebensgenuss – wie viele polemisch behaupten – ist für Epikur philosophisch zu rechtfertigen, sondern klare Überlegung über „die Grenzen der Freude“. Daher ist genau zwischen natürlichen, notwendigen und schädlichen Begierden zu unterscheiden; letztere sind gänzlich zu unterdrücken, die „natürlichen“, insofern sie schaden können. Der Mensch soll sich zur Natur also durchaus kritisch und reflektierend verhalten; Ausrichtung auf die Ziele der Natur bedingt vernunftgemäßen Einklang von Denken und Handeln. Dadurch ist auch souveräne Haltung dem Tod gegenüber zu gewinnen: „So ist also der Tod, das schauervollste Übel, für uns ein Nichts; wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr.“24 Mit der Furcht vor dem Tode verschwindet die Furcht vor dem Leben; der Weise stellt sich dem Leben, da er weiß, dass er seine Zukunft großenteils selbst bestimmen kann. Er wird sich bemühen, nicht unbedingt ein möglich langes, sondern ein möglichst angenehmes Leben zu führen. Angst vor übermächtigen Göttern, wie sie zu Epikurs Zeiten noch weit verbreitet ist, würde nur die Freude am Leben beeinträchtigen. Epikur bekämpft daher die traditionelle Gottesvorstellung. Dies ist zwar noch kein Atheismus, aber der Weg dorthin ist vorgezeichnet; Eingreifen in die Freiheit des Individuums wird den Göttern nicht mehr zugebilligt.
Lukrez (ca. 99-54 v.Chr.)
Der römische Philosoph entwickelt die Gedanken Epikurs konsequent weiter. Epikur ist für ihn der erste, der die Menschen von der „schmählichen“ Bevormundung durch die Religion befreit hat. Durch die Kraft des Geistes sei es dem Griechen gelungen, „die Natur aus dem Kerker zu lösen“.25 Naturansicht und -erkenntnis sollen die Ängste und Täuschungen der Seele beseitigen. Seele und Geist sind durch die gemeinsame materielle Grundlage eng ver-bunden. Sie sind daher sterblich wie der Leib des Menschen. – Da das Leben einmalig und unwiederholbar ist, soll man am Ende aus ihm scheiden, „wie ein satter Gast von der Mahl-zeit“ aufsteht. Es gilt, die Gesetze der Natur anzuerkennen, die sich immer wieder aus sich selbst erneuert.
Lukrez wendet sich gegen jede Art von Verblendung. Im IV. Buch von ‚ De natura rerum‘ be-schäftigt er sich ausführlich mit der Blindheit, die bei Liebenden häufig anzutreffen ist. Er kri-tisiert heftig die Neigung von Liebhabern, über sämtliche negativen Eigenschaften der Ange-beteten hinwegzusehen und offensichtliche Mängel in Vorzüge zu verwandeln:
„Denn so machen es wohl die Menschen, die blind vor Begierde,
Bilden sich Eigenschaften auch da, wo niemand sie sieht.“26
Sonderfälle stellen die Sophistik, die Stoa und der Skeptizismus dar. Es sind Weltanschau-ungen und Geisteshaltungen, die sowohl in der griechischen als auch in der römischen Antike in Erscheinung getreten sind.
Über die Sophisten ist im ‚Wörterbuch der philosophischen Begriffe‘ (Darmstadt 1998) Fol-gendes zu erfahren:
„Sophisten, gr. Sophistai >Weisheitslehrer<; ursprünglich alle die Wissenschaft Pfle-genden und nach Weisheit Strebenden, im 5. Jh. die in Athen auftretenden und dorthin zugewanderten Lehrer, die den Unterricht in den Wissenschaften und der Philosophie, besonders die Ausbildung der Jugend zu Rednern betrieben. In der zeitgenössischen Kritik wurde ihnen vorgeworfen, daß sie aus ihrer Tätigkeit ein Gewerbe, aus der Aus-bildung zur Beredsamkeit eine formale Überredungskunst machen. Durch die Verspot-tung des Aristophanes und den Kampf, den Sokrates und Plato gegen sie führten, erhielt das Wort S. die abwertende Bedeutung von Scheingelehrten und Wort-künstlern.“
Zur Stoa (zu der auch Cicero gehört, s.o.):
Im Unterschied zu Epikur suchen die Stoiker Sinn und Ziel des Daseins nicht in der Freude, sondern im Seelenfrieden, der ‚ataraxia‘, d.h. in der Harmonie des Menschen mit sich, mit der Gesellschaft und der Natur. Zu diesem Zweck entwickeln sie ein bestimmtes Menschenbild und eine bestimmte Sicht der Natur. Letztere gilt den Stoikern als durchweg kausal und final-ursächlich (entelechetisch) determiniert, so dass sie die Dinge der Außenwelt (die äußeren Güter) für nicht verfügbar halten.27 Entscheidend werden dann nicht die Dinge selbst, sondern deren Bewertung. Diese aber muss ethisch fundiert sein, d.h. sie muss auf Grund sittlich ein-wandfreier Überlegung und Einsicht erfolgen; die ethischen Grundlagen bzw. Grundsätze des Verhaltens müssen korrekt, verantwortbar sein.
Die größte Gefahr für den Seelenfrieden sieht der Stoiker daher in falscher Bewertung, in sittenwidrigem Werten. Zum Schutz davor unterscheidet er zunächst strikt zwischen guten, schlechten und gleichgültigen Dingen. Grob vereinfacht: Gut sind alle Tugenden, schlecht alle Untugenden; gleichgültig ist alles andere, so dass auch der bewusste Verzicht, die gewollte Bedürfnislosigkeit und die Leidenschaftslosigkeit („Apathie“) einen Wert bekommen. Nur wer dies beachtet, kann hoffen, Glück und Seelenfrieden zu finden, wobei es entscheidend darauf ankommt, die oberste Tugend, die sittliche Einsicht, walten zulassen, aus der alle anderen Tugenden (Gerechtigkeit, Tapferkeit, Erkenntnis usw.) hervorgehen. Als Erkenntnis wird Tugend „lehrbar und unverlierbar“ (ebd.); sie ist also – fast wie bei Aristoteles – auf Erziehung und Übung angewiesen. Nichtsdestoweniger kann dem Menschen dabei eine natürliche Anlage zu Hilfe kommen: die „Zueignung“ (‚oikeíosis‘, ebd.): Der Mensch muss die Dinge sinnvoll bewerten, er muss herausfinden, welche Dinge ihm naturgemäß zu-zueignen, d.h. nützlich („zuträglich“) sind und welche nicht. Dann erst kann er vernunftgemäß auch sein natürliches Streben nach Selbsterhaltung befriedigen. Vernunft soll ihm zur zweiten, zur wahren Natur werden. Und dann erst wird der Mensch die Zueignung auf die gesamte Gesellschaft und schließlich die gesamte Menschheit übertragen können.
In dieser Tugend-Harmonie aus Natur und Vernunft findet der Stoiker seine Glückseligkeit und damit seinen Seelenfrieden, wobei er dem Seelenfrieden anscheinend einen höheren Wert und Rang beimisst als der Glückseligkeit. Auch deshalb ist diese Zielfindung – einschließlich der Hierarchie der Werte – nicht mit der des Aristoteles zu verwechseln.28
Zum Skeptizismus:
Trotz ihres Namens kannten die antiken Skeptiker nicht den systematischen bzw. methodi-schen Zweifel, wie ihn später u.a. Descartes beschrieben hat. Thesenartig lässt sich diese Geisteshaltung wie folgt darstellen29 :
1. Die Glückseligkeit ist auf den von Epikur und den Stoikern empfohlenen Wegen nicht erreichbar. Weder die von der Stoa behauptete „Herrschaft der Vernunft“ noch die von Epikur als möglich behauptete Freiheit von Unlust sind als Voraussetzungen der Glückseligkeit begründbar oder gar beweisbar, erst recht nicht als andauernde Zustände. Da das Wesen der Glückseligkeit nicht bestimmbar ist, kann sie nicht als höchstes Gut gelten.
2. Man muss zwischen zwei Arten von Wertungen unterscheiden: den freiwilligen und den unfreiwilligen. Freiwillige Wertungen beruhen auf Glauben, unfreiwillige auf Zwang. Erstere sind vermeidbar, letztere nicht, weil sie auf Gefühlsregungen (Affekten) beruhen. Es ist jedoch möglich, Affekte zu besänftigen bzw. in ihren Auswirkungen zu mildern.
3. Erreichbar ist nicht Glückseligkeit, wohl aber Gelassenheit, der Seelenfrieden, die Ataraxie. Dies folgt schon aus These 2.
4. „Alle Unruhe kommt aus dem Drang, die Dinge zu erkennen und zu bewerten.“30 Diese Unruhe gefährdet den Seelenfrieden und muss daher bekämpft werden.
5. Die Erfahrung lehrt, dass zu jedem Problem zwei gegensätzliche, einander ausschließende, aber gleichwertige Meinungen gebildet und vorgebracht werden können. Weil es aber nicht möglich ist, zwischen solchen Meinungen zu entscheiden, ist es besser, nicht zu urteilen, keine Bewertung vorzunehmen.
6. Aus der Urteilsenthaltung folgt nicht Verzweiflung, sondern Gelassenheit, Seelenfrieden.
7. Da in der Glückseligkeit kein objektiver Wertmaßstab für das Handeln zu finden ist, muss ein anderer Wertmaßstab gesucht werden, und zwar im Leben selbst und in dessen Erscheinungen (Phänomenen). Das Leben selbst wird aber immer schon von den „faktisch geltenden Normen der Gesellschaft“ reguliert. (Rohls a.a.O. S. 83.) Aus der Gewissheit der Phänomene des Lebens resultiert also eine Abdankung des eigenen Urteils zu Gunsten eines ethischen Konformismus und Traditionalismus.
Zu diesem Ergebnis bemerkt Rohls (ebd. S. 83 f.): „Der Skeptizismus mündet so in einen ethischen Traditionalismus, der sich fremder Autorität verpflichtet weiß, ohne sie objektiv begründen zu können, da er keine objektiven Kriterien für ein glückliches Leben kennt. Und daher übernimmt der Skeptiker denn auch fraglos den staatlich sanktionierten mythischen Götterglauben, weil er über das wahre Wesen der Götter ohnehin keine Aussage treffen kann, sondern diesbezüglich gerade zur Urteilsenthaltung genötigt wird.“31
Religiöse Faktoren
In den Religionen werden nicht selten Glauben und Wissen zu mehr oder weniger trüben Mischungen vermengt. Was im Glauben als „Wissen“ ausgegeben wurde, hat sich zuweilen als unhaltbar herausgestellt, so die Geschichte von der Schöpfung in sechs Arbeitstagen und die Lehre von der „Erbsünde“. Dennoch beanspruchen die Religionen nach wie vor, das Leben der Gläubigen durchgängig zu bestimmen, im jüdischen Talmud sogar bis in kleinste Details des Alltags. Dabei profitieren sie stets von der Grundbefindlichkeit der Menschen, der ‚condition humaine‘. Geboren sowohl mit den Anlagen zu Gut und Böse als auch zur Willensfreiheit, ist der sterbliche Mensch zeitlebens einer Vielzahl von Gefahren, Ärgernissen und Problemen ausgesetzt. Religion bietet die daraus notwendigerweise erforderliche, verbindliche Ethik, z.B. in Form der 10 Gebote. Darüber hinaus ermöglicht sie Halt und Orientierung auch in metaphysischer und transzendenter Hinsicht – was keine nicht-religiöse Ethik allein leisten kann.
Religionen machen Geschichte – bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen wie z.B. den Kreuzzügen, dem Dreißigjährigen Krieg oder dem Dschihad. Trotzdem oder: gerade deshalb werden sie nicht allgemein anerkannt. Atheisten lehnen sie ab; Karl Marx nannte sie „das Opium des Volkes“, doch Ernst Bloch sagte: „Wo Religion ist, da ist auch Hoffnung.“ Glaube, Liebe und Hoffnung sind Grundpfeiler nicht nur des Christentums. – Dies alles gilt es zu bedenken, wenn man versucht, die humanistischen „Spuren“ der Religionen herauszufinden. Hans Küng schreibt dazu:
„ Unüberschaubar, unermeßlich scheint diese Welt der Religionen zu sein.
Doch: Es lassen sich auf unserem Globus drei große Stromsysteme unterscheiden:
- die Religionen indischer Herkunft: Hinduismus und Buddhismus,
- die Religionen chinesischer Herkunft: Konfuzianismus und Daoismus,
- die Religionen nahöstlicher Herkunft: Judentum, Christentum und Islam.
Für die ersten ist der Mystiker, für die zweiten der Weise, für die dritten der Prophet die Leitfigur. Bei allen Überschneidungen und Überlappungen unterscheidet man deshalb zu Recht zwischen indisch-mystischen, chinesisch-weisheitlichen und semitisch-prophetischen Religionen. Dazu kommen die Stammesreligionen, die – kaum über Schrift-Aufzeichnungen verfügend – gewissermaßen den Wurzelboden für alle Religionen bilden und in verschiedenen Regionen der Welt fortbestehen.“32
Zu den Stammesreligionen:
Eine Ur-Religion gibt es offenbar nicht, wohl aber ein „ Ur-Ethos“ (Küng a.a.O. S. 19). Der Grund hierfür liegt in der anthropologischen Konstante der angeborenen Wertungsfähigkeit, die schon die „Ur-Völker“ (wie die australischen Aborigines) genutzt haben, um ihren Kindern die vielfältigen Konkretionen und Konkretisierungen von ‚gut‘ und ‚schlecht‘ erfahr-bar zu machen und durch das ethische Konzept von Gut und Böse zu ergänzen. Zu Hilfe kam ihnen dabei der Glaube an etwas Unvergängliches im Vergänglichen – das angeblich unsicht-bare Ewige im Sichtbaren – und, daraus abgeleitet, die in allen Dingen wirksame „ ewige, ungeschaffene Lebenskraft “ (a.a.O. S. 21), zu der natürlich auch die zentral wichtige Sexualität gehört, was jedoch nicht Frivolität, sondern „tiefe Ehrfurcht vor allem Leben“ bewirkt (S. 24 f.). Diese verbindet sich problemlos mit mehreren ungeschriebenen ethischen Normen, wie „ Gegenseitigkeit, Gerechtigkeit, Großzügigkeit (etwa im wechselseitigen Schenken)“, für deren Einhaltung keinerlei Gebotstafeln benötigt werden (ebd. S. 25).
Zum Judentum:
Wer über jüdische Wertvorstellungen Näheres erfahren möchte, wird wohl zunächst zum Tanach, dem Alten Testament, greifen und sich dann insbesondere mit den mosaischen Zehn Geboten (dem Dekalog), dem Prophetentum und den Psalmen beschäftigen. Die Zehn Gebote bezeichnete Thomas Mann einmal als „das Grundgesetz des Menschen“. Hans Küng nannte sie eine „Basis für ein gemeinsames Grundethos“ der drei prophetischen (abrahamischen) Religionen Judentum, Christentum und Islam. Der Rabbiner Zwi Braun sieht im Dekalog drei Grundvermögen des Menschen angesprochen: Denken, Reden und Handeln im Dienste Gottes. Geregelt werden sollen a) die Beziehungen des Menschen zu Gott, b) die zwischen-menschlichen Beziehungen. Auf das Denken zielen vor allem das erste, zweite und zehnte Gebot, von denen das erste ur-mosaisch nur lautet: „Ich bin der Herr, dein Gott.“, während das zweite weitere Götter verbietet und das zehnte u.a. das Begehren fremden Eigentums tabuisiert. Um das Reden geht es vor allem im 3. und 9. Gebot, die verbieten, den Namen Gottes zu missbrauchen bzw. die Mitmenschen zu verleumden. Die anderen Gebote, d.h. das 4. bis 8., regeln das Verhalten, sie gebieten Pflichten gegenüber den Eltern und Heiligung des Feiertags und verbieten Mord, Diebstahl und Ehebruch.
Dabei steht das rechte Handeln durchaus im Vordergrund.33 Aus dem Talmud, der Inter-pretation des Tanach, wurden immerhin 613 sogenannte ‚Mizvot‘ abgeleitet, darunter 365 Verbote und 248 Gebote, die von den gläubigen Juden strikt einzuhalten sind. Bis ins Kleinste und Alltäglichste reichen die Vorschriften. Einen Überblick hierüber ermöglichen u.a. die 15 „Grundsätze der jüdischen Sittenlehre“, die im Jahre 1865 veröffentlicht wurden. Deren erster appelliert an die „Einheit des Menschengeschlechtes“, die durch Gott als den Schöpfer und Vater aller Wesen gewollt sei. Breiten Raum nehmen dann die Pflichten ein, die sich aus der schon mosaisch befohlenen Nächstenliebe ergeben. Ausgeschlossen ist dadurch jede Art von Lieblosigkeit, Gehässigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen. Leben, Gesundheit, Besitz und Ehre des Nächsten sind unter allen Umständen zu respektieren, was auch Sittenstrenge sowie Achtung vor Ehe und religiösen Überzeugungen einschließt.34 Selbstverständlich sind diese Grundsätze großenteils identisch mit den Zehn Geboten oder überschneiden sich mit ihnen.
Darüber hinaus ist nicht zu verkennen, dass die Zehn Gebote eine der Grundlagen heutiger Rechtsordnung bilden, da sie z.B. schon im Römischen Recht und in nicht-jüdischen Religionsgemeinschaften (z.B. nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam!) Aufnahme gefunden haben.35
Zum Hinduismus
Als ‚Hindus‘ wurden ursprünglich alle Inder/innen bezeichnet, heute nur noch diejenigen, die der hinduistischen Religionsgemeinschaft angehören. Die Geschichte dieser Religion umfasst einen Zeitraum von ca. 3500 Jahren, während dessen immer wieder neue Systeme und Strömungen hervorgebracht wurden. Vielleicht am meisten interessiert davon immer noch die altindische Periode der Veda (Mehrzahl: Veden, eine Ansammlung von Schriften, die für sich eine ganze Literatur beinhalten). Es ist die Zeit von ca. 1500 bis 500 v. Chr.
Von der Vielgötterei führt der vedische Weg bald zur Suche nach der Einheit und dem möglichen Weltengrund, dem Urgrund aller Dinge des Alls. Darum kümmern sich, parallel zur Entstehung des Kasten-Systems, vor allem diejenigen, die als Priester an der Spitze der Kasten-Hierarchie stehen: die Bramahnen.
Mehr und mehr rückt deren religiöses Denken ab in spirituelle Sphären, wobei an die Stelle ursprünglicher Fröhlichkeit und Lebensbejahung allmählich eine eher pessimistische Grund-bewertung gegenüber dem Dasein tritt, wonach alles Dasein dem Leiden verfallen sei. Dagegen werden in den – ursprünglich esoterischen, d.h. typischer Weise nur für einen kleinen Kreis von Eingeweihten gedachten – Upanischaden-Lehren neue „Heilmittel“ ange-boten: die Konzepte von Atman und Brahman, von Seelenwanderung und Erlösung.36
Ein neues Menschenbild entsteht, allerdings weiterhin nicht im Sinne des westlichen Individualismus, sondern in Bezug auf übergreifende Ordnungssysteme (Familie, Gesell-schaft, Kosmos). In diese Systeme soll der Einzelne sich einfügen. Dabei dreht sich alles um vier Prinzipien, die man auch als ‚Werte‘ bzw. ‘Lebensziele‘ oder ‚Daseinszwecke‘ bezeich-nen kann, und zwar 1. ‚Kama‘: „das Streben nach Vergnügen und (vor allem sexuellem) Genuß“, 2. ‚Artha‘: „die Anhäufung von Reichtum, Wohlstand und Macht“, 3. ‚Dharma‘: „die Praxis der persönlichen und sozialen Verantwortlichkeit innerhalb der kosmischen Ordnung“ und 4. ‚Moksa‘: „das Erreichen von Befreiung aus karmisch geregelten Bindungen und Leiden, aus denen das weltliche Leben besteht“. (Karma: fortdauerndes Schicksal des Menschen in guten und bösen Taten. Vgl.Krobath a.a.O. S. 563.) Von diesen Prinzipien verdient Dharma besondere Beachtung, schon wegen seines außerordentlich weiten Bedeu-tungsumfangs. Aus dem Sanskrit stammend bedeutet er (neben einer Grundbedeutung ‚Gewebe‘): „Ordnung, Gesetz, Brauch, Sitte, Vorschrift, Regel; Pflicht, Tugend, gute Werke, religiöser Verdienst; Natur, wesentliche Eigenschaft, Charakteristikum“.37 Das Wort Dharma geht etymologisch auf eine Wurzel ‚dhr‘ (‚halten‘) zurück und meint daher einen Weltgrund, eine Substanz, die alles trägt, vom Kleinsten bis zum Größten im Kosmos und somit auch die Gesamtheit des Mensch-Seins. Durchaus vergleichbar ist Dharma mit der grundlegenden, alles durchdringenden „Lebenskraft“ der Stammesreligionen, teilweise auch mit dem LOGOS, über den er jedoch weit hinausgeht, weil er auch „das Gesetz Gottes“, Natur, Ethik und Moral einbezieht und sozusagen sämtliche Lebensbereiche regelt, bis hin zu Essens- und Hygiene-Vorschriften. Ewiges Glück kann erlangen, wer sich an diese Regeln hält und weiß, worin seine Pflicht und seine Aufgaben bestehen, auch im Zusammenleben der Menschen. (Wobei „Gewaltlosigkeit, Wahrheit, Nicht-Stehlen, Reinheit und Kontrolle der Sinne“ als universal gelten, also zu den Pflichten aller Menschen gehören. Vgl. Yogawiki a.a.O. S. 6)
Als universale Ethik verbindet sich Dharma mit dem zentralen Gedanken der Gerechtigkeit, darüber hinaus mit dem Absoluten (‚brahman‘) und der Selbstfindung im Atman (s.o.). ‚Tat tvam asi‘ – ‚das bist du‘, lautet die von Schopenhauer begeistert zitierte Formel, mit der das Vermögen des Selbst, sich in ein anderes Selbst einzufühlen, umschrieben wird. Es ist die Fähigkeit zum Mitleid und zum Mitleiden. (Vorwegnehmend die moderne Empathie, deren neuronale Grundlage Hirnforscher in den Spiegelneuronen nachgewiesen haben!) – Vorzügliches Mittel der Selbsterhaltung und der Selbstverwirklichung ist der Dharma, der zugleich als „die einzige Zuflucht des Menschen“ gilt und Schutz gewährt gegenüber den jedem Hindu geläufigen „sechs Feinden“: 1) weltliche Begierden, 2) Zorn, 3) Geiz und Gier, 4) Verblendung und geistige Finsternis, 5) Hochmut, 6) Neid und Eifersucht (vgl. Dharma a.a.O. S. 8).
Im Hinduismus sind immer wieder neue religiös-weltanschauliche Systeme hervorgebracht worden. Davon ist wohl das bekannteste und – in unterschiedlichen Formen – am meisten praktizierte das Yoga -System, ein Begriff, der besonders in Europa oft missverstanden und z.B. mit Zauberkünsten, Schaulust, Obskurantismus usw. in Verbindung gebracht wurde.
Zum Buddhismus
Ein in mehrfacher Hinsicht erstaunliches Phänomen! Entstanden ist es vor mehr als 2500 Jahren in Nordindien, als der aus Nepal stammende Fürstensohn Siddartha Gautama (ca. 560-480 v.Chr.) sein Erleuchtungs-Erlebnis hatte. ‚Buddha‘– auf Deutsch der ‚Erweckte‘, der ‚Erleuchtete‘ – lautet sein Ehrenname.
Erstaunlich ist mindestens zweierlei: 1. Es handelt sich um ein Dharma, eine religiöse (?) Weltanschauung, die sich in wahrhaft friedlicher Weise, nämlich ohne jedes Blutvergießen (!), im Laufe der Jahrhunderte über fast ganz Asien verbreitet hat und bis heute weltweit Anhänger findet. 2. Falls der Buddhismus überhaupt eine Religion ist, so ist er – jedenfalls ursprünglich – eine Religion ohne Gott, was widersinnig, wenn nicht absurd erscheinen mag.
Was aber dachte Gautama Buddha selbst? Sehr wohl war er sich bewusst, was sein Verzicht auf jeglichen Theismus bedeutete: den Menschen selbst in den Mittelpunkt und sogar auf sich selbst zu stellen! Er, Gautama selbst, soll gesagt haben: „Es ist töricht, anzunehmen, daß ein anderer uns Glückseligkeit oder Elend verschaffen könne.“ Ferner: „Und wer auch immer jetzt oder nach meinem Tode sich selbst Richtschnur sein wird, sich selbst Zuflucht sein wird, keine äußere Zuflucht suchen wird, sondern zur Wahrheit stehen wird als zu seiner Richtschnur und zu niemandem Zuflucht suchen wird außer zu sich selbst – er ist es, der die allerhöchste Höhe erreichen wird.“ (Zitiert von Störig ebd. S. 68.)
Das entspricht vielleicht sogar modernen Auffassungen von Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Zu fragen ist allerdings, was Gautama unter der „Wahrheit“ versteht und wie sie zur „Richtschnur“ für das Leben des Einzelnen werden soll oder kann.
Dazu ist es erforderlich, Gautamas Wertlehre durchzumustern. Welche Werte hat ihm die „Erleuchtung“ geoffenbart? Zunächst sind es die Vier Edlen Wahrheiten, die dabei helfen sollen, „Urfragen des Menschen zu beantworten und die Welt wie das eigene Leben zu durchschauen und zu bewältigen“. Hans Küng erläutert dazu vier Fragen und ihre Antworten. Die Fragen lauten: 1. „ Was ist das Leiden ?“, 2. „ Wie entsteht das Leiden?“, 3. „ Wie kann das Leiden überwunden werden“?, 4. „Auf welchem Weg ...“ kann die Überwindung gelingen? – Die Antworten: 1. „Das Leben selbst ist Leiden: Geburt, Arbeit, Trennung, Alter, Krankheit, Tod.“, 2. Leiden entsteht durch „Lebensdurst, durch Haften an Dingen, durch Gier, Haß und Verblendung. Das aber hat Wiedergeburt auf Wiedergeburt zur Folge.“, 3. Zur Überwindung des Leidens verhilft nur das „Aufgeben des Begehrens. Nur so wird neues Karma, die Folge von guten wie bösen Taten, vermieden, nur so ein Wiedereinstieg in den Kreislauf der Geburten verhindert.“, 4. Die Methode, der Pfad hierzu ist der „Weg der vernünftigen Mitte – weder Genußsucht noch Selbstzüchtigung.“ Diesen Pfad bezeichnet Gautama auch als den „Achtfachen Pfad zum rechten Leben“, oder auch: den achtteiligen Pfad zum Nirvana, wobei er unter Nirvana hier das „Erlöschen“, nämlich u.a. die „Been-digung von Gier, Haß und Verblendung“ versteht. (Vgl. Küng a.a.O. S. 160 f.)
Der „heilige“ achtteilige (bzw. achtfache) Pfad besteht in Wirklichkeit aus folgenden acht Wert-Begriffen: „ rechtes Glauben, rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sich-Versenken“ (Störig a.a.O. S. 59). Wobei „rechtes “ natürlich nicht politisch missverstanden werden darf! Außerdem fällt auf, dass die Forderungen Zarathustras nach vernünftigem Denken, Sprechen und Handeln (s.o.) hier wiederkehren.
Zum Daoismus
Dieser gleicht in einigen Aspekten dem Hinduismus und dem Buddhismus. Das Dao (Tao) entspricht teilweise dem hinduistischen Brahman, während Selbstlosigkeit und Verzicht auf Begehren eher an den Buddhismus erinnern. Grundlage des Daoismus ist das Weisheitsbuch ‚ Dao-de-dsching ‘, das der chinesische Philosoph Lao-tse (604 – ca. 520 v. Chr.) verfasst hat. Dao bedeutet sowohl ‚Weg‘ (bzw. rechter Weg) als auch ‚Vernunft‘ (Störig a.a.O. S. 109). Es ist der Urgrund, dem alles Sein entspringt und in den auch alles wieder zurückkehrt. Dieser Urgrund ist allerdings unbegreiflich und eigentlich nicht beim Namen zu nennen: „Das ewige Tao hat keinen Namen; Tao ist verborgen, namenlos; Ich weiß seinen Namen nicht, nenne es aber Tao“, sagt Lao-tse (Störig S. 110). Die einzige Möglichkeit, sich seiner Existenz zu vergewissern, besteht für den Menschen darin, sich in das Ganze von Natur und Kosmos einzufühlen („sein Walten in den Gesetzen der Natur und des Weltablaufs erfühlen und zum Richtmaß auch unseres menschlichen Lebens machen“, Störig ebd.). Dazu ist aber – wie bei Gautama – innere Distanz, Loslassen von den Dingen und dem Getöse der Welt, erforderlich. Dann erst kann das Dao Richtschnur für ein Handeln werden, das nicht mehr um des puren Erfolgs willen und nicht um seiner selbst willen stattfindet. Was jedoch nicht Weltflucht und Askese bedeutet, sondern, ähnlich wie später bei Aristoteles, das Bemühen, einen Goldenen Mittelweg des Glücks und des Maßes zu finden, so dass Ruhe, Frieden, Kraft und Erleuchtung eintreten können. Insofern erreicht der Daoismus religiöse Dimensionen. Sogar Unsterblichkeit wird denjenigen in Aussicht gestellt, die sich selbst entsagen, d.h. jegliche Selbst- und Ich-Sucht fahren lassen.
Zentrale Werte des Daoismus sind außerdem „Loyalität und kindliche Liebe“, was bedeutet, „die Höherstehenden zu ehren und die Niedrigerstehenden zu lieben“ (Krobath S. 569). Diese zentralen Werte werden auch als „feudale Kardinalwerte“ bezeichnet, während auf einer anderen Ebene die „fünf taoistischen Gebote“ angesiedelt sind, nämlich: „nicht Morden, nicht Ehebrechen, nicht betrunken sein, nicht Stehlen, nicht Lügen“ (ebd.). Auch dies erinnert natürlich an ähnliche Vorschriften im Buddhismus und in den Zehn Geboten. – Hoch über allen Ge- und Verboten steht jedoch – wie im Christentum – die Nächstenliebe; es sollte „die Liebe, die man zu sich selbst hat, verbunden sein mit der Liebe zu anderen“ (Krobath S. 570).
Zum Konfuzianismus
Der Name Konfuzius ist die von Europäern vorgenommene Latinisierung des chinesischen ‚Kung-fu-tse‘ (oder: Kong Fuzi) und bedeutet so viel wie ‚Meister aus dem Geschlechte Kung‘. Es ist der Name eines Philosophen, Sozialpolitikers und Staatsmannes, der von ca. 551-479 v.Chr. gelebt hat. Seine Lehren haben in China im Laufe der Jahrhunderte weitaus mehr Popularität gewonnen als der Daoismus. Auch im heutigen kommunistischen China werden diese Lehren wiederbelebt. Weithin bekannt ist Kung-fu-tses Formulierung der Goldenen Regel: „Was du selbst nicht wünschest, das tue auch nicht den anderen“, eine Formel, auf die sich im Jahre 1993 das Chicagoer Parlament der Religionen als Grundlage eines Weltethos einigte, obwohl das religiöse Element bei Konfuzius kaum eine Rolle spielt.
Dass die Goldene Regel nahezu alle Bereiche des Mensch-Seins betrifft, zeigte sich schon in altchinesischer Zeit. Denn diese Regel gipfelt in der Menschenliebe. „Die Menschen lieben“ lautet die Erläuterung des Begriffs ren (= ‚Menschlichkeit‘), die Konfuzius gegeben hat (Küng a.a.O. S. 120). Ohne Menschenliebe keine Menschlichkeit! Als Voraussetzung hierfür nennt Konfuzius allerdings höchste Disziplin und „vorbildliches Verhalten in jeder Lebenslage“ (Störig a.a.O. S. 105).
Dem entspricht das konfuzianische Ideal des „edlen Weisen“, das der Meister sogar aus dem Dao ableitet, in dem er allerdings nicht mehr das Absolute, sondern vor allem das unveränderliche Naturgesetz, das Weltgesetz und die sittliche Ordnung sieht. Was aber sind die Aufgaben des „Edlen“ (der nicht mit einem Edelmann zu verwechseln ist)? Laut Störig (S. 104): „Güte vergilt er mit Güte, der Schlechtigkeit begegnet er mit Gerechtigkeit. Indem er seinen eigenen Charakter formt, hilft er zugleich anderen, den ihren zu bilden. Äußeres und Inneres stehen bei ihm im rechten Gleichgewicht, denn: >Bei wem der Gehalt die Form überwiegt, der ist ungeschlacht; bei wem die Form den Gehalt überwiegt, der ist ein Schreiber. Bei wem Form und Gehalt im Gleichgewicht sind, der ist ein Edler.< “.
Es ist eine humanistische Weisheit, aus der nicht nur eine Ethik, sondern auch die staatliche und gesellschaftliche Ordnung begründet werden soll. In der Ethik sind die „fünf einfachen Tugenden“ maßgeblich, nämlich: Weisheit, Güte, Treue, Mut und Ehrfurcht. Für die Staats-führung gilt Folgendes: Die Regierenden sollen, teilweise ähnlich wie im Daoismus, „nicht durch Gewalt, auch nicht durch viele Gesetze, sondern durch die ausstrahlende Kraft ihres Beispiels das Volk führen und sein Vertrauen, die wichtigste Grundlage des Staates, erhalten“ (Störig S. 106). Herrschaftslosigkeit verlangt Konfuzius also offensichtlich nicht! Als Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung der Gesellschaft nennt er vielmehr die „Richtigstellung der Begriffe“ und meint damit die Notwendigkeit, sich über die Inhalte der Begriffe immer wieder neue Klarheit zu verschaffen.38
Jesus, der Menschen Freund
„ Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit die Welt durch ihn gerettet wird“, heißt es im Johannes-Evangelium (Kap. 3, V. 16 f., in der „Ein-heitsübersetzung“, in: Die Bibel, Stuttgart 1999, S. 1185). Opferbereite Liebe zur Welt und zum Menschen gilt demnach als Voraussetzung für die Menschwerdung. Mit welchem Tiefsinn diese Liebe verbunden ist, geht aus der Vorrede des gleichen Evangeliums hervor, in der steht:
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“ (Joh. 1, 14)
Es ist aber eine Gnade, die keineswegs allgemein akzeptiert, sondern – wie von heutigen Atheisten und Andersgläubigen – von Einigen rundweg abgelehnt wurde, wozu der Evangelist anmerkt: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden “ (Joh. 1, 11 f., mit den „Seinen“ ist wohl ein Großteil von Jesu jüdischen Landsleuten gemeint). Jesus, Gottes Sohn, ist das Licht, das in der Finsternis aufleuchtete, aber „die Finsternis hat es nicht erfasst“ (1, 5).
Was aber bedeutet die Inkarnation als Grundlage der Wertlehren Jesu? Als ihn der Jünger Thomas einmal um Wegweisung, d.h. Orientierung bittet, antwortet Jesus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.“ (Joh. 14, 6 f.).
Damit gibt Jesus sich als göttliche Person zu erkennen: Wer ihn erkennt, erkennt auch Gott. Die Personalität Gottes – bekundet schon im ersten der Zehn Gebote („Ich bin der Herr, dein Gott“) – verschmilzt mit dem Person-Sein Jesu, was natürlich erneut nur geglaubt, nicht bewiesen werden kann. Das tiefste Geheimnis dieser Glaubenswahrheit offenbart sich wahrscheinlich im Geheimnis des Heiligen Geistes. Gott ist als Logos (= Sinnstifter) der „Geist der Wahrheit“ (Joh. 14, 17). Aus ihm geht der Heilige Geist hervor, dessen nach-haltigen Beistand Jesus den Jüngern verspricht. Die Personalunion in der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist wird damit unmittelbar deutlich, bedarf keiner 3-Personen- oder 3-Substanzen-Lehre (wie sie der Theologe Tertullian im 2./3. Jh. n. Chr. umständlich versucht hat). Zu bekräftigen scheint mir vielmehr meine These: „Die ureigenste Botschaft des Christentums betrifft das ureigenste Sein der Person, ihre Individualität. Vor Gott und durch Christus bekommt jede Einzelperson ihre unendliche Würde und Anerkennung als Person.“39 Dies umso mehr, als Jesus während seines irdischen Daseins als historische Person durchaus als „wahrer Mensch“ aufgetreten ist. Er versteht sich als Verkörperung der Liebe Gottes zur Welt und zu allen Menschen. Dergestalt fühlt er sich berufen, das Liebesgebot auf alle Formen der Liebe auszudehnen, d.h. nicht nur auf Eros und Sexus zu beziehen, sondern auch auf Agape (bzw. ‚caritas‘, die selbstlose, nicht-erotische Nächsten- und Feindesliebe, darüber hinaus: die kosmische Liebe zu allen Wesen). Damit geht Jesus weit über das bereits alttestamentarisch, nämlich bei Moses, bezeugte Gebot der Nächstenliebe hinaus. Was Paulus im Römerbrief veranlasste, die Nächstenliebe zum Inbegriff der mosaischen Zehn Gebote und jeglicher Gesetzes-Erfüllung zu erklären, und zwar in dem Satz: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Röm. 13,9), so dass auch die opferbereite Agape nicht Vernach-lässigung der eigenen Person bedeutet. Außerdem ist unübersehbar, dass in der Feindesliebe auch der „Feind“ zum Nächsten, die Nächstenliebe zur Fernstenliebe wird.
Inwiefern Jesus das altjüdische Gesetz reformieren will, zeigt sich deutlich in seiner Auseinandersetzung mit einigen der mosaischen Zehn Gebote und anderen Regeln und Gepflogenheiten. Diese will er nicht einfach bekräftigen oder kritisieren. Vielmehr geht es ihm darum, die Gründe für Konflikte und die von den Geboten bekämpften Delikte möglichst schon in deren Vorfeld aufzuspüren. Unheil tritt seiner Meinung nach schon dann ein, wenn man nicht versucht, Konflikte außergerichtlich zu bewältigen. Gerichte entscheiden nicht selten zu Gunsten der Mächtigen, gegen sozial oder politisch Schwächere. Ein römisches Sprichwort lautet „Summum ius, summa iniuria“ (Höchstes Recht, höchste Ungerechtigkeit). Es gab und gibt Klassenjustiz. Davor will Jesus seine Gemeinden schützen. Daher warnt er vor jeder Form von Aggression. Das Töten beginnt, wie er sagt, schon dort, wo man seine Mitmenschen beleidigt oder verleumdet, aggressiv mit ihnen umgeht. Ehebruch beginnt nicht erst im Akt der Untreue: „Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.“ (Matth. 5, 27). Ehe und Familie müssen geschützt werden, insbesondere in gefährdeten Gemeinschaften wie der Urgemeinde Christi. Im Übrigen ist in der Bibel nirgendwo davon die Rede, Jesus habe grundsätzliche sexuelle Enthaltsamkeit gepredigt, zumal er sich nie frauenfeindlich gezeigt hat.
Zu Jesu Bergpredigt.
Nicht nur der Schwächere soll auf jede Form von Rache und Vergeltung verzichten; „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ kann nicht mehr die Devise sein. Direkte Konfrontationen mit Gegnern sind zu vermeiden. Feinde soll man nicht hassen, sondern lieben (s.o.). Mildtätigkeit und Frömmigkeit soll man nicht zur Schau stellen.
Eher beiläufig und in auffällig knapper Form erwähnt Jesus die Goldene Regel („Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg‘ auch keinem andern zu!“). Bei Jesus lautet sie: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ (Matth. 7, 12). Die Regel stammt von dem chinesischen Philosophen Konfuzius, der von 551 bis 479 v. Chr. gelebt hat. Obwohl Kant sie als „egoistisch“ kritisiert hat, war sie die einzige Formel, auf die sich führende Repräsentanten der Weltregionen als ethische Grundregel geeinigt haben, als es im 20. Jahrhundert darum ging, das von Hans Küng initiierte Weltethos zu begründen. Dass Jesus die Goldene Regel nur beiläufig erwähnt, dürfte daran liegen, dass er in ihr keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung und Bestätigung seiner Wertlehren sieht.
Auch beim Gebet soll es keine Heuchelei und kein Zur-Schau-Stellen geben. Das Vaterunser soll durch seine Wir-Form („ wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“) die geistige und geistliche Gemeinschaft der Gläubigen stärken, die sich gegenüber Gott als schuldig und bedürftig fühlen und sich überdies der Versuchung und dem Bösen ausgesetzt sehen. Die Betenden bitten Gott um kurzfristige Hilfe aus diesen Gefahren, auch wenn sie wissen (bzw. glauben), dass das Böse langfristig erst im Reich Gottes gänzlich verschwinden wird.
Insgesamt gesehen gehören Bergpredigt und Vaterunser sicherlich zu den Grundlagen des Neuen Bundes der Freiheit vom Gesetz, den Jesus den Seinen verspricht. Mit ihm will er den Alten Bund ersetzen, den Gott einst mit Moses – Moses mit Gott – geschlossen hatte. Den Neuen Bund bietet Jesus allen Menschen an, und zwar anlässlich des letzten Abendmahls vor seinem Kreuzestod. Er identifiziert diesen Bund mit dem symbolischen Kelch seines Blutes, den er den Jüngern darreicht. Besiegelt wird der Bund in Christi Auferstehung und in seinem Missionsauftrag („Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe!“).40
Exkurs ins Mittelalter: zum Islam
Im Unterschied zum Christentum kennt der Islam keine Menschwerdung Gottes. Mohammed beruft sich zwar nicht nur auf Abraham, sondern ausdrücklich auch auf Jesus, dessen „Gute Botschaft“ Gott in ihm, Mohammed, „erfüllt“ habe41; doch er lehnt sowohl Jesu Göttlichkeit als auch dessen Erlöser-Rolle strikt ab. (Was widersprüchlich erscheint, denn Letzteres gehört zweifellos auch zur „Guten Botschaft“ Jesu.)
Mit schwerwiegenden Folgen für den Islam. Dieser bedeutet ja im ursprünglichen Wortsinn so viel wie „völlige Hingabe an Gott und seinen Willen“ und darüber hinaus, ähnlich wie das hebräische ‚Shalom‘: „Frieden im Sinne eines allumfassenden Heilseins“, d.h. nicht mehr nur eine bestimmte Religionsgemeinschaft, sondern „den Kern wahrer Religiosität schlechthin“ (Priesmeier a.a.O. S. 1).
Religion aber bedeutet Rückbindung an Gott, im Islam sogar völlige Hingabe an Gott, der „tut, was er will“ – somit völlige Unterwerfung des Individuums unter seinen Willen. Wo bleibt da das natürliche Recht des Menschen auf Selbstbestimmung? Wird sie nicht völlig geleugnet und vernichtet? Nun, einflussreiche islamische Theologen haben diese Gefahr durchaus erkannt und verweisen daher auf die Tatsache, dass der Koran dem Menschen durchaus eine gewisse Autonomie einräumt, weil er immer wieder an Vernunft, Erfahrung und Erkenntnis-Fähigkeit und an Natur und Geschichte als deren Quellen appelliert. Der Theologe Sir Muhammad Iqbal erklärt im Zusammenhang damit: „Das schließt die kühne Erkenntnis ein, dass Leben nicht immer am Gängelband geführt werde, dass der Mensch, um volles Selbstbewusstsein zu erreichen, am Ende auf seine eigenen Bestände zurückgeworfen werden muss.“42 Sichtbar wird hier so etwas wie eine – vielleicht nur geforderte, ideal gemeinte – gottgewollte Eigenständigkeit des Menschen; Gott schenkt ihm „eigene Bestände“, Selbstbewusstsein und eine gewisse Verfügungsmacht über Natur und Geschichte.
Aber nur in bestimmten, klar umrissenen Grenzen. Wichtiger als der Glaube ist im Islam, ähnlich wie im Judentum (!), das rechte Handeln des Menschen, das umso stärker reglementiert wird, und zwar durch die Scharia, das Gesetz, das „die Gesamtheit der auf die Handlungen des Menschen bezüglichen Vorschriften Allahs“ umfasst. Damit kann der Mensch zum höchsten Einsatz und Bemühen (‚Dschihad‘ in wörtlicher Bedeutung!) motiviert, wenn nicht gezwungen werden, notfalls auch zum Heiligen Krieg.
Da der Mensch nicht völlig selbständig über Gut und Böse befinden kann und darf, braucht er keine spezielle Ethik, sondern nur eine spezielle „Charaktereigenschaftskunde“, ein Begriff, der allerdings dem Wortursprung SUEDOS (für ‚Ethik‘, s.o.) erstaunlich nahe liegt. Nichts-destoweniger ergeben sich die moslemischen Pflichten aus einem strengen Sittenkodex, der neben genuin religiösen Vorschriften (Bekenntnis zu Gott und Mohammed, das fünffache tägliche Ritualgebet, das Fasten im Ramadan, Pilgerfahrt nach Mekka) die Verpflichtung zu einer individuell genau errechneten Einkommensabgabe enthält – als Ausdruck der Solidarität mit den Armen und Schwachen der Gesellschaft. – Im Übrigen entsprechen die auf dem Koran beruhenden detaillierten Verhaltensvorschriften weitgehend denjenigen der Zehn Gebote, enthalten aber, darüber hinaus, genaue Anweisungen und Verbote mit dem Ziel der Erziehung zu Bescheidenheit, Wahrhaftigkeit, Höflichkeit, Übernahme der Verantwortung für das eigene Tun, Gemeinsinn, Mäßigung, Dankbarkeit und Wachsamkeit gegenüber Verstößen gegen die Regeln des Korans, wobei auch die Möglichkeit der Vergeltung (Notwehr) eingeräumt wird.
Sufis und Aleviten
Dass der Islam nicht zwangsläufig auf einen Fundamentalismus hinauslaufen muss, zeigt sich an islamischen Glaubensgemeinschaften wie denen der Sufis und der Aleviten, die weniger die Gründe des Gesetzes und des Buchstabens als vielmehr die Gründe des Herzens und der Menschlichkeit betonen und damit den Wünschen und Sehnsüchten des Volkes entgegenkommen.
‚Suf‘ bezeichnet im Arabischen die ‚grobe Wolle‘, aus der die Büßerhemden der ersten Sufi-Mönche gewirkt waren. Ihr Ziel war es, Gottes Nähe im Herzen zu erfahren, ein Ziel, das lange vor ihnen schon Asketen und Mystiker gesucht hatten. Im Islam kamen solche Bestrebungen erst im späten 9. Jahrhundert auf. Stets waren die Sufis allerdings darauf bedacht, Allahs höchste Autorität und Dominanz zu respektieren, so dass eine gar totale Verschmelzung von Gott und Mensch nicht in Frage kam.
Von den meisten anderen Asketen und Mystikern unterschieden sie sich dadurch, dass sie keineswegs Kinder von Traurigkeit waren, sondern ihren Glauben durch Freude, Liebe und eine gewisse Freizügigkeit, zumal in Musik und Tanz (Derwisch-Tanz bis zur Trance!), zum Ausdruck brachten. Dass all dies zur Ehre Gottes geschah, demonstrierten sie durch ein besonderes Gottes-Gedenken, den „ Dhikr Allah: Unaufhörlich wird Allah angerufen und seine vielen Namen, wird seine Größe und Ewigkeit litaneiartig gepriesen“ (Küng).
Mystisch ist der Weg des einzelnen gläubigen Sufi insofern, als er, vom Gesetz herkommend, auf dem Pfad der Mystik zur Wahrheit in Gott führt; wissenschaftlich und weltanschaulich gestützt durch eine stark psychologisch geprägte „Wissenschaft vom Innern“ und „Lehre des Herzens“ (ebd.).
In der islamischen Welt waren die Sufis allerdings trotzdem nicht überall willkommen. Von orthodoxen Theologen wurden sie angefeindet, einige auch von Politikern und Staatsmännern wie dem türkischen Staatsgründer Kemal Atatürk, der sich nicht scheute, als politisch reaktionär eingestufte Sufi-Orden zu verbieten (vgl. a.a.O. S. 299). – An Einfluss und Wirkung haben die Sufis bis heute dennoch kaum verloren.
Die Aleviten verbindet mit den Sufis die humanistische Orientierung, zu der auch die mystische Interpretation des Korans gehört. Ihre Bewegung, deren Angehörige vor allem im Osten der heutigen Türkei anzutreffen sind, existiert seit dem 13. Jahrhundert. Ihren Namen „Anhänger Alis“ leiten sie von Mohammeds Vetter und Schwiegersohn Ali ab, den sie, im Unterschied zu den Sunniten, in Ehren halten.
Dass sie von Sunniten oft angefeindet und verfolgt wurden, liegt wohl auch an ihrer Ablehnung der sunnitischen Scharia und jeglicher dogmatischen Religionsauslegung. Stattdessen bewerten sie die Gottesliebe und die Liebe zu Gott höher als die Gottesfurcht, sehen, fast pantheistisch, das Göttliche in jedem Menschen angelegt und leiten daraus, ebenfalls im Sinne der Mystik, Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Geduld und Bescheidenheit als oberste Werte der Lebenspraxis ab. Teilweise näher als dem Koran stehen sie den Lehren des altpersischen Philosophen Zoroaster (Zarathustra), der u.a. „rechtes Handeln, rechtes Denken, rechtes Sprechen“ gefordert hat.43
In diesem Sinne und darüber hinaus: Was die Welt, nicht zuletzt die westliche, dem Islam, insbesondere auf den Gebieten von Philosophie und Naturwissenschaften, verdankt, sollte keineswegs in Vergessenheit geraten. Ohne die islamisch-arabische Philosophie hätte es wahrscheinlich weder Scholastik noch Aufklärung gegeben, wie es Frieder Otto Wolf in einem Vortrag vor Mitgliedern der Grünen Partei (Ende der 1990er Jahre) ausführlich dargelegt hat.[44] – Erinnert sei auch an die besondere Wertschätzung, die Ernst Bloch der islamisch-arabischen Philosophie gewidmet hat, so in Avicenna und die Aristotelische Linke (Frankfurt a.M. 1963) sowie in seiner Würdigung Mohammeds und der islamischen Religion im Prinzip Hoffnung (1959, S. 1333-36 bzw. 1504-09). Denker wie Avicenna (Ibn Sina), Averroes und Avicebron hätten „das griechische Licht zugleich gerettet und verwandelt“. (Avicenna , a.a.O. S. 9.)44
Kritische Würdigung
Zu Heraklit
In einigen Kommentaren zu Heraklit wird in Bezug auf die Fluss- und Fließ-Metaphern darauf hingewiesen, dass Flüsse ja von relativ festem Land umschlossen sind, so dass anschei-nend nicht alles fließt, zumal die Welt ja nicht nur aus Flüssen besteht. Konstanten und (relativ) feste Strukturen gibt es schon im Bereich der Moleküle, die sich in relativ stabilen Masseteilen bzw. Stoffen vereinigen.
Zum Logos: Ob dieser tatsächlich allem zu Grunde liegt, ist nicht überprüfbar. Denn wir wissen nicht, was vor dem sogenannten „Urknall“ (Big Bang) gewesen ist, auch nicht, ob in diesem Zustand ein Nichts geherrscht hat, aus dem heraus eine Schöpfung des Universums („creatio ex nihilo“) möglich gewesen wäre. Wir wissen nicht einmal, ob dieser Big Bang überhaupt ein Ur-Knall war. Dennoch ist anzunehmen, dass der Big Bang aus seiner Negation, d.h. aus einem andersartigen Zustand des Kosmos, hervorgegangen ist, auch wenn niemand weiß, wie dies geschehen sein mag. Ein kosmologisches Nicht geht dem Big Bang voran. Insofern trifft auf diesen Zustand, dieses Nicht als Ursache, zu, was Ernst Bloch erkennt: „Das Nicht ist Treiben nach dem was ihm fehlt“. Und dieses Treiben setzt sich fort in allen späteren Gestaltungen des Kosmos, bis hin zu den Lebewesen: „Mit Nicht wird das Treiben in den Lebewesen abgebildet: als Trieb, Bedürfnis, Streben und primär als Hunger“ – mit allesamt entelechetischen Bestimmungen des Lebens.45
Polemos als „Vater aller Dinge“. Ob alles durch Kampf, Streit oder gar Krieg entsteht, ist zweifelhaft. Schon bei den E-Teilchen wird festgestellt, dass sie nach Verbindungs-Möglich-keiten suchen, anscheinend ohne dass dies zu Konflikten führt. Ähnliches dürfte auf allen anderen Seinsgebieten gelten, jedenfalls teilweise.
Zu Heraklits Gottesvorstellungen: Dass alle – außer Heraklit – den Logos verkennen oder missachten, ist fraglich. Gleiches gilt für Heraklits Pantheismus. Dass alles „göttlich“ sei, wäre erst noch zu beweisen. Vieles spricht dagegen. Unbewiesen – und unbeweisbar – ist auch die Behauptung, Gott sei keine Person. – Unbestreitbar ist dagegen, dass Heraklit ein Begründer des dialektischen Denkens ist, worauf auch Platon hingewiesen hat.
Zu Demokrit
Seine Behauptung, auch die Seele sei ein „Atomenaggregat“, konnte wissenschaftlich nicht belegt werden. Schon Aristoteles (s.u.) kam zu einer gänzlich anderen Auffassung, als er die Seele als „die Form des Körpers“ bezeichnete. Nach moderner Auffassung bedeutet die Seele die je besondere Art des individuellen Erleben s – im Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist.
Zwischen der Atomtheorie Demokrits und derjenigen heutiger Atomphysik gibt es bedeutende Unterschiede:
„Das Atommodell von Demokrit unterscheidet sich in mehreren wesentlichen Aspekten von unserem heutigen Verständnis der Atome:
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Das heutige Modell basiert auf experimentellen Beweisen und beinhaltet eine differenzierte Struktur der Atome, die verschachtelte Elemente wie Protonen und Neutronen umfassen, im Gegensatz zu Demokrits Vorstellung eines unteilbaren und einfachen Teilchens.“46
Zu Platon
Dessen Ideenlehre hat schon sein Schüler Aristoteles heftig kritisiert. Demnach entstehen die Ideen nicht im platonischen „Ideen-Himmel“, sondern in den Köpfen der Menschen. Dagegen meint Platon, auch den „idealen Staat“ nicht auf Grund der gesellschaftlichen und materiellen Realitäten, sondern an Hand bestimmter Ideen konstruieren zu können. Karl Raimund Popper (1902-94) „findet die philosophischen Grundlagen der Theorie der geschlossenen Gesellschaft in den Werken Platons, insbesondere in der Politeia. Nach Popper sind der Dreh- und Angelpunkt der platonischen Philosophie seine Ideenlehre und sein methodologischer Essentialismus, wonach es die Aufgabe der Philosophie ist, die „wahre Natur“, das „Wesen“ der Dinge zu erkennen. Platon vertritt in der Interpretation Poppers die Meinung, dass die wahre und damit zugleich richtige Natur oder das Wesen einer politischen Gemeinschaft (des Staates) in seiner Urform der Stammesgesellschaft zu finden sei und dass jede soziale Veränderung eine Entfernung aus diesem Zustand und einen Niedergang der Gesellschaft bedeute. Dement-sprechend ergebe sich für Platon als Ziel ein „versteinerter Staat“, wobei als Moralkriterium die Interessen des Staates Vorrang vor allen anderen Überlegungen hätten.
Einer der Gründe für Platons Totalitarismus liegt nach Popper in seiner Verwechslung von In- dividualismus mit Egoismus, dem er den Kollektivismus als Leitbild gegenüberstelle. Dabei schließen jedoch in Wirklichkeit Kollektivismus und Egoismus einander nicht aus, sondern der Altruismus habe als Gegenstück zum Egoismus durchaus auch eine individualistische Komponente. Popper meint, dass Platon durch Hass auf das Individuum und auf die Freiheit zu seinen Vorstellungen kommt, und stellt diesen als Ideale jene des Goldenen Zeitalters der Griechen unter Perikles entgegen, die auch jene der Aufklärung sind: Gerechtigkeit, Gleich- heit, Menschlichkeit, Frieden und Freiheit.
Laut Popper stellt Platon die Frage „Wer soll herrschen?“ in den Mittelpunkt seiner staatsthe- oretischen Überlegungen und beantwortet sie im Sinne eines Führerprinzips. Danach müssten in der Gesellschaft die politischen Führer aus der Führerklasse ausgewählt und sogar „gezüch- tet“ und auch für ihre Aufgabe entsprechend erzogen werden. Herrschen sollten die Philoso- phen-Könige, nach Platon die Experten für die Gerechtigkeit und die Weisheit. Popper ironi- siert diese platonischen Vorstellungen durch die Vermutung, dass Platon sich selbst als einen solchen potenziellen Philosophen-König gesehen habe und dass Allmachtsfantasien oder auch persönliche Erlebnisse Platons (etwa als Berater des Herrschers von Syrakus) in diesen Über- legungen zum Ausdruck kämen.
Popper stellt den Anschauungen in Platons Politeia in seiner Interpretation die Position des (von ihm vermuteten) historischen Sokrates gegenüber, der den Philosophen als einen kriti- tischen Denker und nicht als einen besserwisserischen Experten gesehen habe, und wirft Pla- ton Verrat an Sokrates vor. Die platonische Vorstellung einer Gesellschaft, die von Philoso- phen-Königen regiert wird, bezeichnet Popper als eine perfektionistische Utopie, die auf der fehlgeleiteten Theorie der uneingeschränkten Souveränität des Staates beruhe. Die richtige Frage, und das ist ein zentraler (und unseres Erachtens bleibender) Punkt der Kritik Poppers, soll nicht lauten: „Wer soll herrschen?“, sondern: „Wie können wir politische Institutionen schaffen, so dass schlechte und unfähige Herrscher davon abgehalten werden, allzu viel Scha- den anzurichten?“
Als institutionelle Konsequenz ergibt sich für Popper daraus die Forderung nach Gewalten- trennung, nach den „Checks and Balances“, wie sie sich insbesondere in der angelsächsischen Tradition der Demokratie herausgebildet haben, die Popper aber auch bereits in der atheni- schen Demokratie lokalisiert. Er zitiert dazu Perikles mit seiner Aussage, es könnten zwar nur wenige eine politische Konzeption entwerfen und durchführen, aber alle könnten eine solche beurteilen. Durch diese Aussage sieht Popper die Grundlagen für ein demokratisches Staats- wesen in einer offenen Gesellschaft formuliert, in der durch vernünftige Kritik und Auseinan- dersetzung die Möglichkeit einer öffentlichen allgemeinen Beteiligung am politischen Prozess eröffnet wird.“47
Zu Aristoteles
Zu dessen Glücksethik (Eudämonie) stellt Kant im Wesentlichen folgende Fragen: 1. In welchem Verhältnis stehen das Streben nach Glück und die Praktische Vernunft? 2. Kann der Begriff des Glücks als eines letzten Ziels überhaupt dazu dienen, moralisches Handeln zu er-klären? Dazu schreibt Kant in der Kritik der praktischen Vernunft:
„Das moralische Gesetz gebietet, das höchste mögliche Gut in einer Welt mir zum letzten Gegenstande alles Verhaltens zu machen. Dieses aber kann ich nicht zu bewirken hoffen, als nur durch die Übereinstimmung meines Willens mit dem eines heiligen und gütigen Welt-urhebers, und, obgleich in dem Begriffe des höchsten Guts, als dem eines Ganzen, worin die größte Glückseligkeit mit dem größten Maße sittlicher (in Geschöpfen möglicher) Vollkom-menheit, als in der genausten Proportion verbunden vorgestellt wird, meine eigene Glück-seligkeit mit enthalten ist: so ist doch nicht sie, sondern das moralische Gesetz (welches viel-mehr mein unbegrenztes Verlangen danach auf Bedingungen strenge einschränkt) der Bestim-mungsgrund des Willens, der zur Beförderung des höchsten Guts angewiesen wird.
Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Nur dann, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit dereinst in dem Maße teilhaftig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihrer nicht unwürdig zu sein.
Würdig ist jemand des Besitzes einer Sache, oder eines Zustandes, wenn, daß er in diesem Besitze sei, mit dem höchsten Gute zusammenstimmt. Man kann jetzt leicht einsehen, daß alle Würdigkeit auf das sittliche Verhalten ankomme, weil dieses im Begriffe des höchsten Guts die Bedingung des übrigen, (was zum Zustande gehört) nämlich des Anteils an Glückseligkeit ausmacht. Nun folgt hieraus: daß man die Moral an sich niemals als Glückseligkeitslehre behandeln müsse, d.i. als eine Anweisung der Glückseligkeit teilhaftig zu werden; denn sie hat es lediglich mit der Vernunftbedingung (condito sine qua non) der letzteren, nicht mit einem Erwerbmittel derselben zu tun. Wenn sie aber (die bloß Pflichten auferlegt, nicht eigen-nützigen Wünschen Maßregeln an die Hand gibt,) vollständig vorgetragen worden: alsdann allererst kann, nachdem der sich auf ein Gesetz gründende moralische Wunsch das höchste Gut zu befördern (das Reich Gottes zu uns zu bringen), der vorher keiner uneigennützigen Seele aufsteigen konnte, erweckt, und ihm zum Behuf der Schritt zur Religion geschehen ist, diese Sittenlehre auch Glückseligkeitslehre genannt werden, weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allererst anhebt.
Auch kann man hieraus ersehen: daß, wenn man nach dem letzten Zwecke Gottes in Schöpfung der Welt fragt, man nicht die Glückseligkeit der vernünftigen Wesen in ihr, sondern das höchste Gut nennen müsse, welches jenem Wunsche dieser Wesen noch eine Bedingung, nämlich die der Glückseligkeit würdig zu sein, d.i. die Sittlichkeit eben derselben vernünftigen Wesen, hinzufügt, die allein den Maßstab enthält, nach welchem sie allein der ersteren, durch die Hand eines weisen Urhebers, teilhaftig zu werden hoffen können. Denn, da Weisheit, theoretisch betrachtet, die Erkenntnis des höchsten Guts, und praktisch, die Angemessenheit des Willens zum höchsten Gute bedeutet, so kann man einer höchsten selbständigen Weisheit nicht einen Zweck beilegen, der bloß auf Gütigkeit gegründet wäre.“48
Als Kernsätze dieser Argumentation können gelten:
1. Nicht die Glückseligkeit, sondern Gott ist das „höchste mögliche Gut“ in der Welt.
2. Daher müssen wir versuchen, unseren eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Ein-klang zu bringen.
3. Diesen Einklang kann nur das moralische Gesetz bewirken, auch wenn im Höchsten Gut die eigene Glückseligkeit bereits enthalten ist.
4. „ Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Nur dann, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit dereinst in dem Maße teilhaftig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihrer nicht unwürdig zu sein.“ (s.o., Hervorhebung KR)
5. Die Moral verfügt lediglich Pflichten, sie erfüllt nicht eigensüchtige Wünsche.
6. Nur mit Hilfe der Religion kann Moral Glückseligkeit vermitteln.
Damit erklärt Kant die aristotelische Glücksethik für unzureichend. Dagegen empfiehlt Otfried Höffe, die beiden Ansätze miteinander zu verbinden, und schreibt dazu:
„Strebens- und Willensethik sind zwei Modelle, die je einen Aspekt menschlichen Handelns reflektieren; diese das Setzen, jene das Verfolgen von Zielen. Ein vollständiges Modell menschlichen Handelns ergibt sich erst aus beiden Modellen. Kantische und aristotelische Ethik sind in dieser Hinsicht nicht konkurrierende, sondern korrespondierende Ethiken. Aristoteles und Kant gegeneinander auszuspielen, dem einen oder dem anderen einen Mangel an Reflexion vorzuwerfen, führt kaum weiter. Sinnvoll dagegen ist es, beide Ethiken anein-ander zu messen, die ihnen zugrunde liegenden unterschiedlichen Interessen zu erkennen und ein Modell menschlichen Handelns zu suchen, das in der Vermittlung von Strebens- und Wi-lensethik beide Interessen vereint.“49
Zu Epikur:
Wohl schon zur Römerzeit, und erst recht im Christentum, wurden die Anhänger Epikurs, die Epikureer, als ‚porci Epicuri‘, als „Epikur-Schweine“, beschimpft. Was natürlich den Tatbe-stand der Verleumdung erfüllt, denn Epikur befürwortete ja gerade nicht Ausschweifung und hedonistische Zügellosigkeit, sondern vernünftige Überlegung über „die Grenzen der Freude“, und zwar auf Grund klarer Unterscheidung zwischen notwendigen, nützlichen und schäd-lichen Begierden. Wobei ihm Eros und Sexualität eher als willkommene Nebensachen galten und keineswegs die Bedeutung hatten, die ihnen später u.a. Sigmund Freud zubilligte. – Auch das Arbeiten hielt Epikur für eine Nebensache, allerdings eine unangenehme, zu mühsame, lästige, beschwerliche. Finanzierung des Lebensunterhalts war auch anders möglich, notfalls immer weiter durch Eltern, Verwandte und Bekannte. Hauptsache, das Privatleben, der „Gar-ten der Lust“, wohin Epikur sich zurückzog, wurde nicht unnötig gestört oder beeinträchtigt. Ein Rückzug – auch von allen Ämtern und vom öffentlichen Leben –, den er mit negativen Politik-Erfahrungen begründete; dies auch im Gegensatz zu Plato, der den Philosophen emp-fahl, Regierungsbefugnisse zu übernehmen. –
Als verkürzend und unzureichend erscheint Epikurs Darstellung des Todes-Problems, zu dem er nur bemerkt: „Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr.“ Folglich sei der Tod „für uns ein Nichts“ (s.o.). Dagegen haben zahlreiche andere Denker versucht, der hohen Komplexität des Todes-Problems gerecht zu werden, so z.B. Walter Schulz 1992, S. 125-174.
Eine originelle Interpretation des Epikureismus findet sich bei Matthias Gronemeyer, Autor u.a. eines Buches über ‚vögeln. Philosophie des Sex‘. Er schreibt unter dem Titel ,Epikur Auf dem Weg in die Sanatoriumsgesellschaft‘ (2014):
„Politik muss beargwöhnt werden
Die Sanatoriumsgesellschaft ist eine genuin apolitische Gesellschaft. Politik, als die gemein-schaftliche Verständigung über kollektive Ziele wird vom Epikureismus als unnötig, um nicht zu sagen: Überflüssig betrachtet. Vom medizinisch-naturwissenschaftlichen Standpunkt muss Politik immer beargwöhnt werden, ja das Denken an sich, weil es immer eine Gefahr für das finalistische, das selbstzweckhafte System des Wohlbefindens bedeutet. Selbständiges Denken wäre ein Einfallstor für Zufall, Kontingenz, Irregularität und Unbestimmtheit der Natur. Epikur schreibt:
„Zu beherzigen gilt es denn, was Wohlbefinden verschafft; denn ist es anwesend, haben wir alles, ist es abwesend, tun wir alles, damit wir es haben.“
Dieser Satz Epikurs könnte als Motto über jedem Sanatoriumsportal hängen, dessen Bewohner ihn mantrahaft zu wiederholen haben. Es darf nur das gedacht werden, was die Gesetze der Gesundheitswissenschaft nicht infrage stellt. In ihrem Dogmatismus verkehrt sich die Naturerkenntnis so zu einem Naturbekenntnis und bekommt auf diese Weise Züge des Christentums. So, wie man vom Christen das Bekenntnis zur Auferstehung verlangt, verlangt man vom Epikureer das Bekenntnis zur Gesundheit.
„Es besorgen sich manche ihr Leben lang die Mittel zum leben“,
... spottet Epikur über die Berufstätigen, die Geld verdienen, um sich etwas leisten zu können. Die Ökonomie, das heißt, begrenzte Mittel zu einem flüchtigen Zweck einzusetzen, sein Leben der Tretmühle der Arbeit zu opfern, verträgt sich schlecht mit der Lehre des Finalismus. Arbeit ist sequenziell, die Dinge, derer sie sich bedient, sind Bedingendes und Bedingtes zugleich; Wohlbefinden hingegen ist final, selbstzweckhaft. Die Mühen der Arbeit sind zudem oft der Gesundheit abträglich. So konstruiert Epikur einen Antagonismus von Erwerbstätigkeit und Wohlbefinden:
„Ein freies Leben vermag nicht viel Geld zu erwerben, weil die Sache nicht leicht ist ohne Knechtsdienst beim Pöbel oder den Mächtigen.“
Epikur lässt sich immer wieder Geld von seinem Vater schicken, Hans Castorp von seinem Onkel in Hamburg. Die Frage nach der Bestreitung des Lebensunterhalts ist im Epikureismus nachgerade häretisch.
Epikurs Gärten sind keine Gärten der Lüste, insbesondere nicht der sexuellen.“50
Und zu den Auffassungen von Hegel und Adorno heißt es:
„Das Individuum, das nach Epikur „im Verborgenen leben“ sollte, wäre von Hegel ein abstraktes Individuum genannt worden, ein rein Für-sich-Seiendes, ohne jede Beziehung auf die gesellschaftliche, ökonomische, auch psychologische Objektivität. (HegelVsEpikur). Ethik/Hegel/Adorno: Für Hegel war die Norm eines richtigen Lebens, Bürger eines guten Staates zu werden.“51
Zu den Sophisten
schreibt Anna Schriefl:
„Die Sophisten genießen kein hohes Ansehen. Dem gängigen Bild zufolge unter-richteten sie politisch ehrgeizige junge Männer gegen hohe Bezahlung, vertraten einen ethischen Relativismus oder Amoralismus, entwickelten Scheinargumente und waren eher an Publikumserfolg als an echter Erkenntnis interessiert. Der Vorwurf, ein Argument sei sophistisch, bedeutet noch heute, es basiere auf rhetorischen Tricks. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es vermehrt Versuche, die Sophisten zu rehabilitieren. Für ihren schlechten Ruf, so heißt es seit Hegel, sei vor allem Platon verantwortlich. Er habe sie als fragwürdige Geschäftsleute mit unsympathischen Positionen und windigen Argumenten dargestellt, weil sie seine stärkste Konkurrenz waren. Tatsäch-lich hätten sie jedoch eine wichtige intellektuelle Bewegung begründet, ohne die Platons Philosophie nicht hätte entstehen können.“52
Und Barbara Zehnpfennig stellt (a.a.O.) fest:
„Warum waren die Sophisten Platon nun so wichtig, und was war das Falsche in ihrem Denken? Sie reagierten auf die Mängel der Philosophie vor ihnen und schienen damit die bestehenden Desiderate zu beheben. Der Objektivismus der Naturphilosophie übersah das erkennende Subjekt; der Rationalismus der Eleatik verlor seinen Bezug zum Gegenstand. Die Sophistik schien beides auszugleichen, verfiel aber in das Gegenextrem. Ihr Subjektivismus löste alles in Beliebigkeit auf, ihr Empirismus ignorierte den rationalen Anteil des Erkennens. Weder Objektivismus noch Subjek-tivismus, weder Rationalismus noch Empirismus, so die sokratisch-platonische Einsicht, konnten genügen. Dass die Lösung auf einer ganz anderen Ebene gesucht werden muss, als bisher gedacht wurde, zu dieser Einsicht wäre Platon ohne die Sophistik wohl nie gekommen.
Sie musste als Stufe überschritten werden. Das erforderte aber äußerste rationale Durchdringung. Die argumentativen oder logischen Fehler, die Platon dabei angeblich machte, weise man erst einmal nach! Oder man beweise positiv: dass der Rhetor von seinem Gegenstand nichts verstehen muss (Gorgias); dass der Stärkere aufgrund seiner Stärke auch im Recht ist (Thrasymachos); dass Erkenntnis Wahrnehmung ist (Protagoras); dass das Recht nur eine Funktion des Überlebens ist (ebenfalls Protagoras) usw.
Was an den Beispielen sichtbar wird, ist die Nähe des sophistischen Denkens zu unseren Alltagsmeinungen, aber auch zu deren philosophischer Überhöhung. Mit Protagoras kann man gut behaupten, dass alles relativ ist, bzw. man vertritt philosophisch den Konstruktivismus. Mit Protagoras lässt sich ebenfalls die Meinung vertreten, den Staat brauche man nur, weil man sich sonst wechselseitig den Schädel einschlagen würde; in der philosophischen Fassung wäre das der Kontraktualismus. So ließe sich noch Vieles finden, was uns ganz nahe ist, obwohl es aus der Antike kommt.
Ist diese Nähe der Grund, weshalb wir Platons Widerlegung der Sophistik immer wieder unter Verdacht stellen – den Verdacht, hier gehe es nicht mit rechten Dingen zu? Möglicherweise wollen wir selbst ja nicht von Platon widerlegt werden. Wenn er aber darin recht hat, dass die Befreiung vom Irrtum die größte Wohltat ist, die man einem Menschen erweisen kann, sollten wir uns die Widerlegung vielleicht doch gefallen lassen.“
Zur Stoa
„ 17. Stoiker sollen sich wie Fußmatten verhalten und alles nehmen, was andere ihnen zuwerfen.
Die Akzeptanz des Unvermeidlichen ist sicherlich ein stoisches Merkmal. Aber die Sache muss wirklich unvermeidlich oder nicht wichtig genug sein. Wenn wir echte Verletzungen - für uns selbst oder für andere - vermeiden können, sollten wir dies tun. Wenn wir in der Lage sind, andere zu erziehen, sollten wir es tun. Aber der Kampf gegen Windmühlen ist etwas Besseres, das Don Quijote überlassen bleibt.
18. Stoizismus ist ein einsames Streben.
Bis zu einem gewissen Grad ist dies wahr. Ethische Selbstverbesserung ist etwas, das vom Einzelnen getan werden muss, sie kann nicht von oder anderen auferlegt werden.
Kategorie: Selbst gegen Soziales
19. Stoizismus ist eine egozentrische Philosophie.
Eines der grundlegendsten stoischen Konzepte ist das des Kosmopolitismus, die Vorstellung, dass alle Menschen unsere Mitschwestern und Brüder sind. Ein verwandter Begriff ist der der Philanthropie, der Liebe zur Menschheit. In der Tat erkennen Stoiker keine scharfe Unterscheidung zwischen sich selbst und anderen: Wenn wir uns verbessern, helfen wir der Kosmopole, wenn wir anderen helfen, verbessern wir die Dinge für uns.
20. Stoizismus ist eine persönliche Philosophie, die zu sozialen Themen nichts zu sagen hat.
Ja und nein. In der Tat ist der Stoizismus eine Philosophie der ethischen Selbstverbesserung, wie der Buddhismus oder das Christentum. Aber sein Kosmopolitismus und die Tatsache, dass eine der vier Haupttugenden die der Gerechtigkeit ist, implizieren, dass sich Stoiker mit sozialen Fragen befassen sollten. Der Stoizismus unterstützt jedoch nicht direkt eine bestimmte politische Haltung oder Sozialphilosophie. Es ist mit einer Reihe solcher Positionen vereinbar, solange wir virtuos handeln und die Philanthropie im Auge behalten.
Kategorie: Theorie
21. Warum sollte man dem Stoizismus folgen und sich strikt an eine bestimmte Philosophie halten, anstatt vielseitig zu sein und das Beste aus verschiedenen Traditionen herauszuholen?
Der Stoizismus selbst wurde als vielseitige Philosophie geboren, da Zeno of Citium bei einer Reihe von Lehrern verschiedener Schulen studierte. Das Problem mit dem Eklektizismus ist jedoch, dass er sorgfältig durchdacht werden muss, oder es besteht die Gefahr, dass er in eine Ansammlung von Rationalisierungen gerät, in denen man auswählt, was der Stimmung des Augenblicks entspricht. Auch der Stoizismus ist keine starre, sondern eine sich ständig weiterentwickelnde Philosophie. Seneca sagt ausdrücklich, dass unsere Vorgänger nicht unsere Meister sind, sondern nur unsere Lehrer. Wenn wir neue und bessere Wege finden, Dinge zu tun, sollten wir es tun.
22. Wir kontrollieren unsere Gedanken nicht, daher ist Epictetus in Bezug auf die Zweiteilung der Kontrolle falsch.
Epictetus war sich vollkommen bewusst, dass ein Großteil unseres geistigen Lebens nicht unter unserer Kontrolle steht. Wenn es jedoch etwas gibt, das definiert, wer Sie sind, dann sind dies Ihre eigenen absichtlichen Urteile und ausdrücklich bestätigten Meinungen. Und diese, die ein Produkt Ihres Bewusstseins sind, sind wirklich das einzige, was Sie vollständig kontrollieren können.
23. Der Stoizismus setzt eine starke Vorstellung vom Selbst voraus, aber das Selbst ist eine Illusion.
Stoiker sind keine Essentialisten über das Selbst. Sie glauben nicht, dass es eine Essenz gibt, die wir sind und die unseren Tod überlebt (eine „Seele“). Vielmehr ist das stoische Selbst mit der buddhistischen Version kompatibel: Es ist ein dynamisches System, das unsere sich ständig ändernden Erinnerungen, Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensveranlagungen usw. umfasst. Der kleine Teil eines solchen Selbst, der bewusst unter unserer Kontrolle steht, unsere Urteilsfähigkeit, ist - für die Stoiker - wer wir letztendlich wirklich sind.
24. Stoizismus ist inkohärent, da die Stoiker uns sagen, wir sollten uns verbessern und gleichzeitig Deterministen des freien Willens sein.
Stoiker sind zwar Deterministen, in dem Sinne, dass sie glauben, dass alles aufgrund von Ursache und Wirkung geschieht. Aber wir sind Teil des Kausalnetzes des Universums. Wir sind keine passiven Marionetten, deren Fäden von den Naturkräften bewegt werden, wir sind aktive, integrale Elemente der Natur. Wir können uns verbessern, weil die Vernunft eine rekursive Fähigkeit ist: Sie kann im Laufe der Zeit auf sich selbst angewendet werden. Wenn es hilft, stellen Sie es sich als einen Computeralgorithmus vor, der sich aufgrund seiner eigenen Bewertung seiner Funktionsweise als Reaktion auf interne und externe Eingaben teilweise selbst umschreiben kann.“53
Zum Skeptizismus
„Skeptizismus
Philosophische Denkrichtung, die der Auffassung ist, dass Wahrheit und sicheres Wissen unerreichbar sind und man daher eine kritische Haltung hinsichtlich aller dogmatischen Ansichten einnehmen muss, indem man sie kritisch prüft (skeptikós bedeutet im Griechi-schen: „jemand, der zweifelt, überprüft“). Begründet vom Griechen Pyrrhon von Elis („Pyrrhonismus" ist deshalb die Bezeichnung für eine Variante des Skeptizismus, entfaltet der Skeptizismus ein ganzes Arsenal von logischen Gegenargumentationen (wie zum Beispiel der infinite Regress oder der Zirkelschluss, petitio principii), um jede Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Diese Geisteshaltung darf nicht mit derjenigen der Sophisten verwechselt werden, denn die Forderung nach einer Enthaltung des Urteils (epochè) hat bei den Skeptikern eine moralische Bedeutung: sie lädt dazu ein, eine indifferente Haltung (adiaphora) einzunehmen, um keine Sache zulasten einer anderen zu bevorzugen. Ein echter Skeptiker ist also jemand ohne Meinung (adoxastous), ohne Neigung (aklinesis) und ohne Erregung (akradantous). Ein solcher Skeptizismus findet sich auch im Buddhismus, dort vor allem bei N?g?rjuna. In der Renaissance wird er wiederbelebt von Montaigne, der die Frage: „Was weiß ich?“ zu seinem Leitgedanken macht. Pascal hingegen kritisiert den Pyrrhonismus, weil er in ihm ein Hindernis für den Glauben sieht, obwohl er ihn andererseits für nützlich hält, um die Anmaßungen des Rationalismus herabzusetzen, alles wissen zu wollen. Hume nimmt ihn an, aber in einer gemäßigten Art: sein abgeschwächter Skeptizismus erlaubt es ihm einerseits, logische Irrtümer und Auswüchse der Vorstellungskraft anzuprangern, andererseits aber auch, den Phänomenen des praktischen Lebens nach gesundem Menschenverstand Glaubwürdigkeit zuzubilligen (so wäre es beispielsweise absurd, in einem Brand unbeweglich zu bleiben, weil die Möglichkeit besteht, dass die Flammen gar nicht wirklich existieren). Heutzutage vertritt Williams den Skeptizismus in der Moralphilosophie und behauptet, dass moralische Dilemmata nicht rational lösbar seien.“54 – Nicht zu vergessen ist Descartes‘ methodischer Zweifel, der auch bei der Entstehung des ‚Cogito ergo sum‘ eine Rolle spielte. –
Übrigens: Eine Devise von Karl Marx lautete: ‚De omnibus dubitandum‘ (an allem ist zu zweifeln).
Zu Jesus: Verzerrungen und Fehlentwicklungen im Christentum55
Schon bei Mose heißt es, das „Dichten des menschlichen Herzens“ sei „böse von Jugend auf“ (1. Mose 8, 21). Und auch die Story von Adams „Sündenfall“ liegt den Vorstellungen von der „Erbsünde“ (so bei Augustinus, Paulus, Luther u.a.) zu Grunde. Wobei dem Apostel Paulus zugute zu halten ist, dass er nicht von biologischer Vererbung der Sünde spricht, sondern davon, dass die Menschen, da sie der „Fleischeslust“ nachgeben, immer wieder der Sünde zu verfallen drohen.
Dies alles erklärt aber nicht die bekannten schwerwiegenden Fehlentwicklungen, zu denen es in der Geschichte des Christentums gekommen ist, darunter Exzesse wie die Kreuzzüge und andere Religionskriege, die Inquisition, die Verfolgung von Juden, „Hexen“ und „Ketzern“, Frauen- und Leibfeindlichkeit, Kindesmissbrauch u.a.m. Für höchst bedenklich und gravierend halte ich allerdings die Tatsache, dass schon bedeutende Kirchenlehrer („Kirchenväter“) wie Augustinus (354-430) in ihren Schriften solche Methoden gerechtfertigt haben.
Der Civitas Dei („Gottesstaat“ bzw. „Gott-Gemeinschaft“) stellt Augustinus den „Erdenstaat“ gegenüber, den er auch als ‚Civitas diaboli‘, Staat des Teufels, bezeichnet. Getreu dem Vorbild Platons rechnet er seinen Gottesstaat dem „Ideenhimmel“ zu, der folglich zunächst nur in den Köpfen von Menschen existiert, genauer: in den Köpfen von Christen, die Augustinus nacheifern. Da ihm die christliche Liebe als einer der höchsten Werte gilt, kann der Kirchenvater die beiden „Staaten“ gemäß zwei Arten des Liebens unterscheiden: „ der irdische durch Selbstliebe, die sich bis zur Gottesverachtung steigert, der himmlische durch Gottesliebe, die sich bis zur Selbstverachtung erhebt“.56 Kirche und weltlicher Staat ent-sprechen den beiden Reichen in äußeren Erscheinungsformen, doch nicht wenige Menschen gehören beiden Reichen an, die sich somit teilweise überschneiden und durchdringen. Geschichtlich setze sich dieses Zusammenleben fort, bis am Ende der Zeiten die Trennung erfolge, aus welcher der Gottesstaat dann als Sieger hervorgehen werde.
Martin Luther (1483-1546) scheint in mehrfacher Hinsicht voreingenommen und befangen zu sein, und zwar sowohl durch seine Buchgelehrsamkeit und Buchstabengläubigkeit als auch durch seinen unerschütterlichen Glauben an Autoritäten wie Paulus und Augustinus. Umso erstaunlicher ist der Wertewandel, den er durch seine Reformation bewirkt hat. Dieser Wandel ist kaum überschaubar und nur an Hand einiger exemplarischer Themen und Problemstellungen darstellbar. Was nichts an der Tatsache ändert, dass einige der Lutherschen Wertungen bis heute umstritten oder sogar negativ zu beurteilen sind. So seine teilweise abschätzigen Bemerkungen über Frauen, seine äußerst polemischen, hasserfüllten Ausfälle gegenüber den Juden und ähnlich negativ gefühlsbeladene Angriffe auf die Bauern, die für ihr Recht eintraten und in blutigen Kriegen gegen die Obrigkeit kämpften. – In all diesen üblen Abwertungen konnte Luther sich allerdings sogar auf Bibelstellen oder auch auf sogenannte „Kirchenväter“ wie Augustinus oder auf Kirchenlehrer wie Thomas von Aquin berufen. –
Nicht berufen fühle ich mich, nicht-christliche Religionen zu kritisieren, zumal ich selbst keiner nicht-christlichen Religionsgemeinschaft angehöre. –
C) Renaissance-Humanismus
Umstritten ist, ob es zwischen Mittelalter und Renaissance eine Kontinuität der Entwicklung oder einen Bruch, eine klare Zäsur, gegeben hat. Als typische Aspekte können jedenfalls die folgenden herausgestellt werden:
1. Bei der Renaissance (= ‘Wiedergeburt‘) handelt es sich nicht einfach um eine „Wieder-geburt der Antike“, sondern um eine „Neugeburt“.57 2. Ein neues Weltbild wird geboren: das, gegen den Widerstand der Kirche, heliozentrische (kopernikanische), das an die Stelle des geozentrischen (ptolemäischen) tritt. 3. Giordano Bruno (1548-1600) behauptet, im Gegen-satz zur katholischen Dogmatik, die Unendlichkeit des Alls. 4. Vorrang hat nicht mehr die Beziehung zwischen Gott und der Welt, sondern die zwischen dem Ich und der Welt. 5. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt des Interesses. „Centro dell’universo è l’uomo, individuo razionale“ (‚Zentrum des Universums ist der Mensch, ein vernünftiges Individuum“), erklärt Poggio Bracciolini (1380-1459). 6. Ausschlaggebend wird das Handeln: „Für die Tätigkeit ist der Mensch geschaffen, und der Nutzen ist seine Bestimmung“, sagt der Baumeister und „Universalmensch“ (uomo universale) Leon Battista Alberti (1404-1472) (zitiert bei Bloch a.a.O. ebd.). Der homo faber, der tätige, arbeitende Mensch ist „einer, der sich seiner Arbeit nicht mehr schämt“ (Bloch ebd.). 7. Neben dem Handwerk entstehen neue Formen der Warenproduktion, z.B. in Manufakturen, und dadurch ein neuartiges, frühkapitalistisches Geld- und Wirtschaftssystem, wozu in Italien Pionierarbeit geleistet wird. (Vgl. Bloch a.a.O. S, 175 f.) 8. Durch den Fall von Konstantinopel an die Osmanen (1453) und die dadurch verursachte Flucht byzantinischer Gelehrter nach Oberitalien wird das Studium der Antike (Originaltexte, Kunstwerke usw.) neu belebt. 9. Philosophie (z.B. in der neugegründeten platonischen Akademie von Florenz), Wissenschaft und Kultur kommen zu neuer, nie zuvor gekannter Entfaltung, bis hin zu Gipfelleistungen wie dem Welt-Personen-Theater eines William Shakespeare (1564-1616). Nicht weniger hochrangig sind Künstler- und Denker-Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo, Botticelli, Brunelleschi, Pietro Aretino, Machiavelli, Savonarola und Lorenzo de‘ Medici (il Magnifico). 10. Humanismus und Universalität (die Vielseitigkeit des ‚uomo universale‘, des Universal-genies) verbünden sich. 11. Was man heute „Globalisierung“ nennt, bereiten Kolumbus und Weltumsegler wie Magellan und Vasco da Gama durch ihre Entdeckungen vor.58
Worin aber besteht der Humanismus im Zeitalter der Renaissance? Zuweilen wird übersehen, dass die Renaissance in Italien nicht erst nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453, sondern schon im Mittelalter begann bzw. vorbereitet wurde, und zwar nicht zuletzt von Dichtern wie Dante, Petrarca und Boccaccio und Künstlern wie Giotto. Diesen voran liegen aber die Anfänge der italienischen Literatur zu Beginn des 13. Jahrhunderts, nämlich in der Sizilianischen Dichterschule, in deren Werken erstmals das ‚volgare‘, die altitalienische Volkssprache, und nicht mehr das Lateinische, verwendet wurde. Dies kann nicht hoch genug eingeschätzt werden; denn hier kommt zum Tragen, dass der Mensch seine ‚humanitas‘ vorzüglich im Gebrauch seiner Muttersprache findet, die es ihm in der Dichtung ermöglicht, Phantasie, Erfindungsgeist und Realismus in immer neuen Synthesen miteinander zu verbin-den. Sprache macht von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch. – In einem Internet-Artikel ist zu lesen:
„Vorläufer der Renaissance-Kunst war die Literatur und Philosophie. In beiden Bereichen bezeichnet man die Epoche als Renaissance-Humanismus.
Sizilianische Dichterschule und Dolce Stil novo
Zur Stauferzeit Siziliens etablierte Friedrich II. dort eine Dichterschule.
Die Sizilianische Dichterschule bestand zwischen 1220 und 1250 und widmete sich einer Neuausrichtung des Lyrischen Ichs. Dies veränderte die Literatursprache dahingehend, dass ins klassische Literaturlatein eine volkssprachliche Tendenz (lingua volgare) einzog. Von Sizilien ausgehend breitete sich der neue Sprach- und Schreibstil nach Norden aus und mündete in den „Dolce Stil novo“.
Anhänger des Stils forderten eine neue Lebensnähe. Der Mensch wurde als nobles Geschöpf beschrieben. Die noble Gesinnung eines Menschen wurde mit dem Wort Herzensadel ausgedrückt. Dieser Herzensadel stand im klaren Gegensatz zum Blutadel (Erbadel). Der Dolce Stil novo gilt als Vorbereiter des Humanismus und der Renaissance.“59
Ein Beispiel findet sich in der folgenden ersten Strophe der Kanzone ‚ Donna me prega ‘ von Guido Cavalcanti (ca. 1260-1300), in der Übersetzung von Manfred Hardt:
„Eine Frau bittet mich – und darum will ich handeln
von einem Akzidens, das oft grausam ist
und unerbittlich – Liebe wird es genannt:
wer das leugnet, möge die Wahrheit hören!
Und jetzt verlange ich einen Kenner der Materie,
denn ich kann nicht hoffen, daß ein Mensch von gemeinem Herzen
meinem Thema Verständnis entgegenbringen kann:
Denn ohne philosophisch-naturwissenschaftliche Argumentation
sehe ich mich nicht imstande, zu erörtern
wo die Liebe ihren Sitz hat, wodurch sie entsteht,
welches ihre Wirkungskraft und ihre Potenz sei,
welches ihre Essenz sodann und jede ihrer Reaktionen,
und welches der Genuß, der macht, daß man sie Liebe nennt,
und ob man Liebe gestalthaft sehen und zeigen kann.
An einer Stelle, wo das Gedächtnis sitzt,
hat sie ihren Entstehungsort und ihre Bleibe “
Die ganze Kanzone resümierend stellt Manfred Hardt fest:
„Die Wirkungen der Liebe ziehen oft den Tod nach sich (»Di sua potenza segue spesso morte.«). Liebe und Tod in Beziehung zu setzen, war zu Guidos Zeiten nichts Neues, stellte doch eine verbreitete pseudo-etymologische Erklärung eine Verbindung zwischen »a-more« und »a morte« (»zu Tode«) her. Dennoch verbirgt sich hinter diesem Satz der spezifische Grundgedanke der Liebestheorie Cavalcantis: Liebe ist, im Unterschied zur Auffassung Guinizellis und anderer Stilnovisten, keine göttliche, von oben herabstrahlende, läuternde Kraft, sondern im Gegenteil eine Trübung und Schwä-chung des menschlichen Bewußtseins, die zum Tode führen kann.“60
Nichtsdestoweniger entsteht schon im mittelalterlichen Italien eine neue Begeisterung für die ‚humanitas‘, die Menschlichkeit, das Mensch-Sein schlechthin. Bei dem Maler Giotto (ca. 1266-1337) beginnt (fast) alles mit einem Blick – oder mehreren Blicken, die von gemalten Personen ausgehen und dem Betrachter gelten. Ein Ich spricht zum Du – Grundlage eines neuen Personalismus, ja, eines neuen Menschenbildes. Erstmals malt hier einer Personen so, wie sie wirklich aussehen: Ein klarer Bruch mit der mittelalterlich-byzantinischen Tradition der Malerei, in der – in zwei-dimensionaler Darstellung – fast alle Figuren gleich aussehen und gleich groß sind. Anscheinend als erster experimentiert Giotto mit der Perspektive.61August Buck erörtert folgende Neuerungen: „Das Neue an Giottos Malerei, wie sie in seinen Hauptwerken, den Fresken der Arena-Kapelle in Padua und der thronenden Madonna der Uffizien zum Ausdruck kommt, ist die Übersichtlichkeit der Komposition und die Monumen-talität seiner Gestalten, die sich als Menschen an den Betrachter wenden. Während das mittelalterliche Bildnis bis dahin nur mit Gott, nicht aber mit dem Betrachter rechnete, wird dieser jetzt zum erstenmal vom Künstler angesprochen.“62–
Aufschlussreich und wegweisend scheint außerdem der Hinweis, dass Giotto nicht nur ein engagierter Künstler, sondern auch ein überaus tüchtiger und erfolgreicher Geschäftsmann war: „Er war ein cleverer Geschäftsmann und vermarktete sich als Superstar, der von reichen Bürgern, Königen und Päpsten umschwärmt wurde – während vor ihm Maler als schlichte Handwerker galten und sehr oft anonym blieben.“ (s.u. Fußnote 61 ebd.)
Giotto repräsentiert ein neues „Persönlichkeitsbewusstsein“ (Buck); sein Mensch ist Person als Ich und Du, er wird Persönlichkeit als aktiver, schöpferisch tätiger Mensch, als ‚homo faber‘, der seine Fähigkeiten möglichst allseits entwickelt.63
Dass auch Dante Alighieri (1265-1321) als früher „Renaissance-Mensch“ angesehen wird, mag überraschen, da er weithin als „typisch mittelalterlich“ gilt. Aber: Auch und gerade in der ‚Göttlichen Komödie‘ beschreibt er detailliert nicht nur das Jenseits, sondern – geradezu akribisch – auch das Diesseits. Hierzu fragt Johannes Haller (1954):
„Was ist es, das ihn zu solchem Werk befähigt hat? Was gab ihm die Kraft, mit so eindringlicher Gewalt von Dingen zu reden, die kein anderer nur annähernd so hätte darstellen können? Was macht ihn zum größten Dichter aller Zeiten? Nicht nur die Phantasie, so stark sie ist, noch weniger das Wissen, das durch-dachte, so groß sein Anteil sein mag. Die letzte Ursache seiner überragenden Größe ist die gewaltige Persönlichkeit, diese geheimnisvolle, nie zu ergründen-de noch zu bestimmende Macht. Hinter dem Dichter und Gelehrten und über ihm steht der Mensch.
Und wenig später fügt Haller hinzu:
„Was wir an Dante, dem Menschen, am meisten zu bewundern haben, ist nicht der Geist, nicht die Dichtergabe noch der Fleiß des Studiums, es ist der Charakter, der Wahrheitsmut und die innere Festigkeit. Was gehörte nicht dazu, in einer Welt, in der alles von Parteiung und Parteinahme lebte, der Partei den Rücken zu kehren, auf jeden Anschluß zu verzichten und seinen eigenen Weg allein und unbeirrt zu gehen!“
Und nichtsdestoweniger räumt Haller schließlich ein:
Fast scheint es, als könne der Dichter keinen Vorgang schildern, ohne dass ihm ein Bild oder Vergleich einfällt. Seine visionäre Veranlagung, die sich in seiner Jugend deutlich äußerte, hat sich mit den Jahren und mit zunehmender Kenntnis der umgebenden Welt zur dichterischen Eingebung geklärt und gefestigt. Weil er das, wovon er erzählt, im eigenen Geist gesehen hat, kann er es mit so hinreißender An-schaulichkeit wiedergeben. Freilich wäre ihm das nicht möglich ohne seine vollendete Beherrschung der Sprache. Ihre Register stehen ihm alle zur Verfügung, vom zartesten Gefühlston der Naturschilderung und Seelenregung bis zu blutiger Ironie und brutaler Härte der Verachtung, von schlichter Erzählung bis zum donnernden Pathos der Entrü-stung. Wer wäre imstande, die ganze Tonleiter dieser Schönheiten zu notieren!“64
Sprachliche und dichterische Virtuosität, Persönlichkeit, Charakter, Wagemut, Wahrheits-liebe und innere Festigkeit sind demnach die herausragenden Merkmale von Dantes ‚humanitas‘, seiner Menschlichkeit.
Petrarca (1304-1374)
Francesco Petrarcas erstaunliche Wendung nach innen vollzieht sich während einer Berg-wanderung zum Mont Ventoux in der Provence, einer Tour, die er im Jahre 1336 in Beglei-tung seines Bruders Gherardo unternimmt. Inmitten einer herrlich blühenden Frühlingsland-schaft hält der Dichter plötzlich an und wird nachdenklich. Er greift zu seinem Buch der ‚Konfessionen‘ des Augustinus, das er mit sich führt. Was er liest, scheint wie auf ihn persönlich zugeschnitten: Die Menschen bewundern alles Mögliche, hohe Berge, Meeres-wogen, den unendlich weiten Ozean, den noch weiteren Sternenhimmel; aber um sich selbst kümmern sie sich nicht.65 Und Petrarca findet Augustins Satz: „Noli foras ire “ (‚Geh‘ nicht hinaus, in Dir selbst wohnt die Wahrheit!‘). Von diesem Zeitpunkt an kennt der Dichter keine bessere Beschäftigung als die mit dem eigenen Seelenleben, dem eigenen Ich. Was aber nicht ohne heftige innere Kämpfe und Selbstzweifel vonstatten geht. Geradezu furchterregend werden ihm die eigenen Schwächen bewusst, insbesondere der Hang zum Rückzug von der Welt – 16 Jahre verbringt er in der Waldeinsamkeit von Vaucluse – und zum Problem wird ihm sein Schwanken zwischen Sinnenfreuden (zwei uneheliche Kinder!) und frommer As-kese. Als Verfehlung, als eines Christenmenschen unwürdige Verirrung, erscheint ihm nach-träglich auch die Tatsache, dass er sich in ein poetisches Abenteuer gestürzt hat, indem er für Donna Laura, eine verheiratete Frau, die er nur von flüchtigem Sehen her kennt, 1200 Liebes-Sonette verfasst hat: 600 zu ihren Lebzeiten und 600 nach ihrem Tode.
Und doch nimmt er teilweise das vorweg, was nach 1453 die „eigentliche“ Renaissance auslöst: die Wendung zum Ich und, nicht zuletzt: die Wiederbelebung des Studiums der Antike, so durch die Kommentierung und Herausgabe kaum noch gekannter Texte antiker Autoren wie die des Stoikers Cicero. Sie helfen ihm dabei, einen neuen Humanismus zu begründen. Nicht mehr bestimmen ihn die scholastischen Abstraktionen, sondern poetische Einfühlung, subtile Psychologie, Betonung der Fähigkeiten des Menschen, ohne Leugnung seiner Schwächen. Glück sucht und findet er, im Sinne von Stoikern wie Seneca und Cicero, nicht in Äußerlichkeiten, sondern im Person-Sein des Menschen.
Welche Vielgestalt und Vielseitigkeit dem Renaissance-Menschen des 15. und 16. Jahr-hunderts zur Verfügung stehen wird, lässt sich auch an Hand der Werke von
Giovanni Boccaccio (1313-1375)
bereits vorausahnen. Humor, Ironie, Phantasie und schier grenzenloser Realismus durch-ziehen sein Werk, das auch vor der Sexualität nicht haltmacht, dabei jedoch nicht – das seinerzeit weit verbreitete – derbe Sich-Ausleben, sondern feinfühlige Erotik, durchweg in weit gespannten Lebenszusammenhängen, darstellt. In seinem ‚Decamerone‘ und anderen Werken nimmt Boccaccio vieles von dem vorweg, was spätere Universalgenies wie Leon Battista Alberti (1404-72) und Leonardo da Vinci (1452-1519) verkörpert haben. Alberti ist bereits ein echter ‚uomo universale‘, zumal er außerordentliche Geistesgaben mit ungewöhn-lichen körperlichen Vorzügen und Fähigkeiten verbindet. Leonardo war nicht nur Maler, Dichter und Denker, sondern auch Athlet (Fechter, Springer), Bildhauer, Architekt, Ingenieur, Musiker, Kantor, Instrumentenbauer, Anatom, Astronom, Mathematiker und Naturforscher.
Wodurch aber kam der Humanismus in der Renaissance-Zeit, d.h. nach 1453, zum Durch-bruch? Vor allem wohl durch den mächtigen Bildungsschub, den der Zustrom byzantinischer Philosophen und Gelehrter in Oberitalien auslöste. Dazu schreibt H. Müsse (a.a.O.):
„Bereits im 15. Jahrhundert besteht ein Selbstverständnis gebildeter Kreise, die sich als /humanistae/ begreifen und so bezeichnen, also als Humanisten. Der Begriff /humanista/ taucht zum ersten Mal 1490 in einem volkssprachlichen Brief auf (Olaf Meynersen: Humanismus als immer wiederkehrendes europäisches Kulturprinzip, in: Gymnasium 101 (1994), S. 148 ff. mit Zitaten aus Originalen des Archivio di Stato, Florenz, und der Biblioteca Communale di Cesena). Er bezeichnet die Gräzisten, Latinisten, Dichter und Redner, die sich den /studia humanitatis/ widmen und Cicero sowie Quintilian besonders in der Rhetorik als Vorbilder betrachten. Die humanistische Redekunst gewinnt aber nur geringe
politische Bedeutung (Alfred Noe, a.a.O., Sp. 1). Die antike Kultur wird von den Humanisten als unübertrefflich nachgeahmt. Das Studium der antiken Literatur und Philosophie dient dazu, sich einer in sich ruhenden Bildung zu vergewissern und sich von theologischen und philosophischen Vorentscheidungen zu lösen. Der über den ständischen Gliederungen stehende /uomo universale/ verkörpert das ideale Menschenbild.
Die humanistische Gelehrtenbewegung will das antike Menschenbild erneuern. Die antike Bildung wird als unübertreffliches Vorbild empfunden und das lebensbejahende und schöpfe-rische Individuum rehabilitiert. Die Verherrlichung des Menschen ergibt sich bei den italie- nischen Humanisten aus der Überzeugung, dass der Mensch als das Ebenbild Gottes das Höchste in der ganzen Schöpfung sei (Friedrich Klingner, a.a.O., S. 716). Die Kritik an einer Naturwissenschaft, die ungeordnete Kenntnisse anhäuft, und an den sinnlosen Spekulationen der Scholastik sowie das zunehmende Interesse für die aus menschlichen Leistungen hervorgegangene Erfahrung machen die bis dahin vernachlässigte Geschichte zur Lehr-meisterin des Lebens (vgl. Cicero, De oratore, II 36: historia magistra vitae) und in der Folge zu einer Leitdisziplin des Wissenschaftsbetriebs (Alfred Noe, a.a.O., Sp. 4).
Philosophie und Rhetorik bewegen sich weg vom Wort Gottes hin zur menschlichen Kommunikation und damit zur historischen und nicht mehr geoffenbarten Wahrheit nach dem Prinzip: die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit (Francis Bacon: Neues Organon, hrsg. von Wolfgang Krohn, 2. Aufl., 1999, S. 180: Recte enim Veritas Temporis filia dicitur, non Authoritatis). Übertragen auf Sprache und Literatur ergibt sich daraus die vom Humanismus hervorgebrachte Disziplin der Philologie (Alfred Noe, a.a.O., Sp. 2, unter Berufung auf Eugenio Garin: L`umaneismo italiano, 1952).“
Besondere Aufmerksamkeit verdient die humanistische Gegenbewegung zur Scholastik. Hierzu heißt es in einem Internet-Artikel:
„Die Anhänger des Humanismus wollten zunächst die Scholastik als Denkschule ersetzen. Jene Denkschule geht davon aus, dass Wissen nur durch Autoritäten vermittelt werden kann. Grundlage war die scholastische Methode, welche zur Beweisführung herangezogen wurde. So wurde neues Wissen und Erkenntnisse generiert, indem Behauptungen bewiesen oder wiederlegt wurden.
Für Humanisten stand die scholastische Wissenschaft im klaren Gegensatz zum Fähigkeits-streben des Menschen. Denn diese Beweisführung ließ nur Erkenntnisse zu, welche in der Glaubenswelt bereits existierten.
Neue Erkenntnisse wurden abgeschmettert. Wissen konnte nur durch Lehrer vermittelt werden. Demnach konnten neuere Erkenntnisse auch nur dort ihren Ursprung haben. Diese Denkweise führte zu keinem neuen Wissen, sondern nur zu Bestätigung alter Erkenntnisse. Und deshalb war die Scholastik für prominente Humanisten – wie Erasmus oder Petrarca – unnütz und belanglos.
Stattdessen sollten Tugend und Wissen als Ideale herhalten. Nur durch die Verbindung beider Ideale können der Mensch seine Fähigkeiten optimal entfalten. Die Bildungsreform sorgte dafür, sich ein neues Menschenbild in Italien etablierte – welches den Menschen als Indi-viduum begriff. Dieses neue Menschenbild wurde zunächst durch Literatur verbreitet. Später griff es die Kunstwelt auf und bildende Künstler setzten es in Skulpturen und Gemälden um. Dafür waren allerdings noch neue Perspektiverfahrungen nötig.“66
Renaissance-Kunst
„Die Kunst der Renaissance ist ein Abbild der Denkweise des Humanismus. Der Mensch als Individuum steht im Vordergrund.
Das antike Ideal war, dass der Mensch ein Geschöpf der Natur ist. In der Natur ist er ein Teil davon und steht in Wechselbeziehung zur Natur. Das Christentum hat den Menschen als ein Geschöpf Gottes erklärt, welches sein Leben im Diesseits opfern solle, um nach dem Tod ins Himmelreich zu kommen. Der Mensch wurde nicht als Individuum begriffen, sondern als Gottgehilfe oder als Gotteswerkzeug. Das Schicksal des Einzelnen war von Gott gemacht. Wenn man es annahm, folgte man Gotteswegen und konnte sich demnach einen Platz im Himmelreich sichern.
Durch die Vorarbeit der Humanisten begriffen sich Renaissancekünstler nicht länger als Gottes Handwerker, deren Aufgabe es war, die Herrlichkeit Gottes herauszustellen. Stattdessen waren Künstler ebenfalls Individualisten, welche fortan besondere Fähigkeiten hatten, die es ihnen ermöglichten, großartige Kunstwerke herzustellen.
Neue Perspektivtechnik
Um großartige Kunst herzustellen, musste das Kunstwerk möglichst genau die Natur abbil-den. Dass was das menschliche Auge sehen konnte, sollte sich detailgetreu im Kunstwerk wiederfinden. Dazu benötigte man allerdings Perspektiven.
Schon in der Antike erkannten Künstler, dass Objekte – welche sich im Raum weiter hinten befinden, kleiner sind. Deshalb konnte nur eine echte Raumperspektive ein Kunstwerk in ein genaues Abbild der Natur verwandeln.
Die Zentralperspektive mit Fluchtpunkt bot so eine Möglichkeit. Entwickelt wurde diese Technik durch Filippo Brunelleschi im Jahr 1420 in Florenz. Er erkannte, dass sich bei der Beobachtung der Natur eine Horizontallinie ergibt. Und je nachdem, wo man auf dieser Linie hinschaut, ergibt sich ein Fluchtpunkt. Alle Objekte im Raum könne man dann mit Hilfe von imaginären Fluchtpunktlinien mit dem Fluchtpunkt am Horizont verbinden. Dadurch kann man Raumtiefe für jedes Objekt detailgetreu nachbilden.“ (a.a.O.)
„Raffaels Schule von Athen
Raphael (Public Domain)
Humanismus in den Künsten
Herrscher wie Federico da Montefeltro (1422-1482) in Urbino und Cosimo I. de’ Medici (1519-1574) in Florenz waren große Bewunderer der Antike und bauten beeindruckende humanistische Bibliotheken auf. Sie waren auch Sammler antiker Kunstwerke wie Skulp-turen, Sarkophage, Relieftafeln und Münzen. Beide Männer wurden auch zu großen Kunst-mäzenen und förderten humanistische Künstler. Dieses Muster wurde von Herrschern in ganz Europa nachgeahmt.
Maler und Bildhauer der Renaissance interessierten sich sehr für die klassische Mythologie und kombinierten sie manchmal sogar mit christlichen Themen, indem sie beispielsweise Venus auf subtile Weise als Jungfrau Maria darstellten. Antike Denker wurden in der Kunst direkt dargestellt, am berühmtesten vielleicht im Fresko der Schule von Athen von Raffael (1483-1520) im Vatikan.
Auch das Können der antiken Künstler, insbesondere der Bildhauer, und ihre Fähigkeit, die Wirklichkeit in Bronze oder Marmor wiederzugeben, wurden geschätzt. Die Künstler der Renaissance waren bestrebt, diese Realität ebenso festzuhalten, ein Prozess, der bis zu Giotto di Bondone (geb. 1267 oder 1277 und gest. 1337) zurückreicht und in den hyperrealistischen Porträts der niederländischen Künstler der Spätrenaissance seinen Höhepunkt findet. Ebenso wie die Schriftsteller der Renaissance wollten auch die Künstler die klassische Tradition nicht nur nachahmen, sondern auch verbessern. Folglich wurde die korrekte Verwendung der Perspektive für die Künstler der Renaissance zu einem immer präziseren Unterfangen. Die Künstler waren auch davon überzeugt, dass ihre antiken Vorbilder die mathematischen Geheimnisse der Proportionen entdeckt hatten, insbesondere in Bezug auf den menschlichen Körper.“ (In: https://www.worldhistory.org/trans/de/1-19263/renaissance-humanismus/)
„Humanismus in der Wissenschaft
Die Welt um uns herum zu beobachten, zu analysieren und zu kategorisieren war ein wichtiger Bestandteil des humanistischen Denkens, genau wie in der Antike. Aus diesem Grund machte die Wissenschaft während der Renaissance große Fortschritte, zunächst angetrieben durch Entwicklungen in der Mathematik. Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus (1473-1543) schlug in seinem 1543 veröffentlichten Werk Über die Umschwünge der himmlischen Kreise neben anderen innovativen Ideen vor, dass das Sonnensystem heliozentrisch ist. Kopernikus war ein klassischer Gelehrter der Renaissance, denn er studierte die Werke der Antike, beobachtete so viel wie möglich in der Welt mit eigenen Augen, glich alles kritisch ab, was bis dahin in seinem Fachgebiet erforscht worden war, und entwickelte dann eine neue Sichtweise auf das jeweilige Thema. Der vielleicht bedeutendste Beitrag des Humanismus zur Wissenschaft war sein Wissensdurst und die Zuversicht, dass Antworten durch menschliches Bemühen gefunden werden können.“ (a.a.O.)
Erasmus von Rotterdam (1467-1536)
ist eine besonders lichtvolle Gestalt des Renaissance-Humanismus, nimmt er doch in mancher Hinsicht die europäische Aufklärung bereits vorweg. In einem Wikipedia-Artikel steht:
„Desiderius Erasmus von Rotterdam oder nur Erasmus genannt[1][2] (* 28. Oktober 1466/1467/1469 in Rotterdam; † 11./12. Juli 1536 in Basel) war ein niederländischer Universalgelehrter: Theologe, Philosoph, Philologe, Priester, Autor und Herausgeber von 444 Büchern und Schriften. Er ist der bedeutendste Vertreter des europäischen Humanismus, der bekannteste Renaissance-Humanist und war ein einflussreicher Kirchenreformer. Als kritischer Denker seiner Zeit zählt Erasmus, der auch als „Fürst der Humanisten“ bezeichnet wird, zu den Wegbereitern der europäischen Aufklärung. Seine Wirkung reicht bis in die heutige Zeit.“
In frappierender Weise lässt sich dies an Hand eines Phänomens verdeutlichen, das erst in un-serer Zeit wissenschaftlich erklärt werden konnte: dem der Willensfreiheit. Schon zu Eras-mus‘ Lebzeiten wurde die Kontroverse berühmt, die er mit Martin Luther (1483-1546) ausge-tragen hat. Simon Mayer hat diese Auseinandersetzung in einem Artikel des Jahres 2017 dokumentiert:
„Eine Definition des freien Willens – Erasmus (S.24):
Unter freiem Willen verstehen wir [...] das Vermögen des menschlichen Willens, mit dem der Mensch sich dem, was zur ewigen Seligkeit führt, zuwenden oder von ihm abwenden kann.
Dazu Luther (S.84):
Du [...] lässt den freien Willen nach beiden Seiten gleich stark sein, so dass er aus eigener Kraft, ohne die Gnade, sich ebenso zum Guten wenden wie von ihm abwenden kann. Du bedenkst nicht, was alles du dem freien Willen zutraust, wenn du sagst, dass diese Kraft sich dem Guten zuwenden könne. So schließt du den heiligen Geist mit all seiner Kraft aus, als wäre er überflüssig und nicht notwendig.
Die Willensfreiheit ist verwundet, aber nicht tot – Erasmus (S.28):
Obwohl nämlich die Willensfreiheit durch die Sünde eine Wunde empfangen hat, ist sie nicht tot; obwohl sie sich eine Lähmung zugezogen hat, so dass wir vor dem Empfang der Gnade geneigter zum Bösen als zum Guten sind, ist sie nicht vernichtet; nur trüben ungeheuerliche Verbrechen oder zur zweiten Natur gewordene Gewohn-heitssünden gelegentlich dermaßen das Urteil des Verstandes und verschütten der-maßen die Freiheit des Willens, dass jenes vernichtet und diese tot zu sein scheint.
Der Wille des Menschen ist versklavt, unter Satans Gewalt – Luther
Nur Gott hat einen freien Willen – Luther (S.55ff.):
Der freie Wille ist ein göttlicher Titel. Er steht dem erhabenen Gott zu und niemandem außer ihm. Der „kann schaffen, was er will“ (Ps 115,3) im Himmel und auf Erden. Wenn man dem Menschen diesen Titel zuerkennt, dann bezeichnet man ihn geradezu als Gott; eine Gotteslästerung, die nicht überboten werden kann.
Die Unmöglichkeit, Sünde zuzurechnen, wenn der Wille nicht frei ist – Erasmus (S.28):
Wenn der Wille nicht frei gewesen wäre, hätte die Sünde nicht zugerechnet werden können, denn sie hört auf, eine Sünde zu sein, wenn sie nicht eine freiwillige gewesen ist, es sei denn, dass ein Irrtum oder eine Gebundenheit des Willens aus einer Sünde entstanden ist. Man rechnet daher einer gewaltsam geschändeten Frau ihren Fall nicht zu.
Die Sinnlosigkeit eines kommenden Gerichts, wenn alles notwendig ist – Erasmus
(S.76):
Warum würde in der Heiligen Schrift so oft das Gericht erwähnt, wenn Schuld überhaupt nicht gewogen würde? Oder warum müssten wir vor dem Richterstuhl stehen, wenn nichts nach unserer Willkür, sondern alles nach reiner Notwendigkeit bei
uns zugegangen wäre? Ferner stört die Erwägung, wozu all die vielen Warnungen, Gebote, Drohungen, Ermahnungen und Vorwürfe nötig wären, wenn wir nichts zu tun vermöchten und wenn Gott nach seinem unveränderlichen Willen alles – das Wollen wie das Vollbringen – in uns wirkte (vgl. dazu Phil 2,13)?“67
Erasmus behauptet also:
1. Der Mensch verfügt über Willensfreiheit und kann sich daher für das Gute, aber auch für das Böse entscheiden.
2. Trotz starker Neigungen zum Bösen ist die Willensfreiheit nicht zu leugnen.
3. Willensfreiheit ist keine „Gotteslästerung“ (Luther); denn auch das Jüngste Gericht wäre sinnlos, wenn es kein menschliches, zu verantwortendes Verschulden gäbe.
4. Die „Notwendigkeit“ bestimmt nicht alles, denn: “ Wenn der Wille nicht frei gewesen wäre, hätte die Sünde nicht zugerechnet werden können, “ (s.o.).
Frappierend ist dies, weil es – in seinem realen Kern – mit aktuellen wissenschaftlichen Er-kenntnissen übereinstimmt (vgl. Libet 2005, Kiefer 2015). Aus dem freien Willen ergibt sich zudem die Notwendigkeit, alle Menschen – gleich welcher Herkunft, Rasse oder Religion – als Rechtspersonen anzuerkennen. Dazu heißt es in dem Wikipedia-Artikel:
„Toleranz zwischen Juden, Christen und Muslimen
Einige christliche Humanisten, unter ihnen auch Erasmus, versuchten die gegenseitige Toleranz zwischen Juden, Christen und Muslimen zu fördern, indem sie die Gemeinsamkeiten der drei Religionen herausstellten und einen neuen Umgang mit Juden und Moslems forderten.
Erasmus wurde von katholischen und protestantischen Theologen gleichermaßen gerügt, weil er die für sie bizarre Idee religiöser Toleranz vertrat. Zu Lebzeiten konnte Erasmus sich damit nicht durchsetzen. Seine größten Beiträge zur Toleranz wurden erst posthum wirksam. Nachfolgende Generationen erkannten Erasmus — insbe-sondere durch den Neudruck „De haereticis an sint persequendi“ 1954 — als Verfechter der Mäßigung, der friedlichen Versöhnung, des gegenseitigen Verständ-nisses und als den Verfechter „religiöser Toleranz“ an.[88] Durch sein Postulat der religiösen Toleranz wurde er einer der bedeutendsten und einflussreichsten Repräsen-tanten des europäischen Humanismus in der sog. „Neuen Zeit“ und galt, absolut ungewollt, durch seine kritische Haltung gegenüber der Kirche und die neu- artige Interpretation der heiligen Schriften, als Vordenker der Reformation.“ (a.a.O.)
Von der Rechtsgleichheit (bzw. Gleichheit vor dem Gesetz) können weibliche Personen kei-nesfalls ausgeschlossen werden.:
„Neues Frauenverständnis
Erasmus entwickelte ein neues Frauenbild, welches mit der frauenverachtenden Tradition brach.[109] Er setzte sich – entgegen den damaligen Frauenklischees und im Gegensatz zur Doktrin des Aristoteles – schon früh für die Frauenbildung ein. Mädchen sollten die gleiche Erziehung genießen wie Jungen, sie seien „keine Mängel-wesen“ (Aristoteles). Frauen könnten, auch durch Studium, so seine Hoffnung, zu einem an humanistischen Werten orientierten Europa beitragen.“ (Wikipedia, a.a.O.)
Insgesamt gesehen erweist sich Erasmus als einer der bedeutendsten Humanisten und zugleich als Wegbereiter der europäischen Aufklärung. Man nannte ihn auch „den Fürsten der Huma-nisten“, der vehement die Missstände in der Kirche seiner Zeit kritisierte und sich immer wieder für Frieden und die friedliche Beilegung von Konflikten einsetzte, und zwar auf Grund ethischer Erwägungen. Er wurde „gleichermaßen von Spinoza, Rousseau, Voltaire, Kant, Schiller, Lessing, Herder, Goethe, Schopenhauer und Nietzsche geachtet. Der Bildungs-gedanke der deutschen Klassik geht in seiner geistesgeschichtlichen Aszendenz auf Erasmus, nicht auf Luther zurück“ (ebd.).
Darüber hinaus gilt Erasmus als Vorläufer der Friedensbewegung. Sein Denken und Handeln kann als Bollwerk gegen jede Form von Faschismus und Totalitarismus angesehen werden.
Zusammenfassend kann man festhalten:
„Zu den wichtigsten Elementen des Renaissance-Humanismus gehören:
das Interesse am Studium der Literatur und Kunst der Antike
das Interesse an der eloquenten Verwendung der lateinischen Sprache und der Philologie
der Glaube an die Bedeutung und Macht der Bildung bei der Schaffung nützlicher Bürger
die Förderung der privaten und bürgerlichen Tugend
die Ablehnung der Scholastik
die Förderung nicht-religiöser Studien
die Betonung des Individuums und seiner moralischen Autonomie
der Glaube an die Bedeutung von Beobachtung, kritischer Analyse und Kreativität
die Überzeugung, dass Dichter, Schriftsteller und Künstler die Menschheit zu einer besseren Lebensweise führen können
ein Interesse an der Frage: »Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?« “ (a.a.O.)
D) Von der Renaissance bis zur Romantik
Zwischen Renaissance und Barock: die Utopisten Morus und Campanella
Wer ist frei, wer ist verantwortlich, der Einzelne oder die Gemeinschaft? Oder beide? Und wie lassen sich Freiheit und Verantwortung in Einklang bringen? Auf solche Fragen wusste man auch in der Renaissance-Epoche fast nur utopische Antworten. So in Utopia, dem 1516 erschienenen Hauptwerk des englischen Staatsmannes, Juristen und Philosophen Thomas Morus (1478-1535). Vollständig lautet der Titel: „Ein wahrhaft goldenes Büchlein von der besten Staatsverfassung und von der neuen Insel Utopia“.
Es ist eine Art Schiffermärchen, deutlich beeinflusst von den neuen Entdeckungen in Übersee, aber auch von Platons Staat (Politeia) und den Lehren Epikurs, relativ wenig vom Christen-tum. Morus beschreibt darin eine ideale Gesellschaft, wie sie nur als ‚u-topos‘, als ‚Nicht-Ort‘, d.h. nur als Gedankengebäude, Frucht mächtiger Phantasie, Vorstellungs- und Gedächt-nis-Kraft existiert.
In gesellschaftskritischer Absicht fragt Morus u.a. danach, wodurch die Kriminalität, das zerstörerische Böse in einer Gesellschaft, entsteht. Seine Antwort lautet zunächst, man setze „fürchterlich harte Strafen für Diebe fest, während man viel lieber dafür sorgen sollte, daß sie ihr Auskommen haben, damit nicht einer in den harten Zwang gerät, erst stehlen und danach sterben zu müssen“ (Utopia S. 25). Weitere gesellschaftliche Gründe für „Diebereien“ sieht er in Ausbeutungsverhältnissen, in denen „Edelleute selber müßig wie die Drohnen von anderer Leute Arbeit leben“ (S. 25 f.). Grundbesitzer seien verantwortlich für zahlreiche Übergriffe, z.B. gegen Pächter, die man nach Belieben von Haus und Hof vertreibe. Auch gebe es überflüssigen Luxus, von dem einige Nichtstuer profitierten, während fleißige Handwerker und andere Arbeiter, die den gesellschaftlichen Reichtum erwirtschaften und den Staat erhalten, hemmungslos ausgebeutet würden. Die Kluft zwischen Reichen und Armen werde immer größer. (Auch damit spielt More natürlich auf bestimmte Missstände in der Gesellschaft seiner Zeit an.) Wer in den bestehenden Staaten von „Gemeinwohl“ rede, denke fast immer nur an seinen privaten Vorteil (a.a.O. S. 149).
Ganz anders gehe es in Utopia zu. Hier habe man die wichtigsten Ursachen für alle sozialen Ungerechtigkeiten und Missstände beseitigt: Privateigentum, Geld und Geldwirtschaft. Wo das Privateigentum herrscht, könne es keine „Gleichheit des Besitzes“ und kein Glück der Allgemeinheit geben (a.a.O. S. 56). Solange das Privateigentum bestehen bleibe, würden „auf dem weitaus größten und weitaus besten Teil der Menschheit Armut, Plackerei und Sorgen als eine unentrinnbare Bürde weiter lasten“ (ebd.).
Durchgreifend beseitigt habe man solche Not nur in Utopia, und zwar dadurch, dass man dort das Privateigentum aufgehoben, das Geld abgeschafft und das gesamte Arbeits- und Alltagsleben aller Staatsbürger völlig neu organisiert habe. Zum Arbeiten sei jedermann verpflichtet, aber nur insgesamt sechs Stunden am Tag, je drei Stunden vormittags und nachmittags, sinnvoll unterbrochen durch zwei Stunden Mittags- und Ruhepause. Durch vernünftige Arbeitsteilung finde jeder Beschäftigung, und das erwirtschaftete Sozialprodukt sorge für ausreichenden Wohlstand für jedermann. Über die Freizeit könne jede/r weitgehend selbst bestimmen, wobei literarische Studien, Sport und Spiele breiten Raum einnähmen (a.a.O. S. 70 f.).
Philosophisch untermauern die Utopier ihre neue Ordnung durch eine ausgeklügelte Tugend-lehre, die allerdings in weiten Teilen an Epikur erinnert, so in der Unterscheidung zwischen Notwendigem, Nützlichem und Schädlichem. Askese und nutzlose Selbstaufopferung seien ebenso zu meiden wie „verkehrte Freuden“ (wie Unmäßigkeit beim Essen, Trinken und Spielen). Vor- und nicht-ehelicher Sex ist verboten, weil sonst die Familie als Grundlage der Gesellschaft in Gefahr geriete. Auf leibliche und geistig-seelische Gesundheit legen die Utopier größten Wert. „Die Tugend definieren sie nämlich so: naturgemäß leben, sofern wir dazu von Gott geschaffen sind; und zwar folge der dem Zuge der Natur, der in allem, was er begehrt und was er meidet, der Vernunft gehorcht.“ (a.a.O. S. 93)
Größtmögliche Toleranz herrscht in Fragen der Religion. Bekehrungsversuche sind erlaubt, aber nur „ohne Anmaßung“, ohne Auftrumpfen und ohne jegliche Gewaltanwendung (a.a.O. S. 135 f.). Im Übrigen sei es jedem selbst freigestellt, welche Religion er annehmen möchte. – Auch dem Christentum hätten viele Utopier zugestimmt, insbesondere als „sie hörten, Christus habe die gemeinschaftliche (kommunistische) Lebensführung seiner Jünger gutgeheißen, und daß diese in den Kreisen der echtesten Christen noch heute üblich sei.“ (a.a.O. S. 134)
Damit nennt der überzeugte katholische Christ Morus, wie ich meine, die wahre Quelle seiner Überzeugungen: den Liebeskommunismus der Urchristen. Gemeinwohl und Gemeinschaft-lichkeit – auch und gerade im Sinne der christlichen Werte – hält der Autor für unerlässliche Voraussetzungen und Bedingungen für Gleichheit; Freiheit und Wohlergehen jeder Einzel-person und damit der Gesellschaft im Ganzen. Entscheidend ist für Morus nicht Luthers Frage, wie die Einzelperson einen „gerechten Gott“ bekommen kann, sondern die Frage, wie der Mensch in einer Gesellschaft glücklich werden kann, was die „Glückseligkeit“, d.h. den Seelenfrieden und sogar die (mögliche) Unsterblichkeit der Seele durchaus mit umfasst. (Woraus sich wahrscheinlich auch Morus‘ entschiedene Ablehnung des Lutheranismus erklärt.)
Insofern ist Utopia zweifellos kein „Missgriff“ des Autors und auch kein Versteckspiel, und erst recht kein Zeugnis kapitalistisch-bürgerlicher oder gar imperialistischer Gesinnung. Vielmehr handelt es sich um den – historisch eher seltenen – Versuch eines freiheitlichen christlichen Sozialismus und einer Quadratur des Kreises zwischen Freiheit und Kollektivismus.
Zu Tommaso Campanella (1568-11639)
Für gänzlich inakzeptabel halte ich Folgendes: Campanellas „Sonnenstaat“ ist ein letztlich religiös begründeter, totalitärer Überwachungsstaat. An dieser Grundtatsache ändern einige Besonderheiten und Zugeständnisse (Willlensfreiheit, Goldene Regel usw.) kaum etwas. Die Herren Metaphysikus und seine Helfershelfer (Sin, Pon, Mor) kontrollieren praktisch alle Lebensbereiche der Solarier. Ernst Bloch nennt deren Gemeinwesen einen „Staats-sozialismus“, fügt aber hinzu, dieser sei genauer zu bezeichnen als „ein papistischer, mit viel byzantinischem und astrologischem Pathos im Grund“ (Das Prinzip Hoffnung, S. 609). Einen solchen Staat gab und gibt es bisher nirgendwo, auch nicht als einen der sogenannten „Gottesstaaten“! Campanella selbst pries seinen Entwurf zwar als den einer „Reform der christlichen Republik“ an; tatsächlich aber handelt es sich um extrem religiösen (theo-kratischen) Fundamentalismus, wenn nicht Klerikalfaschismus. Die meisten Grundideen des „Sonnenstaats“ sind durch die geschichtlichen Erfahrungen, die insbesondere im 20. Jahrhundert mit totalitären Regimen gemacht wurden, völlig diskreditiert worden.
Descartes‘ Menschenbild
René Descartes (1596-1650) fundiert das Denken im ‚Cogito ergo sum‘ und damit im eigenen Ich, und zwar auch in der Formel ‚ je suis une chose qui pense‘ („ich bin ein denkendes Etwas“). Er weiß aber sehr wohl, dass er die Existenz dieses Ichs nicht sich selbst verdankt. Anders als ‚res‘ verweist ‚chose‘ auf lateinisch ‚causa‘, den Grund, die Ursache. Und die letzte Ursache kann für Descartes nichts anderes sein als Gott selbst, wie er auch in zwei unterschiedlichen Gottesbeweisen nachzuweisen versucht.
Diese Gewissheiten logisch einwandfrei unter einen Hut, auf einen Nenner, zu bringen, gelingt Descartes nicht immer. Gemäß christlicher Überlieferung ist der Mensch durch die Unsterblichkeit der Seele mit Gott verbunden. Hierauf kann und will Descartes auf keinen Fall verzichten, und zwar wohl nicht nur aus Vorsicht vor der Inquisition, sondern aus einer tiefen Glaubensüberzeugung, in der sowohl Gott als auch der Mensch eine Sonderstellung einnehmen. Dieser will Descartes durch seine Lehre von den drei „Substanzen“ (drei Wesen-heiten) gerecht werden. Es sind dies 1.) Gott als erste Ursache allen Seins, 2.) der Mensch als chose qui pense und 3.) die im Raum ausgedehnte Materie, die chose étendue (‚res extensa‘).
Wenn aber 2) und 3) eigenständige Wesenheiten („Substanzen“) sind, treten Geist und Körper, Leib und Seele scheinbar auseinander – ein Widersinn, zumal Descartes selbst später sogar eine Wechselwirkung von Leib und Seele annimmt. Diesen Widerspruch aufzulösen, hat der Autor nie versucht. In seinen zahlreichen Werken finden sich aber genügend Hinweise darauf, dass er die menschliche Person sehr wohl als Einheit begriffen hat.68 In Nr. 63 seiner „Prinzipien der Philosophie“ betrachtet er sogar Denken und Ausdehnung als „les choses principales qui constituent la nature de la substance intelligente et corporelle“69 (‚die Haupt-Sachen, welche die Natur der intelligenten und körperlichen Substanz ausmachen‘) – mithin startet er einen Versuch, sogar eine umgreifende „Substanz“ aus Körper und Geist als Einheit darzustellen. Womit er sich allerdings teilweise selbst widerspricht, denn an anderer Stelle betont er, dass Gott – als oberste Substanz – derjenige ist, der die voneinander abgegrenzten Substanzen Denken und Ausdehnung durch seine Allmacht zusammenhält.
Angemessen erscheinen jedenfalls die Schlussfolgerungen von Dominik Perler, wonach Descartes nicht nur eine „funktionelle“, sondern sogar eine „essentielle“ Einheit von Leib und Seele angenommen hat (auch wenn die Bedeutungssphären von ‚Substanz‘ und ‚Essenz‘ sich in dem Begriff ‚Wesen‘ teilweise überschneiden). – Einheitliches Subjekt ist das denkende Ich.
Nicht akzeptabel sind jedenfalls sämtliche Versuche, den Autor einfach als „Dualisten“ abzustempeln. Geradezu unerträglich wirken die diesbezüglichen Anschuldigungen, die der New-Age-Philosoph Fritjof Capra (1983) – in radikalisierendem Anschluss an Denker wie Hobbes, Gassendi, Leibniz und Schelling – in die Welt gesetzt hat. Demnach wäre Descartes – wegen seines angeblichen „Dualismus“ – für nahezu sämtliche Fehlentwicklungen seit Beginn der Neuzeit verantwortlich, angefangen von der Umweltzerstörung (in Folge einer „mechanistischen“ Natur-Auffassung) bis hin zum Scheitern aller modernen Wirtschafts-theorien70(!). Einen Einzelnen derart zu beschuldigen, halte ich schon deswegen für unstatthaft, weil damit völlig verkannt wird, welche (letztlich vielleicht unüberschaubaren) Sonder-Interessen tatsächlich für die jeweiligen historischen Fehlentwicklungen verantwort-lich sind. Erkenntnisse werden oft verraten, wenn sie mit Interessen in Konflikt geraten!
Freiheit, Wille und Erkenntnis
Was wäre das Subjekt ohne Freiheit? Es wäre nur noch ein ‚subiectum‘, wörtlich „ein Darunter-Geworfenes“, ein allem Möglichen und Wirklichen Unterworfenes, mithin nicht selbstbestimmt, nicht eigenem Zweck folgend, sondern vollkommen fremdbestimmt. Ein solches Wesen wäre total situationsbedingt und damit wahrscheinlich übler gestellt als jedes andere Lebewesen. Tatsache ist aber, dass ein menschliches Subjekt seine eigene Lage beur-teilen kann und daher niemals total situationsbedingt ist.71
Dieser Fähigkeit will Descartes gerecht werden, indem er dem Menschen Willens- und Entscheidungsfreiheit zubilligt. Dazu benutzt er die Begriffe ‚ libre arbitre ‘ (wörtlich: „freier Schiedsrichter“), ‚ liberté de ma volonté ‘ und ‚ liberté de notre volonté‘ (also Freiheit meines und unseres Willens!). Freiheit und Wille gehören demnach natur- und erfahrungsgemäß zusammen, nicht als bloße Verstandeskategorien (wie es der ‚libre arbitre‘ vermuten lassen könnte). Letztlich zählt Descartes die Willensfreiheit zu drei großen, von Gott gestifteten „Wundern“ (neben der Schöpfung aus dem Nichts und der Menschwerdung Gottes).72
Die Willensfreiheit bedarf keines Beweises, wie Descartes in Nr. 39 seiner Prinzipien der Philosophie (von 1644) betont. Erkennbar ist sie vielmehr daran, dass sie Wahlfreiheit, nämlich Zustimmung oder Ablehnung, ermöglicht (ebd.). Was wir nicht genau kennen, brauchen wir nicht zu akzeptieren. Darüber hinaus haben wir nicht nur die Freiheit, alles zu bezweifeln, sondern auch, jeglichen Zweifel zu beenden, wenn gute Gründe – wie die des Cogito ergo sum – dieses klar und deutlich nahe legen. Willensfreiheit bedeutet Handlungs-freiheit, weil wir zwischen Richtig und Falsch unterscheiden und daher unserem selbst-bestimmten Willen vertrauen können (37. Prinzip).
Das Cogito wird zur Grundlage einer neuen Anthropologie, in der Descartes den Menschen als denkendes, geistbestimmtes, mit Willensfreiheit begabtes Wesen auffasst. Den Gedanken der Willensfreiheit verknüpft er immer wieder mit erkenntnistheoretischen Überlegungen, so z.B. im Folgenden:
„Der freie Wille ermöglicht es dem Menschen, diese Vorstellungen zu bejahen, jene zu verwerfen. Nur in dieser Tätigkeit des Willens, nicht in den Vorstellungen selbst, liegt die Quelle allen Irrtums. Wir haben es selbst in der Hand, richtig oder falsch zu denken und zu erkennen. Wenn wir uns nur an den Maßstab halten, der uns mit der unvergleichlichen Gewißheit und Deutlichkeit jener ersten Grunderkenntnisse an die Hand gegeben ist, wenn wir nur das als wahr annehmen, was mit gleicher Gewißheit erkannt ist, allem anderen gegenüber uns skeptisch verhalten, so können wir nicht irren, sondern gewinnen denkend ein richtiges Bild der Welt.“ (zitiert von Störig 1961, S. 362). Dabei entwickelt Descartes keine Wahrheitstheorie, setzt vielmehr das Unterscheidungsvermögen auf Grund des bon sens, des gesunden Menschenverstandes, als bei allen Menschen vorhanden voraus und fragt sich, wie das Ich-Subjekt die Objekte der Innen- und Außenwelt richtig erkennen und analysieren kann.73
Jean-Jacques Rousseau(1712-78)
Eine der Grundfragen, die der Genfer Philosoph im VI. Kapitel seines ‚Contrat Social‘, des ‚Gesellschaftsvertrags‘ von 1762, stellt, lautet: Wie ist eine Gesellschaftsform (‚forme d’asso-ciation‘) zu finden, „die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes Gesellschaftsmitgliedes verteidigt und schützt und durch welche jeder Einzelne, auch wenn er sich mit allen vereinigt, dennoch nur sich selbst gehorcht und ebenso frei bleibt wie zuvor“? Die Antwort auf diese Frage erteilt er wenig später im gleichen Kapitel; sie lautet: „ Jeder von uns vergesellschaftet (‚met en commun‘) seine Person und seine Kraft unter der oberste Leitung des Gemeinwillens (‚volonté générale‘), und wir nehmen jedes einzelne Mitglied in das Gemeinwesen auf als unteilbaren Teil des Ganzen.“
Mit anderen Worten: Die Einzelperson (‚la personne particulière‘) wird zur Gemeinschafts-Person (‚personne publique‘) und damit zur Rechtsperson dadurch, dass sie zunächst alle ihre Rechte an den Souverän, den Gemeinwillen, abtritt, der seinerseits im Gegenzug, d.h. sozusagen als Gegenleistung (‚équivalent‘), jeder Person sämtliche Rechte und damit die größtmögliche Freiheit garantiert. Folglich tritt die „natürliche Person“ in den Zustand der rechtlich völlig gesicherten Person über, was ohne den – durch die Zustimmung aller Mitglieder des Gemeinwesens gebildeten – Gemeinwillen (und die entsprechende Gesetz-gebung) nicht möglich wäre.
Auffälliger Weise äußert Rousseaus sein Bekenntnis zum Gottesglauben im Rahmen seiner berühmten Erziehungsschrift, des ‚ Emile‘ von 1762. Darin bekräftigt er seinen Grundsatz, dass der Mensch von Natur aus gutartig ist und negative Eigenschaften nur in Folge schädi-gender gesellschaftlicher Einflüsse entwickelt (die durch den ‚Contrat Social‘ allmählich beseitigt werden sollen). Im Unterschied zu Voltaire zählt Rousseau auch Kultur und Wissen-schaft innerhalb einer fehlgeleiteten, im Argen liegenden Gesellschaft zu den Quellen möglicher Schädigung. Hierzu Rousseau: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ – und, sinngemäß: Alles ist gut so, wie es aus der Hand des Schöpfers kommt; alles wird schlecht in der Hand des Menschen. Für die Erziehung bedeutet dies: „Der heran-wachsende Mensch muß ferngehalten werden von verbildenden Einflüssen. Alles kommt darauf an, die grundsätzlich in jedem Menschen liegende gute Naturanlage auf natürliche Weise werden und reifen zu lassen. Die Aufgabe der Erziehung ist daher eine negative, die besteht im Fernhalten aller Einflüsse des Gesellschaftslebens, die diesen Prozeß stören können.“ (Störig 1961, S. 428)
Fazit. Dann also „zurück zur Natur“? Dieses vielzitierte Bonmot stammt angeblich gar nicht von Rousseau, sondern von Voltaire, der seinen Erzrivalen damit lächerlich machen wollte. Wie dem auch sei, es steht fest, dass Rousseau zeitlebens durch und durch naturverbunden war und stets eine auf „vernünftiger Natürlichkeit“ aufbauende Lebensweise empfohlen hat. In seiner Kulturkritik ging er immerhin so weit, dass er sogar vor Theater- und Konzert-besuchen warnte. Stattdessen solle man sich viel mehr im Freien bewegen, spielen, Sport treiben (z.B. in Regatten auf dem Genfer See), lange Fußmärsche in freier Natur machen usw. Berühmt sind Rousseaus Träumereien eines einsamen Spaziergängers, die (ab 1772) im Anschluss an solche Fußmärsche entstanden sind.
Unbestreitbare Verdienste hat Rousseau sich aber nicht nur durch seine Warnungen vor natur-fernem, entfremdetem Leben erworben. Von höchst nachhaltiger Wirkung war vielmehr seine Politische Philosophie in Verbindung mit seiner neuen Wert-Bestimmung der „unveräußer-lichen Person“. Kluger Personalismus erwies sich hier als geistesgeschichtliche und politische Wirkungsmacht ersten Ranges. Diese Philosophie beeinflusste so bedeutende Dichter und Denker wie Goethe, Schiller, Kant, Fichte, Herder, Marx, Nietzsche, Pestalozzi und Basedow und damit Strömungen wie den Sturm und Drang, die Romantik, den Sozialismus, die Lebensphilosophie, den Personalismus, die Psychoanalyse und die Reformpädagogik. Anhänger der heutigen Öko-Bewegung berufen sich ebenfalls auf Rousseau. (Vgl. Robra 2015, S. 227 ff.)
Kants Menschenbild
Immanuel Kant (1724-1804) fragt, ob es allgemein verbindliche Werte gibt. Dabei ist Folgen-des zu beachten: Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind seit den Revolutionen, die im 18. Jahrhundert in den USA und in Frankreich stattgefunden haben, anscheinend anerkannte Grund-Werte und inzwischen auch weltweit akzeptierte oder geforderte Menschenrechte. Und doch werden diese Werte immer wieder missachtet, sozusagen mit Stiefeln getreten, wie sich schon zu Kants Zeiten am zeitweise tragischen Verlauf der Französischen Revolution zeigte.
Von den drei genannten Begriffen bereitet die Gleichheit anscheinend die meisten Schwie-rigkeiten, zumal es neben der (geforderten) rechtlichen Gleichheit natürliche Ungleichheit zwischen den Menschen gibt: Wir kommen mit unterschiedlichen Begabungen und Talenten auf die Welt. Und unterschiedlich sind auch stets die Weltwege, auf denen sich unsere Unterschiede nach und nach fortentwickeln, und zwar leider nicht immer in positiver Art und Weise. –
Wirkliche Gleichheit bleibt erst recht in weiter Ferne, solange die soziale Ungleichheit fort-besteht und sich vielerorts ständig verschärft. Solange die Soziale Frage nicht zufrieden-stellend gelöst ist, kann Gleichheit allenfalls als Gleichheit vor dem Gesetz Bestand haben, sofern diese nicht – z.B. durch Klassenjustiz – untergraben wird.
Vielleicht hat Babeuf sogar Recht, wenn er nicht nur die Gleichheit, sondern auch die Freiheit für illusorisch erklärt, solange soziale Ungleichheit herrscht. Erst recht, wenn Kants Behauptung zutrifft, dass niemand wirklich frei ist, solange nicht alle frei sind.
Dennoch wird wohl kein Mensch bereit sein, deshalb auf den Begriff, den Wert und das Ideal Freiheit zu verzichten. Wenn die Menschen frei geboren sind und es auch bleiben sollen, ist zu fragen, warum so viele im Laufe ihres Lebens – innerlich und/oder äußerlich – unfrei werden. Was zumindest nahelegt, über den Begriff Freiheit immer wieder neu nachzudenken, wozu Kant Hilfe bieten kann.
Ähnliches gilt für die Solidarität. Bekenntnisse zu ihr – auch in Form von Menschen-rechtserklärungen – reichen nicht aus, solange dadurch Unfreiheit, Unterdrückung, Hunger, Unterernährung und andere Formen des Elends nicht wirksam bekämpft werden; was sicher-lich auch eine Frage des Verhaltens ist. Gibt es Maßstäbe für moralisch einwandfreies Verhalten? Kant hat versucht, auch diese Frage zu beantworten.
Dabei ordnet er die Grundfragen nach dem, was wir wissen können, was wir hoffen dürfen und was wir tun sollen, der Anthropologie, d.h. der philosophischen Lehre vom Menschen, unter, nämlich der Leitfrage: „Was ist der Mensch?“ Und er gibt hierauf auch eine Antwort: „Der Mensch ist Person!“ (so auch der Titel einer Arbeit von Johannes Schwartländer, mit dem Untertitel: Kants Lehre vom Menschen (1968)).
Als Person hat der Mensch seinen Zweck in sich selbst, kann sich daher selbst-bestimmt Ziele setzen und Werte verwirklichen. Wobei Kant einen der höchsten Werte darin sieht, moralisch objektiv korrekt zu handeln. Allerdings ist er Realist genug, zu wissen, dass solche Moralität nicht selbstverständlich, nicht voraussetzungslos möglich ist. Als eine der Grundvoraus-setzungen nennt er den guten Willen. Nur dieser sei imstande, die latent in jedem Menschen vorhandene Böswilligkeit zu neutralisieren. Denn nur der der gute Wille sei dasjenige, was überhaupt (d.h. in und außerhalb (!) der Welt) „ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden“. Die hervorragendsten „ Talente des Geistes “ und „des Temperaments “ können sich äußerst schädlich auswirken, wenn sie nicht durch den guten Willen gezügelt und kontrolliert werden. – Womit erkennbar wird, dass Kant in seiner Sittenlehre – zumindest tendenziell – den ganzen Menschen und nicht nur dessen vernünftigen Teil im Blick hat (was gelegentlich übersehen wird!). (Vgl. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Hamburg 1965, S. 10 f.)
Allerdings: Gut wird der gute Wille bei Kant schon durch das Wollen des Guten, nicht erst durch gutes Handeln. Der gute Wille ist Voraussetzung für Moralität, nicht schon selbst die Moralität, die das gute Handeln ermöglicht. Und Moralität lässt sich erst dann philosophisch begründen, wenn der gute Wille sich mit guter Gesinnung – und insbesondere mit Vernunft und Pflichtbewusstsein – verbindet.
Dann erst gewinnt eine solche Gesinnung sogar unendlichen Wert und folglich höchste Verbindlichkeit. – Wozu Kant 1788 in der Kritik der praktischen Vernunft (Hamburg 1967, S. 147 f.) feststellt: „Der W e r t einer dem moralischen Gesetze v ö l l i g angemessenen Gesinnung ist unendlich: weil alle mögliche Glückseligkeit im Urteile eines weisen und alles vermögenden Austeilers derselben keine andere Einschränkung hat als den Mangel der Ange-messenheit vernünftiger Wesen an ihrer Pflicht.“
Damit nennt Kant zugleich die Voraussetzung für die Erfüllung des „moralischen Gesetzes“: Handeln aus Pflicht, nicht nur aus Neigung. Nicht das Streben nach Glück hält er – im Gegen-satz zu Aristoteles, Epikur und anderen Glücksethikern (Hedonisten) – für die wesentliche Grundlage des moralischen Handelns. Auch nicht die Goldene Regel, die nur allzu leicht aus Selbstliebe, nicht aber aus einem Pflicht-Bewusstsein heraus befolgt werde. Weder für subjektive Anwandlungen noch für individuellen Regeln („Maximen des Willens“) könne man allgemeine Gültigkeit beanspruchen. „Liebe als Neigung“ kann nicht befohlen werden, wohl aber „Wohltun aus Pflicht“.
Offensichtlich erhebt Kant somit den Pflicht-Bezug zum Kriterium für jegliche moralische Verbindlichkeit und entwickelt daraus seinen Kategorischen (d.h. unbedingt gültigen) Imperativ: „ Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Kaum möglich aber scheint eine normative Ethik ohne irgendeine Verbindung von Besonderem und Allgemeinem in individueller und kollektiver Moral, d.h. ohne eine akzeptable Synthese von nur subjektiv Gültigem einerseits und objektiv-allgemein Gesetz-lichem andererseits. Fraglich ist jedoch, ob und wie eine solche, möglichst allgemeine Verbindlichkeit begründet werden kann. In seiner universalistischen Grundform ist der Kategorische Imperativ als Grundlage einer Personalistischen Ethik jedenfalls nicht – oder nur teilweise – geeignet. – Anders steht es mit der "personalistischen" Fassung, der Zweckformel: "Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst." Begründbar ist dieser Leitsatz allerdings nicht mehr in Kantischer Manier, sondern nur durch eine andersartige Argumentation, und zwar in einer Stufenfolge, in der zunächst biologisch, dann teleologisch und schließlich im Hinblick auf die Zweck-Mittel-Relation argumentiert wird: Biologisch kann der Selbstzweck des Menschen schon auf Grund des – außer bei eineiigen Zwillingen – strikt individuellen Genetischen Codes definiert werden. "Genetische Programme" sind zwar nicht immer gesetzlich geschützt, bilden aber die erste Grundlage der Individualität. –
Teleologisch kann durchaus an Kant angeknüpft werden. Während die vorgeburtliche Ent-wicklung, zumal nach der Einnistung der Blastozyste in der Gebärmutter, zweifellos zweck- und zielgerichtet verläuft, dienen auch Erziehung und Sozialisation bestimmten Zwecken. Diese Zweck- und Zielgerichtetheit kann und muss es der Einzelperson ermöglichen, sich selbst Zwecke zu setzen, die von den Mitmenschen zu respektieren sind.
Nichts spricht dafür, dass irgendein Zweck irgendein Mittel "heiligt". Nahziele und Fernziele müssen zueinander passen, aufeinander abgestimmt sein. Wo dies nicht der Fall ist, wie z.B. in einigen totalitären politischen Systemen der Vergangenheit (und der Gegenwart!), schwinden (oder verschwinden) sowohl die Nahziele als auch die Fernziele.
Kurioserweise folgt hieraus, dass der Kategorische Imperativ sich in seiner "persona-listischen" Fassung (der Zweckformel) neu begründen lässt, und zwar dann – und wahr-scheinlich nur dann –, wenn man diesen Leitsatz aus seiner Einbettung in das Gesamtsystem der Kantschen Pflicht- und Sollensethik herauslöst. Verbindlichkeit ist dann nicht mehr kantisch "vernünftelnd" zu definieren, sondern – nicht zuletzt im Hinblick auf die Mittler-funktionen der Gefühle – als Unveräußerlichkeit des Eigenwerts und Selbstzwecks der Person, Unantastbarkeit der Menschenwürde, Menschenfreundlichkeit, Entgegenkommen, Wohlwollen, Konzilianz und Kompromissbereitschaft. Und in diesem Sinne kann nichtsdesto-weniger sogar der – wenn auch personalistisch neu begründete – Kategorische Imperativ (vielleicht) als allgemein verbindlich gelten.74
Die Toleranz-Idee bei Voltaire, Lessing, Goethe u.a.
Spätestens seitdem Herbert Marcuse (1898-1979) den Begriff „repressive Toleranz“ (1965) geprägt hat, ist es schwierig geworden, sich über Inhalt und Umfang des Begriffs Toleranz Klarheit zu verschaffen. Wenn Toleranz repressiv, d.h. unduldsam wird, schlägt sie in Intoleranz um und hebt sich auf. Wenn Marcuses Behauptung zutrifft, dass in den „westlichen Demokratien“ repressive Toleranz herrscht, verliert auch die Bezeichnung „freiheitliche Demokratie“ ihren Sinn. Denn Repression bedeutet Intoleranz und damit Unfreiheit.
Ohnehin endet die Toleranz bei der Intoleranz. Gegenüber der Intoleranz kann es keine Toleranz geben, oder? Woraufhin vielleicht zu diskutieren wäre, ob bzw. inwieweit Intoleranz gegenüber der Intoleranz (die z.B. in Form der repres-siven Toleranz auftreten mag) legitim sein kann, was aber hier zu weit führen würde.
Unfreiheit und Toleranz sind jedenfalls nicht miteinander vereinbar, zumal Toleranz als ein Wert gelten kann, ohne den die Grundfreiheiten keinen Bestand haben, und zwar nicht nur die Freiheit des Glaubens und des Gewissens, die Bekenntnis-, Kultus- und Religionsfreiheit, sondern auch, wie ich meine, die Freiheit der Person, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Mit Unfreiheit sind diese Grundfreiheiten jedenfalls nicht vereinbar. Insofern wäre repressive Toleranz sogar verfassungswidrig (im Sinne unseres Grundgesetzes) und dürfte daher, rein rechtlich gesehen, gar nicht aufkommen können, weil Verfassungsbruch justiziabel, gerichtlich verfolgbar ist. Über Begriff und Wert der Toleranz sollte daher Klarheit bestehen.
Wenn die Fragen nach dem Verhältnis von Ich und Welt und dem Seelenheil des Ichs in den Vordergrund rücken, wachsen auch Respekt und Achtung vor der Person jedes Individuums und damit das, was man gemeinhin Toleranz nennt. So geschah es in nennenswertem Maße – nach eher bescheidenen Anfängen in der Antike – erst wieder in den Zeiten von Renaissance und Reformation. Mit Fortentwicklungen bei zahlreichen Denkern des 17. Jahrhunderts, insbesondere bei Descartes (bon sens und Cogito), John Locke (1632-1704) und Pierre Bayle (1647-1706)
Im 18. Jahrhundert finden wir verstärkten Einsatz für Toleranz bei den französischen Aufklärern, vor allen bei Voltaire, Diderot, Rousseau und den anderen Enzyklopädisten.
Dazu äußert Voltaire sich in seiner Kampfschrift Abhandlung über die Toleranz anläßlich des Todes von Jean Calas (1763) und in dem Artikel „Tolérance“ seines Philosophischen Taschenwörterbuchs von 1764. Der Anfang des Artikels lautet:
„Was ist Toleranz? Toleranz ist die Mitgift der Humanität. Wir alle sind voller Schwächen und Irrtümer: Vergeben wir uns gegenseitig unsere Dummheiten! – dies sei das erste Gesetz der Natur.
Wenn an der Börse von Amsterdam, in London, in Surat oder Basra der gläubige Chinese, der Brahmane, der griechisch-katholische Christ, der römisch-katholische Christ, der protestan-tische Christ, der christliche Quäker miteinander Handel treiben, so zücken sie nicht ihre Messer gegeneinander, um Seelen für ihre Religion zu gewinnen. Warum haben wir uns dann seit dem Konzil von Nicäa fast pausenlos die Hälse durchgeschnitten? Konstantin begann mit einem Erlass, der alle Religionen erlaubte, doch er endete als Verfolger.“
Das Person-Sein des Menschen verbindet Voltaire hier sofort mit den weiten Horizonten von Natur, Geschichte und Humanität. Jeder Mensch hat Schwächen, kann sich irren und ist daher (fast wie bei Lamettrie) auf die Nachsicht seiner Mitmenschen angewiesen. Das gelingt – und zwar sogar interreligiös, inter-kulturell und international –, sobald, wie an der Börse, genügend starke gemeinsame Interessen vorhanden sind, nicht aber, wenn es ausschließlich um Fragen der Religion, also um „die letzten Dinge“ geht. Streit hierüber endet nur allzu oft verbrecherisch.
Lessing und Goethe
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hält Toleranz als bloßes Dulden, Erdulden und Ertragen (im Sinne des latein. ‚tolerare‘: ‚dulden, ertragen‘) für unzureichend. Vielmehr komme es darauf an, dem Mitmenschen nicht nur Duldsamkeit, sondern Mitgefühl, Respekt und Anerkennung entgegenzubringen (wozu Menschen ja auf Grund ihrer Empathiefähigkeit durchaus in der Lage sind). Goethe will also, dass der Mensch in seinem Person-Sein respektiert und anerkannt wird, was er ja auch in seinen literarischen Werken immer wieder exemplarisch dargestellt und betont hat.
Neben ihm und Kant gehört Gotthold Ephraim Lessing (1729-81) zu den bedeutendsten Vorkämpfern der deutschen Aufklärung. Inwieweit sein Toleranz-Begriff mit demjenigen Goethes übereinstimmt, wird zu klären sein. In seiner Fibel zur Erziehung des Menschen unterscheidet er folgende drei Stufen der sittlichen Entwicklung der Menschheit: 1. Der Mensch des Alten Testaments handelt sittlich gut, weil er dafür auf Erden belohnt wird; Leid empfängt er als „Lohn“ für seine Sünden. 2. Auf der christlichen Stufe wird die Belohnung für sittlich gutes Handeln ins Jenseits verlegt; wobei der Glaube an ein Jenseits Voraussetzung ist. 3. Der Mensch wird seine höchste Stufe erst dann erreichen, wenn er das Gute um des Guten und nur um des Guten willen tut. Womit Gottes Eingreifen überflüssig, Gott selbst zur „Hilfsfigur“, der Mensch aber autonom werden würde.
Somit bietet Lessing also ein dreistufiges Konzept der Vervollkommnung des Menschen an. Für die Toleranz-Idee maßgeblich wird dieses Konzept in seinem Drama Nathan der Weise (1779), mit dem er vor allem die Gegensätze zwischen Judentum, Christentum und Islam überwinden will. Am Ende der vielzitierten Ringparabel des Nathan mahnt der Richter:
„Es strebe jeder um die Wette, / Die Kraft des Steins in seinem Ring‘ an Tag / Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut, / Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, / Mit innigster Ergebenheit in Gott, / Zu Hülf!“
„Ergebenheit in Gott“ entspricht aber exakt der Wortbedeutung des arabischen ‚islam‘! Was sicherlich kein Zufall ist, ohne dass daraus ein Bekenntnis Lessings zum Islam abzuleiten wäre. Es zeigt nur sein ehrliches Bemühen, auch nicht-christlichen Religionen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ohne deshalb das Wahrheitsproblem zu unterschätzen oder gar zu unterschlagen. Vielmehr geht es dem Richter im Nathan darum, „den fruchtlosen Streit um die Wahrheit aufzugeben und sich stattdessen durch praktisches Handeln zu bewähren“.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, wie differenziert Lessing das Wahrheitsproblem aufgefasst und analysiert hat. In seiner ‚Duplik‘ von 1778 stellt er fest: „Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgend ein Mensch ist, oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. () Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine Linke, und sagte: Vater gieb! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!“ Eine klare Absage an jede Art von Absolutheitsanspruch!
Fazit und Ausblick
„Nous avons tous assez de force pour tolérer les maux d’autrui.” (‘Wir haben alle genügend Kraft, um die Übel der anderen zu ertragen’.) Dieser Satz des Herzogs von La Rochefoucauld (1613-80) hat bis heute wahrscheinlich nichts von seiner Gültigkeit verloren. Im Alltag geraten wir immer wieder in Situationen, in denen wir unsere eigenen Schwächen und die unserer Mitmenschen ertragen müssen, auch wenn es uns schwerfällt. Die Forderung nach Toleranz begleitet uns allenthalben und immer wieder.
Schon deshalb ist es verfehlt, die Toleranz-Idee als „verstaubt“ und unzeitgemäß zu bezeichnen, wie dies Hendryk M. Broder (geb. 1946) in einem NDR-Interview vom 15.11.2014 tut. Es stimmt auch nicht, dass Toleranz nur „von oben herab“, d.h. wie in vertikal organisierten Gesellschaften längst vergangener Zeiten, den Untertanen von ihren Herrschern gnädig verliehen wird. Toleranz ist vielmehr ein tagtäglich und überall zu respektierender Wert der Person.
Genau dies war das Anliegen von Goethe, Lessing und anderen vor und nach ihnen. Sie erweitern die Toleranz-Idee um die Dimensionen des Respekts und der Anerkennung und lassen sie damit zu einem unverzichtbaren Teil des Person-Seins werden. – Bloßes Ertragen bedeutet noch keine Anerkennung der Person. Aber ohne Ertragen gibt es keine Anerkennung. Woraus folgt, dass wir den Mitmenschen in seiner Personalität anerkennen sollen, nämlich u.a. als Rechtsperson und als natur- und geistbestimmtes gesellschaftliches Wesen. (Vgl. Robra 2015, S. 231 ff.)
Zum Humanitäts-Ideal des Deutschen Idealismus
Friedrich Schiller (1759-1805) war es vergönnt, das klassische Humanitätsideal in einer neuen, Kunst-, Gesellschafts- und Staatsphilosophie zu vollenden, und zwar u.a. in der Abhandlung Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795). Darin fordert er einen ästhetischen Vernunft-Staat und sieht in der Kunst geeignete Mittel zu dessen Verwirklichung. Sein und Schein, Geist und Natur, Pflicht und Neigung soll der Mensch allmählich in Einklang bringen. Das kann vor allem durch die Kunst gelingen, weil sich in ihr Materie und Geist, Inhalt und Form, Vernunft und Sinnlichkeit miteinander verbinden.
„ der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“, sagt Schiller. Der Spieltrieb könne die Spannungen zwischen Bewusstem und Unbewusstem beheben. Am Ende steht ein „ästhetischer Staat“, wozu Schiller ausführt:
„Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze baut der ästhetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.Wenn in dem dynamischen Staat der Rechte der Mensch dem Menschen als Kraft begegnet und sein Wirken beschränkt – wenn er sich ihm in dem ethischen Staat der Pflichten mit der Majestät des Gesetzes entgegenstellt und sein Wollen fesselt, so darf er ihm im Kreise des schönen Umgangs, in dem ästhe-tischen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur als Objekt des freien Spiels gegenüber-stehen. Freiheit zu geben durch Freiheit, ist das Grundgesetz dieses Reichs.“ – Und in diesem „Reich des ästhetischen Scheins“ werde sogar das „ Ideal der Gleichheit “ verwirklicht. (In: Schriften zur Philosophie und Kunst, München 1959, S. 147 u. 149.)
Leider konnte diese schöne Utopie bisher nirgendwo verwirklicht werden. Unklar scheint mir die Rolle des Staates. Auch ein ästhetischer Staat der Gleichen ist immer noch ein Staat! Aber braucht man ihn noch, wenn alle Menschen „gleich“ sind?
Eine radikale Lösung für dieses Problem schlägt der anonyme Verfasser (Hegel, Schelling oder Hölderlin?) des Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus (1796 oder 1797) vor. Ausgehend von sich selbst als einem „absolut freien Wesen“ erklärt er den Staat zum Feind jeglicher Freiheit: „Die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, daß es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig es als eine Idee von einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus! – Denn jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.“ (Was später immerhin auch u.a. Marx und Nietzsche gefordert haben!) – Was aber soll an die Stelle des Staates treten? Hierzu finden sich im Ältesten Systemprogramm wiederum nur utopische Idealvorstellungen. Zunächst müsse eine neue, allgemein verständliche, philosophische „Mythologie“ erarbeitet werden, um „das Volk vernünftig“ und „die Philosophen sinnlich“ zu machen. Erst nach dieser Aufhebung des Gegensatzes zwischen dem Volk und seiner geistigen Elite sei zu erwarten: „ gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden. Dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit aller Geister! –“.
Aber nur scheinbar schließt der Autor sich damit den wie selbstverständlich erhobenen (und großenteils durchgesetzten!) Forderungen der amerikanischen und französischen Revolu-tionäre an. Denn in seinem darauf folgenden Schlusssatz erschrickt er offensichtlich vor der eigenen Courage, indem er ausruft: „Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muß diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das letzte größte Werk der Menschheit sein.“ Das ist eine klare Absage an jegliche politische Aktion, jeglichen unmittelbaren Freiheitskampf – was für nicht wenige deutsche Intellektuelle jener Zeit typisch war. Vor der miserablen politischen Realität flüchtet man sich in schöne Utopien – ein Vorgeschmack auf die deutsche Romantik! (Vgl.: Anton Friedrich Koch (Hg.): Lust an der Erkenntnis. Die klassische deutsche Philosophie, München 1989, S. 305-307.)
Das große Thema Freiheit spielt nichtsdestoweniger bei den Deutschen Idealisten, vor allem bei Fichte und Schelling, eine überragende Rolle. Kant hatte – wie nach ihm auch Schiller – eine ursprüngliche Freiheit des Menschen angenommen, aber nicht naturrechtlich, sondern unabhängig von allen Naturgegebenheiten. Der Mensch könne aus sich heraus „Neues beginnen“, zumal sein Erkenntnisvermögen eine völlig freie „Synthesis a priori“, eine ursprüngliche, rein geistige Fähigkeit zum Zusammensetzen und Zusammenfassen beinhalte. (Ein Vermögen, von dem man inzwischen annimmt, dass es vollständig durch Erbanlagen, Umwelt und Sozialisation erklärt werden kann!)
Fichte und Schelling nehmen jedenfalls Bezug auf diesen Freiheitsbegriff Kants. Fichte erklärt Freiheit vor allem auf Grund von Setzungen des vom Nicht-Ich abgegrenzten Ichs, während Schelling immer wieder die Theologie, sozusagen als „Magd der Philosophie“, bemüht, bis hin zur „vollkommenen Aktualisierung Gottes“, so dass ein ideologischer Freiheits-Mischmasch entsteht, den zu entmischen hier nicht meine Aufgabe ist. – Übrigens definierte Hegel Freiheit u.a. als „Einsicht in die Notwendigkeit“, wobei es jedoch keine Notwendigkeit ohne Freiheit geben könne.
In der Ästhetik geht Schelling ähnlich weit wie Schiller, wobei er allerdings die Kunst höher stellt als alles andere. In seiner Philosophie der Kunst beschreibt Schelling zunächst die Entwicklung der unterschiedlichen Kunstformen, wobei die Kunst selbst im Göttlichen wurzele. In seinem Werk drücke der Künstler nicht nur Subjektives, nicht nur sich selbst aus, sondern auch Objektives, das bis an die Unendlichkeit heranreichen könne.
In der Natur sieht Schelling einen „unbewussten Geist“ am Werk, dessen höchstes Produkt sie, die Natur, sei. Die Kunst aber überhöhe und vollende diesen Geist, indem sie Anschauung, Denken, Erkennen und Handeln verbinde. Dadurch erst komme der Mensch zu sich selbst, so dass die Kunst (einschließlich der göttlichen Schöpfungsmacht) allem anderen überzuordnen sei.
Eine ganz andere Hierarchie stellt Schellings Studienfreund Hegel (1770-1831) auf, nämlich in der aufsteigenden Stufenfolge Kunst < Religion < Philosophie, die er für Durchgangs-stadien bzw. Steigerungsformen des „Absoluten Geistes“ hält. Der Philosoph übertreffe den Künstler, weil er sich nicht mit der Aktualisierung des Schöpferischen begnügt, sondern darüber nachdenkt. Religion übertreffe die Kunst, weil in ihr Schöpfertum und Geschöpf-lichkeit zusammenkommen, so dass weitere, die gesamte Wirklichkeit umgreifende Horizonte entstehen.
Philosophie aber entwickele sich dialektisch aus Kunst und Religion, und zwar schon als Kunstphilosophie (Ästhetik) und Religionsphilosophie. (In seiner Ästhetik stellt Hegel übrigens eine weitere Hierarchie dar, und zwar eine Rangfolge der Künste, in der er der Dichtkunst den obersten Platz zuweist.) – Philosophie aber übertrage außerdem Glauben in Wissen – „absolutes Wissen“ und „absoluten Geist“. –
Und was steht nun tatsächlich „über allem“? Die Kunst, die Religion oder die Philosophie? Welcher Werte-Hierarchie sollen wir zustimmen? Darüber zu befinden, überlasse ich gern dem verehrten Publikum! Wobei ich allerdings hinzufügen muss, dass ich bei den Deutschen Idealisten zum Person-Sein des Menschen – und damit möglicherweise zu seinem eigent-lichen Wert – nur wenig, allzu wenig gefunden habe. Was mich allerdings keineswegs veranlasst, eine „Absolute Person“ an die Stelle des „Absoluten Geistes“ zu setzen.75
Der Neuhumanismus von Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
„Die letzte Aufgabe unseres Daseyns: dem Begriff der Menschheit in unserer Person, sowohl während der Zeit unseres Lebens, als auch noch über dasselbe hinaus, durch die Spuren des lebendigen Wirkens, die wir zurücklassen, einen so großen Inhalt, als möglich, zu verschaffen, diese Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung. Diess allein ist nun auch der eigentliche Massstab zur Beurtheilung der Bearbeitung jedes Zweiges menschlicher Erkenntniss. Denn nur diejenige Bahn kann in jedem die rich- tige seyn, auf welcher das Auge ein unverrücktes Fortschreiten bis zu diesem letzten Ziele zu verfolgen im Stande ist, und hier allein darf das Geheimniss gesucht werden, das, was sonst ewig todt und unnütz bleibt, zu beleben und zu befruchten.“
„Der Mensch soll seinen Charakter, den er einmal durch die Natur und die Lage empfangen hat, beibehalten, nur in ihm bewegt er sich leicht, ist er thätig und glücklich. Darum soll er aber nicht minder die allgemeinen Forderungen der Menschen befriedigen und seiner geistigen Ausbildung keinerlei Schranken setzen. [...] Der Mensch kann wohl in einzelnen Fällen und Perioden seines Lebens, nie aber im Ganzen Stoff genug sammeln. Je mehr Stoff er in Form, je mehr Mannigfaltigkeit in Einheit verwandelt, desto reicher, lebendiger, kraftvoller, fruchtbarer ist er. Eine solche Mannigfaltigkeit aber giebt ihm der Einfluss vielfältiger Verhältnisse. Je mehr er sich demselben öfnet, desto mehr neue Seiten werden in ihm angespielt, desto reger muss seine innere Thätigkeit seyn, dieselben einzeln auszubilden, und zusammen zu einem Ganzen zu verbinden.“ (W. v. Humboldt, in: Wikipedia: Wilhelm von Hum-boldt)
In seinem Beitrag Humboldt und der Neuhumanismus (2015) schreibt Michael Lausberg über
„Humboldts Bildungsideal
Wilhelm von Humboldt (1767-1835), der mit Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe befreundet war, übte seit 1801 den Posten des preußischen Gesandten in Rom aus. 1809-1810 wurde Humboldt Leiter des preußischen Bildungswesens im Innenministerium und Gründer der Universität in Berlin. Danach bekleidete er das Amt des preußischen Gesandten in Wien, Frankfurt/Main und London aus. Nach einem Erlass des preußischen Königs wurde er 1819 Innenminister Preußens. Seitdem lebte er hauptsächlich für seine Forschungen, insbesondere ausgedehnte Sprachstudien. Humboldt beeinflusste maßgeblich die Umgestaltung des preußischen höheren Schulwesens einschließlich der Gymnasial-lehrerausbildung im Sinne des Neuhumanismus.
Der Neuhumanismus ist eine Bildungs- und Geistesbewegung, die um 1750 zuerst an der Universität Göttingen entstand. Sie betonte in neuer Hinwendung zum klassischen Altertum und im Kampf gegen die Formalisierung des altsprachlichen Unterrichts den menschlichen Gehalt der antiken Kulturgüter. Gegen den (Gemein-)Nutzen der Aufklärungspädagogik setzte der Neuhumanismus den Wert der Individualität jedes Einzelnen, die in der Schul-erziehung ohne Rücksicht auf gesellschaftliche und aktuelle Bedürfnisse ausgebildet werden müsse. Die Sprache gilt dabei als Zentrum des Menschseins, über eine formale sprachliche Bildung gelangt der Mensch also zu sich selbst. Das Erlernen der alten Sprachen, vor allem des Griechischen, diene diesem Zweck vorzüglich, weil sie die Strukturen von Sprache reiner repräsentieren könnten. Daraus folgt für Humboldt, dass sie zu lernen auch dem künftigen Tischler gut tue, was in der weiteren Schulgeschichte allerdings weitgehend ein theoretisches Postulat blieb. Zusätzlich erhält jeder Lernende gerade über die griechische Sprache einen materiellen Zugang zu einer als ideal gedeuteten Kultur, die als Quelle geistiger Inspiration im Gegensatz zur zerrissenen, gefährdeten, antihumanen Gegenwart stehe. Der Weg zur Freiheit und zur Fähigkeit, dem bloß Aktuellen geistig widerstehen zu können, führe über humanistische Bildung. Jegliche berufliche Ausbildung sollte für Humboldt erst später erfolgen, der richtig gebildete Mensch werde aber mit seinen Energien im Berufsleben für die Gesellschaft umso mehr leisten können. Im humanistischen Gymnasium stehen daher die alten Sprachen völlig im Vordergrund, wenn auch gegen Humboldts Intentionen aus schul-praktischen Bedürfnissen bald das Lateinische dem Griechischen wieder vorangestellt wurde.
.....
Für Humboldt war Bildung eine eigengesetzliche und selbstzweckliche Form des Geistes. Sie besteht in der harmonischen Entfaltung der menschlichen Kräfte zu einem Ganzen, zu der universalen, totalen und individuellen Einheit.
In Übereinstimmung mit dieser Bildungsidee hat er das preußische Bildungswesen auf reine Menschenbildung ausgerichtet, unter weitesgehender Ablehnung der Standes- und Berufs-bildung. In der Einleitung zu seinem Werk über die altjavanische Sprache (Über die Verschie-denheit des menschlichen Sprachbaues) entwickelte er seine Auffassung vom organischen Charakter der Sprache, die in der Feststellung gipfelt, dass Sprache nicht zuerst Werk, sondern Tätigkeit ist. Damit gab er eine der Grundlagen der neueren Sprachwissenschaft und zugleich des Sprachunterrichts.
Er galt als liberaler Verfechter des Humanitätsideals. So hatte er in seiner 1792 verfassten Abhandlung „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestim-men“ geschrieben: „Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerläßliche Bedingung. () Gerade die aus der Vereinigung Mehrerer entstehende Mannigfaltigkeit ist das höchste Gut, welches die Gesellschaft gibt, und diese Mannigfaltigkeit geht gewiß immer in dem Grade der Einmischung des Staates verloren. Es sind nicht mehr eigentlich die Mitglieder einer Nation, die mit sich in Gemeinschaft leben, sondern einzelne Untertanen, welche mit dem Staat, d. h. dem Geiste, welcher in seiner Regierung herrscht, in Verhältnis kommen, und zwar in ein Verhältnis, in welchem schon die überlegene Macht des Staats das freie Spiel der Kräfte hemmt. Gleichförmige Ursachen haben gleichförmige Wirkungen. Je mehr also der Staat mitwirkt, desto ähnlicher ist nicht bloß alles Wirkende, sondern auch alles Gewirkte. () Wer aber für andere so räsoniert, den hat man, und nicht mit Unrecht, in Verdacht, daß er die Menschheit mißkennt und aus Menschen Maschinen machen will.“
Die universitäre Bildung soll keine berufsbezogene, sondern eine von wirtschaftlichen Interessen unabhängige Ausbildung sein.
Akademische Freiheit heißt zunächst äußere Unabhängigkeit der Universität. Die Universität soll sich staatlichen Einflüssen entziehen. Humboldt fordert, dass sich die wissenschaftliche Hochschule „von allen Formen im Staate losmachen“ sollte. Daher sah seine Universitäts-konzeption vor, dass beispielsweise die Berliner Universität eigene Güter haben sollte, um sich selbst zu finanzieren und dadurch ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu sichern. Akademische Freiheit verlangt neben der äußeren Unabhängigkeit der Universität von staatlichen und wirtschaftlichen Zwängen auch die innere Autonomie, d. h. die freie Studienwahl, die freie Studienorganisation und das freie Vertreten von Lehrmeinungen und Lehrmethoden. Die Universität soll deshalb ein Ort des permanenten öffentlichen Aus-tausches zwischen allen am Wissenschaftsprozess Beteiligten sein. Die Integration ihres Wissens soll mit Hilfe der Philosophie zustande kommen. Diese soll eine Art Grund-wissenschaft darstellen, die es den Angehörigen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen erlaubt, einen Austausch ihrer Erkenntnisse zustande zu bringen und sie miteinander zu verknüpfen. Das humboldtsche Bildungsideal bestimmte lange Zeit die deutsche Universitäts-geschichte entscheidend mit, auch wenn es niemals praktisch zur Gänze realisiert wurde oder realisierbar ist. Große intellektuelle Leistungen der deutschen Wissenschaft sind damit verbunden.
Humboldt ließ dieses Ideal als Leiter der Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts im preußischen Innenministerium in die Bildungsreformen einfließen. In der konkreten Politik erstreckte es sich nicht auf die preußischen Volksschulen, die neben den Universitäten ebenfalls der Sektion unterstanden.
Das humboldtsche Bildungsideal entwickelte sich um die beiden Zentralbegriffe der bürger-lichen Aufklärung: den Begriff des autonomen Individuums und den Begriff des Weltbürger-tums. Die Universität sollte ein Ort sein, an dem autonome Individuen und Weltbürger hervorgebracht werden bzw. sich selbst hervorbringen. Ein autonomes Individuum soll ein Individuum sein, das Selbstbestimmung und Mündigkeit durch seinen Vernunftgebrauch erlangt.
Hier wird der Bezug auf Kant ersichtlich. In der Schrift „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ sind die Gedanken Kants zur Geschichts- und Erziehungsphilosophie abzulesen: ...“76
Zum Menschenbild der Romantik
Exemplarisch hierfür steht das Werk von Novalis (1772-1801, eigentlich: Friedrich von Hardenberg). In seinen Hymnen an die Nacht (ca. 1800) macht er die Nacht zum Tage und den Tag wiederum zur Nacht, oder besser: zu einer Ausgeburt der Nacht, so dass auch hier die Grenzen verschwimmen. Darin präsentiert er u.a. ein großartiges fiktives Welttheater, wenn auch in metaphysisch überhöhter und verklärter Form, dazu stets in hochpoetischer, ent-husiastischer Sprache, so am Ende der 1. Hymne: „Preis der Weltkönigin, der hohen Verkün-digerin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe – sie sendet mir dich – zarte Geliebte – liebliche Sonne der Nacht, – nun wach ich – denn ich bin Dein und mein – du hast die Nacht mir zum Leben verkündet – mich zum Menschen gemacht – zehre mit Geisterglut meinen Leib, daß ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht währt.“
Autobiographisches – den Tod seiner geliebten Sophie – vermischt der Autor mit religiösen Nacht-Gedanken, wobei er immer wieder kühne poetische Bilder verwendet, so (Wider-sprüchliches vereinigend) das Oxymoron: „liebliche Sonne der Nacht“, die ihn „zum Menschen gemacht“ hat und nun seinem vergeistigten Leib eine „ewig“ währende „Braut-nacht“ schenken soll. – Raumlos und zeitlos bietet die Nacht ein „neues Land“, utopisch weit und hoch über dem „Treiben der Welt“ (4. Hymne), ewige Ruhe verheißend.
Trotz dieser Schlüsselfunktion der Nacht entwertet der Autor das reale Tag-Werk nicht, im Gegenteil, er will sich aktiv beteiligen; wo immer er gebraucht wird, will er „die fleißigen Hände rühren“, denn auch der Tag hält Wundersames bereit, sogar „ sinnvollen Gang “, der zu rastlosem Einsatz motiviert. Und doch heißt es schon unmittelbar danach: „Aber getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz, und der schaffenden Liebe, ihrer Tochter.“ Grundlage des Tages bleibt also die Nacht mit ihrer wertvollen Frucht, der Liebe, die Ewigkeit gewähren soll.
Die Nacht bringt auch den Schlaf, der ewig wird in seinem Bruder, dem Tod. Und dessen Schrecken Christus, der Auferstandene, beendet, so dass etwas völlig Neues, eine neue Zeit, beginnt (5. Hymne). Erstaunlicher- und sinnigerweise ist es ein griechischer (!) Sänger, der nach Palästina kommt, um Jesus zu huldigen, weil dieser die „tiefe Traurigkeit“ beseitigt habe. Jesus Christus löst das letzte Geheimnis der Welt, beendet allen Schmerz, öffnet die Herzen der Menschen für wahre, unendliche, ewige Liebe: „Getrost, das Leben schreitet / Zum ewgen Leben hin; / Von innrer Glut geweitet / Verklärt sich unser Sinn. / Die Sternwelt wird zerfließen / Zum goldnen Lebenswein, / Wir werden sie genießen / Und lichte Sterne seyn.“ (ebd.)
Dieser Traum soll den Menschen ein Leben lang begleiten – bis in den Tod hinein, und ihn dort „zu der süßen Braut, zu Jesus, dem Geliebten“ führen, den er hier am Schluss nochmals erwähnt, nachdem er zuvor schon – gut katholisch – dessen Mutter Maria in höchsten Tönen gepriesen hat. „Ein Traum bricht unsre Banden los / Und senkt uns in des Vaters Schooß.“, lauten die beiden letzten Verse des Poems.
Tätigkeit, Traum, Sehnsucht, Liebe, Unendlichkeit, Geheimnis, Ewigkeit – sie erweisen sich als Grundbegriffe, Grund- Werte der Hardenbergschen Romantik. Alle Menschen sollen sie erfahren und ergreifen. Formvollendet zur Sprache bringen kann sie dennoch nur der begnadete Dichter, was widersprüchlich erscheinen mag, wenn man bedenkt, dass Novalis die Wahrheit nicht bei den „tiefgelehrten“ Geistesgrößen sucht, sondern in den individuellen (Gefühls-) Welten aller Menschen, so wenn er bekundet:
„Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren / Sind Schlüssel aller Kreaturen, / Wenn die, so singen oder küssen, / Mehr als die Tiefgelehrten wissen, / Wenn sich die Welt ins freie Leben, / Und in die Welt wird zurück begeben, / Wenn dann sich wieder Licht und Schatten / Zu echter Klarheit werden glatten / Und man in Märchen und Gedichten / Erkennt die ew’gen Weltgeschichten, / Dann fliegt vor einem geheimen Wort / Das ganze verkehrte Wesen fort.“
Deutlicher noch als in den Hymnen an die Nacht gibt Novalis hier zu erkennen, dass er das Heil der Welt keineswegs nur im Jenseits sucht, auch wenn er „Licht und Schatten“, Geschichte und Ewigkeit in der Dichtung miteinander verbinden will. Das „freie Leben“ – und nicht mehr das „verkehrte Wesen“ – soll Ziel und Inhalt der Welt werden. Das bedeutet Gesellschaftskritik, utopische Hoffnung und konkreten Aufruf zur endgültigen Umgestaltung der Welt durch Kunst und Religion.
Was Novalis geschaffen hat, scheint tatsächlich eine neue Mythologie, vielleicht auch im Sinne des Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus (s.o.) zu sein. – Trotzdem bleibt die bange Frage, ob solche Romantik auch die politische Emanzipation entscheidend voranzubringen vermag. (Abgesehen von den in der Romantik tatsächlich erzielten Fort-schritten der Frauen-Emanzipation.) Gesamtgesellschaftliche politische Emanzipation war ja das wichtigste Anliegen, das wichtigste Vermächtnis nicht der Romantik, wohl aber der von ihr heftig kritisierten Aufklärung.
Dagegen deutet vieles darauf hin, dass die Romantiker/innen sich poetische Luftschlösser bauen, um ihre eigene politische Resignation und Ohnmacht zu überspielen. Furchtbar enttäuscht waren fast alle vom Ausgang der Französischen Revolution, aber auch – nach anfänglicher Begeisterung – von Napoleon Bonaparte. Nach 1806 schließen sich viele Romantiker dem deutschen Hurra-Patriotismus der „Befreiungskriege“ an, aber mit der ab 1815 um sich greifenden Restauration fallen viele erneut in politische Abstinenz und Apathie zurück. (Vgl. Robra 2015, S. 267 ff.)
E) Atheistischer und sozialistischer Humanismus: von Marx zu Bloch
Karl Marx (1818-1883)
entwickelt seine humanistischen Anschauungen u.a. in einer Auseinandersetzung mit der naturalistischen Anthropologie von Ludwig Feuerbach (1804-1872). Die erste seiner 1845 er-schienen 11 Thesen über Feuerbach lautet:
„Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus – der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt – entwickelt Feuerbach will sinnliche – von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedne Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Er betrachtet daher im Wesen des Christenthum nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche, während die Praxis nur in ihrer schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und fixiert wird. Er begreift daher nicht die Bedeutung der „revolutionären“, der „praktisch-kritischen“ Tätigkeit.“
Damit äußert Marx bereits seinen Hauptvorwurf: Feuerbach kritisiere zwar zu Recht den Idealismus, gelange dabei aber nicht über einen objektivierenden Naturalismus hinaus, so dass er den Menschen zwar als sinnliches Wesen, nicht aber als „praktisch-kritisches“ Subjekt auf-fasse (was er in These 5 bekräftigt). Solch direkte Kritik erweitert Marx in den Thesen 4, 6 und 7; im Einzelnen: Feuerbach erkennt zwar „die religiöse Selbstentfremdung des Menschen“ in deren weltlicher Grundlage, nicht aber die (angebliche) Notwendigkeit, deren Widersprüche schonungslos aufzudecken und vernichtend zu analysieren. – These 6: Feuerbach erklärt die Religion anthropologisch, verfehlt aber dennoch das tatsächliche menschliche Wesen, weil er es nicht aus dem „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ zu erklären vermag. These 7: „Feuerbach sieht daher nicht, daß das „religiöse Gemüt“ selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und daß das abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört.“
In den übrigen Thesen skizziert Marx seinen humanistischen Materialismus, wobei der Mensch im Mittelpunkt der gesellschaftlich vermittelten Praxis steht. Auch die Wahrheits-frage müsse in der Praxis stets neu bearbeitet und gelöst werden, wobei zu beachten sei, dass die Menschen selbst ihre Lebensumstände gestalten, so dass auch „der Erzieher selbst erzogen werden muß“, um sich an der notwendigen revolutionären Praxis beteiligen zu können.
Der alte, herkömmliche Materialismus bleibe rein kontemplativ, d.h. der „Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesellschaft“ verhaftet, während der neue Materia-lismus die gesamte gesellschaftliche Praxis einbeziehe, d.h. „die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit“. Weil aber die dabei auftretenden Probleme nur durch die proletarische Revolution zu bewältigen seien, lautet Marxens abschließende, resümierende 11. These:
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“
Dem entspricht Marxens Humanismus im Ganzen, den er auch als Synthese aus Humanismus und Naturalismus bezeichnet. Feuerbach habe als erster erkannt, dass Hegel Mensch und Natur als bloße Gegenstände der absoluten Idee und daher letztlich als „Nichtigkeiten“ miss-verstanden habe. Feuerbachs „große Tat“ bestehe darin, der Negation der Negation „das auf sich selbst ruhende und positiv auf sich selbst begründete Positive“ entgegengestellt zu haben.77 Was allerdings nicht bedeutet, dass Marx nunmehr zum Positivisten wird und auf die Dialektik verzichtet!
Marx stützt sich offenbar auf Feuerbachs Anthropologie, wenn er das Wesen des Menschen u.a. wie folgt bestimmt: „Der Mensch als ein gegenständliches sinnliches Wesen ist ein leidendes und, weil sein Leiden empfindendes Wesen, ein leidenschaftliches Wesen. Die Leidenschaft, die Passion ist die nach seinem Gegenstand energisch strebende Wesenskraft des Menschen“ (a.a.O. S. 651 f.). Bei der Entwicklung seiner neuen Gegenständlichkeits-theorie geht Marx jedoch über den Standpunkt Feuerbachs hinaus, indem er feststellt: „Wenn der wirkliche, leibliche, auf der festen wohlgerundeten Erde stehende, alle Naturkräfte aus- und einatmende Mensch seine wirklichen, gegenständlichen Wesenskräfte durch seine Ent-äußerung als fremde Gegenstände setzt, so ist nicht das Setzen Subjekt; es ist die Subjektivität gegenständlicher Wesenskräfte, deren Aktion daher auch eine gegenständliche sein muß“ (S. 649).
Marx kennzeichnet solche Vergegenständlichung zunächst als praktische, gesellschaftliche Tätigkeit. Der andere Mensch begegnet dem Menschen gerade im und am Gegenstand der Arbeit, wobei Natur und Mensch eine Einheit bilden, in der sich erst Freiheit bilden und verwirklichen kann.
In der kapitalistischen Gesellschaft wird die freie Vergegenständlichung des Menschen jedoch verhindert, weil die auf dem Privateigentum beruhende Ausbeutung stets zur Entfremdung führt. Erforderlich erscheint daher die Aufhebung des zur Ausbeutung geeigneten („funk-tionierenden“) Privateigentums an den Produktionsmitteln, und zwar nicht durch „Zurück-nahme des Gegenstands ins Bewußtsein“, sondern durch revolutionäre Aneignung des Gegenstands. In dieser Negation der Negation erkennt Marx eine Voraussetzung dessen, was Feuerbach als „das positiv auf sich selbst begründete Positive“ bezeichnet.
In diesem Sinne nennt Marx seine Lehre einen „ durchgeführten Naturalismus oder Huma-nismus “, der „sich sowohl von dem Idealismus als dem Materialismus unterscheidet, und zugleich ihre beide vereinigende Wahrheit ist“ (S. 649). Als geselliges, gesellschaftliches Wesen (das ‚zoon politikon‘ des Aristoteles) ist der Mensch vollkommen auf die Gesellschaft angewiesen, um nicht nur ein natürliches, sondern auch ein wahrhaft menschliches Wesen sein zu können: „Also die Gesellschaft ist die vollendete Wesenseinheit des Menschen mit der Natur, die wahre Resurrektion der Natur, der durchgeführte Naturalismus des Menschen und der durchgeführte Humanismus der Natur“ (S. 596).78
Ernst Bloch (1885-1977)
Aufrechter Gang, gelehrte Hoffnung, konkrete Utopie. Wir genießen das Privileg des Auf-recht-Gehens, und dass unsere Hoffnungen gelehrt, unsere Utopien konkret sein können. Das Schlusskapitel von Blochs Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung (1959) trägt die Überschrift: » Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.«79 Es ist ein Ausspruch von Marx, dem dieser al-lerdings „den kategorischen Imperativ“ vorangestellt hatte, um die Unbedingtheit der Forde-rung zu betonen, endlich jegliche Form von Unterdrückung, Ausbeutung, Verelendung und Ausgrenzung zu beenden. Nicht kantisch „kategorisch“, aber nicht weniger überzeugend, schließt Bloch sich der Marxschen Forderung an. Humanität, Menschlichkeit für alle – bisher nur ein Traum, eine Illusion?
Blochs Werk tönt anders, nämlich wie ein humanistisch-sozialistisches Manifest par ex-cellence, und zwar nicht nur im ‚ Prinzip Hoffnung‘, sondern auch in anderen bahnbrechen-den, richtungsweisenden Arbeiten wie Geist der Utopie, Erbschaft dieser Zeit, Naturrecht und menschliche Würde, Das Materialismusproblem, Politische Messungen, Experimentum Mundi. Die Materie – konzipiert als „unvollendete Entelechie“ – liegt allem Mensch-Sein zu Grunde: „Jedenfalls bildet das Leibliche die Unterlage, und kein Tanz geht vor dem Essen. Ein Geist für sich und nichts als Geist, ganz ohne Stoff, ist noch nie gewesen. Das sogenannte Unten wirkt mit, und was sich sozusagen darüber hebt, kommt nie nur aus sich selber.“80 Was durchaus auch für den Geist der Utopie (1923) gilt, denn „nichts ist fertig, nichts ist bereits geschlossen, nichts ist zentral gediegen“ und: „Was der Mann ist, sieht er vor sich ziehen; aber wenn es wieder in ihn einkehrt, zurückkommt und mit ihm, dem Erhörten, Gewonnenen, produktiv Angetroffenen, letztlich wieder adäquat wird, dann ist es weiblicher Natur. Er hat das Ideelle nicht nur nach Goethes geheimnisvollem Wort in weiblicher Form konzipiert, sondern das Letzte, das den Menschen überhaupt erwartet, ist nach Gestalt und Wesen das Weib.“81
In Erbschaft dieser Zeit (1935) erklärt Bloch den Sozialismus zum Betreiber der „gesamten Substanz der Geschichte“; aber es gibt „mehrschichtige Dialektik“: Das Proletariat soll den Ton angeben, doch vielfach Widersprüchliches, Widersacherisches, „Irrationales“, Unab-gegoltenes steht dem (noch) entgegen.
Naturrecht und menschliche Würde (1961). Bloch benennt den „Kern der Freiheit“ zunächst als relative Wahlfreiheit, als Aufrechten Gang, revolutionär errungene Selbstbestimmung; was ebenso auch für die Gleichheit und die brüderliche Solidarität zu gelten habe: „Der Freiheits-kampf erzeugt Gleichheit; die Gleichheit als Ende der Ausbeutung und Abhängigkeit erhält die Freiheit, die Brüderlichkeit lohnt eine Gleichheit, worin es keiner mehr nötig hat, ja über-haupt in der Lage ist, dem anderen ein Wolf zu sein.“ (a.a.O. S. 194)
Demgemäß: Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz (1970/1977). Mit Erinnerungen an die Zeit von 1914 bis 1973, dem Jahr, als Bloch im jugoslawischen Korĉula die heimatlose Linke bedauert und den Niedergang der Sowjetunion beklagt, aber auch den Marxismus als „den endlich begriffenen Weg zur Beförderung der Humanität“ beschreibt und die „Rettung der Moral“ beschwört (a.a.O. S. 197 bzw. 236 ff.).
Schließlich: Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis (1975/77), das Bloch dem Andenken Rosa Luxemburgs widmet. Logik, Erkenntnis, Kategorien, Ideo-logiekritik, Pluralismus (!), Theorie-Praxis und ‘Was Mensch sei‘ spielen hier eine Rolle: „Wir sind uns selber übersteigend, aber auch alles in unserem Umkreis. Nichts darin ist ein-fach gegeben, alles darin ist uns aufgegeben. Undeutlicher, folglich deutlicher als irgendetwas ist der Mensch selbst das Unfertige schlechthin. Er begann, was kein Tier begonnen hatte, sprang aus allen erlangten Tierarten heraus, blieb unruhig. Das trotz wie wegen der fast schutzlosen Ausstattung, mit der er auftrat, ohne Zähne. Krallen, Fell. Aber er hat es nicht bloß auf die Füße gestellt, sondern als einziger auf den Kopf und so seine schwierige Ge-schichte selber gemacht, auch dort, wo er das nicht weiß.“ Und: „Der Vorhang ist nicht zu und alle Fragen sind hier nicht nur offen; weiß man noch nicht, was der Mensch ist, so weiß man doch, was unmenschlich ist, auch ohne daß man schon genau wissen kann, was menschlich sei. Man hat die Kenntnis und die Richtung, das Unmenschliche zu durchschauen, den Haifisch ursächlich außer Kraft zu setzen.“ (a.a.O. S. 172 bzw. 173)
Das Prinzip Hoffnung (1959)
In dem letztgenannten Sinne kann auch das ganze, 1657 Seiten starke Prinzip Hoffnung als humanistisches Manifest gelesen werden. Berühmt und oft bemüht sind daraus Zitate wie „Die Hoffnung muss enttäuschbar sein, sonst wäre sie keine Hoffnung, sondern Zuversicht.“ Oder: „Wir sind, aber wir haben uns nicht, darum werden wir erst.“ Und: „Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglichkeiten.“ Dem entsprechen gelehrte Hoffnung (docta spes) und Konkrete Utopie. Obwohl alles „leer“ beginnt, weil man (noch) nicht hat, was man eigentlich will. Wobei unversehens schon ein weiteres zentrales Thema anklingt: das Noch-Nicht. Dem allerdings Einiges vorausgeht, so die „kleinen Tagträume“, die keimenden Begehrlichkeiten, auch wenn man „täglich ins Blaue hinein“ lebt (a.a.O. S. 21). Denn es gibt da etwas, das als „Drängen“ vonstatten geht. „ der Mensch lebt nicht, um zu leben, sondern »weil« er lebt.“ (S. 49) Dies im Streben und Wünschen und in „umfänglichen“ Triebregungen, stets mit dem Leib dahinter und darunter. Aber Bloch ahnte schon, was neuere Forschungen bestätigen82: „ nichts im Leib lässt Triebe zu ihren eigenen Trägern machen“ (S. 53), denn das Es kontrolliert sich ständig selbst durch die im Gedächtnis gespeicherten Normen der Vernunft. Was nicht bedeutet, dass mächtige Triebe wie die Libido zu unter-schätzen wären, zumal laut Freud sogar der Hunger der allgegenwärtigen Sexualität unter-zuordnen sei. Was jedoch den Ich-Trieben keinen Abbruch tut, im Gegenteil: „Das Ich besorgt die Abfuhr der Unlustgefühle durch Trieberfüllung, aber es besorgt diese Erfüllung auf seine Weise, nämlich zensierend, morralisierend und vor allem mit Rücksicht auf das Erreichbare, auf die »Realität«.“ (S. 57) Dies stets in (möglichst) harmonischem Einverneh-men mit dem Über-Ich, den Normen, Geboten, Verboten und Usancen, getragen vom immer wachen Gewissen. Und mit der Befähigung zur Trieb-Sublimierung, so in Sport, Kunst, Arbeit, Wissenschaft und frommen Werken der Nächstenliebe (caritas, agape). –
Sodann unterscheidet Bloch zwischen Tagträumen und Nachtträumen. Tagträume können sogar der Weltverbesserung dienen, werden zuweilen von Nachtträumen ab- und aufgelöst – und haben doch „das bessere Teil erwählt“ (S. 116), zumal als Bausteine des antizipierenden Bewusstseins; dies auf Grund der „Entdeckung des Noch-Nicht-Bewußten oder der Däm-merung nach vorwärts“ (S. 129). Wobei zunächst Hindernisse zu überwinden waren, vor allem in Form des „statischen Lebens und Denkens“, weit verbreitet im Bürgertum, angelegt schon in Platons rückwärts gewandter Anamnesis, wonach alles Wissen lediglich eine „Wie-dererinnerung an ein einstmals Geschautes“ in unvollkommenen Abbildern der im „Ideen-Himmel“ ansässigen „Urbilder“ sei.
Das Noch-Nicht entbehrt dagegen keineswegs der Bezüge zur Realität, zum Tätigsein, sogar als „utopische Funktion“, und zwar nicht zuletzt im „Tendenzsinn des philosophischen Sozia-lismus“ (S. 165). Auch wenn konkret Utopie auf Probleme stößt, die z.B. durch Interessen, Ideologien, Archetypen, bestimmten Idealen u.a.m. verursacht werden. Wogegen Bloch einen „militanten Optimismus“ setzt, den er u.a. aus Analysen der Kategorien „Front, Novum, Ulti-mum“ und vor allem: aus dem als Vorschein konzipierten künstlerischen Schein schöpft: „Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglichkeiten.“ (s.u. zur Tele-ologie der Kunst), wobei die konkrete Utopie nie den festen Boden des Realen aus den Augen und unter den Füßen verliert. Analysen der ‚Kategorie Möglichkeit‘ und der 11 Marxschen Thesen ad Feuerbach runden diese Passagen des Zweiten Teils von Das Prinzip Hoffnung ab (S. 258-333).
Im 3. Teil gefolgt von „Wunschbildern“, z.B. in Reisen, in Theater, Oper, Film, Tanz und Pantomime. Und im 4. Teil schließlich in den „Grundrissen einer besseren Welt“, darunter den Sozialutopien von Freiheit und Ordnung (Morus, Campanella, s.o.), den technischen Utopien (natürlich noch nicht mit Digitalisierung, KI und Robotik!) sowie den architektoni-schen, geographischen, künstlerischen und sozialistischen Utopien.
Den abschließenden 5. Teil widmet Bloch der „Identität“ bzw. den „Wunschbildern des erfüllten Augenblicks“, angefangen in Haus und Schule und in Glücks-Vorstellungen, bis hin zu faustischen Grenzüberschreitungen und „Hoffnungsbildern gegen den Tod“; gefolgt von ausführlichen Darstellungen der (Welt-)Religionen: „Wo Religion ist, da ist auch Hoffnung.“ Aufgehoben in dem eingangs erwähnten Schlusskapitel über Karl Marx und die Mensch-lichkeit, wo Bloch betont, was Marx selbst als sein wahres, letztes Anliegen bezeichnet hat, nämlich »die Entwicklung des Reichtums der menschlichen Natur« (S. 1628).
Teleologie der Kunst
Was Bloch unter „Grenzüberschreitung“ versteht, lässt sich vielleicht am besten an Hand seiner Ästhetik, seiner Kunstphilosophie verdeutlichen. Diese ist wiederum klar teleologisch geprägt, so durch den Gedanken des Vorscheins einer besseren Welt, den die Kunst zu vermitteln vermag. Zugleich ergänzt Bloch damit seine Vorstellungen über sein kosmisches Konzept des Alles. Welche besondere Art von Teleologie Bloch ästhetisch entwickelt, erhellt zunächst dann, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Telos nicht nur Zweck und Ziel, sondern auch u.a. ‚Verwirklichung‘, ‚Erfüllung‘, ‚Vollendung‘ und ‚Ende‘ bedeuten kann. Es sind dies Bedeutungen, die zweifellos auch in anderen Grundelementen blochscher Philosophie eine Rolle spielen, so in den vielfältigen sozialen und technischen Utopien, die er heranzieht und ausführlich analysiert, so in Begriffen wie Naturallianz und Allianztechnik (s.u.). Auch darin geht es letztlich um Alles, nicht um Nichts.
Im Vergleich mit diesen Grundelementen nimmt die Kunst sogar eine Schlüsselposition ein. Demgemäß legt Bloch zunächst Wert darauf, Sinn und Zweck der Kunst vor Anfeindungen und Missverständnissen in Schutz zu nehmen. Im Prinzip Hoffnung (S. 242-245) legt er ausführlich dar, dass Kunst sich keineswegs in Schein oder gar Illusion und Phantasterei erschöpft. Vielmehr enthält die Kunst Weltstoff und Wirklichkeit in veränderter Form. Auch und gerade im realistischen Kunstwerk zeigt der/die Künstler/in Meisterschaft im freien Umgang mit den Stoffen, d.h. in einer einzigartigen Freiheit, in der sich so etwas wie die Utopie der Nicht-Entfremdung verwirklicht.
Und damit einen Ausblick auf Vollendung in nie geahntem Ausmaß gewährt. Denn es geht nicht nur um neue Wirklichkeit, Erweiterung der Natur, „humanisierte Natur“, sondern um höchstmögliche Vollendung: „Dergestalt lautet die Losung des ästhetisch versuchten Vor-Scheins: wie könnte die Welt vollendet werden, ohne daß diese Welt, wie im christlich-religiösen Vorschein, gesprengt wird und apokalyptisch verschwindet. “83 – Und dieser Vorschein beruht nicht auf purer Phantasterei, sondern nicht zuletzt auf der Realität des – allerdings neu geformten – Gewordenen. Dieses schützt Bloch vor jeglicher Entwertung, die z.B. die christliche Apokalypse beinhaltet. Blochs Weg zum Alles führt nicht durch das Nichts!
Dass Kunst aus zwei Hauptquellen, nämlich der Wirklichkeit und der Fiktion, schöpft, ist längst bekannt. Die Frage nach der Wahrheit der Kunst lässt sich jedoch erst dann beant-worten, wenn deren Entelechien, d.h. ihre wahren Ziel-Bestimmungen, erkennbar werden, nämlich über das Konzept des Vorscheins als mögliche Welt-Vollendung. Dabei gelingt Bloch sogar eine neue Definition der Kunst, wenn er erklärt: „Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglichkeiten, mitsamt den durcherfahrenen Alternativen darin, wobei die Ausführung wie das Resultat in der Weise des fundierten Scheins geschehen, nämlich des welthaft vollendeten Vor-Scheins.“84
Wenn hier – erneut – von weltimmanenter „Vollendung“ die Rede ist, stellt sich die Frage, ob Bloch damit nicht in einen Widerspruch zu sich selbst gerät, nämlich zu seinem Konzept einer „unvollendeten Entelechie der Materie“. Wie soll Vollendung möglich sein, wenn ihr Medium par excellence, die Materie, als „unvollendet“ gilt? Des Rätsels mögliche Lösung: Materie ist nicht nur „unvollendet“, sondern steht im Fluss des „In-Möglichkeit-Seins“. Da nun aber die Kunst sich dessen bedient – als „Fest ausgeführter Möglichkeiten“ – kann sie das scheinbar Unmögliche wagen: Vollendung und Vollkommenheit trotz aller – scheinbarer oder offen-sichtlicher – Unvollkommenheit! Und dies auch und gerade obwohl das Noch-Nicht a) des Reichs der Freiheit, b) des Alles im Ganzen fortbesteht. Nicht Alles, aber den Vorschein der Freiheit kann die Kunst verwirklichen, und zwar in „vollendeten“ Formen.
Wie dies konkret vonstatten geht, gibt Bloch an Hand zahlreicher Beispiele aus Musik, Literatur, Theater und bildender Kunst zu erkennen, wobei er der Musik eine Sonderolle insofern einräumt, weil sie als einzige so etwas wie utopische „Sprengkraft“ enthalte. Besondere Bedeutung misst Bloch außerdem Goethes ‚Faust‘ ein, den er zu Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘ in Beziehung setzt. (Auf diese und andere Beispiele, nachzulesen im Prinzip Hoffnung, vor allem S. 1143-1296, kann ich hier leider nicht näher eingehen.)
Die Kunst zielt aufs Ganze, auf Alles, und zwar erst recht dann, wenn die Welt als Gesamt-kunstwerk betrachtet werden kann. Als Kronzeugen für diese Auffassung nennt Bloch u.a. Giordano Bruno, dessen Konzepte „gebärender Schoß der Materie“, „universelle Vernunft in der Materie“ und „Weltbaumeister“ er ausführlich analysiert (Prinzip Hoffnung, S. 995: „ gemäß dem Wunschbild einer kosmisch vorhandenen Vollkommenheit“).
Ob es allerdings gelingen kann, die von der Kunst ausgehenden positiven Impulse in gesellschaftliche Realität zu verwandeln, hängt nicht von der Kunst, sondern einzig und allein von der Gesellschaft im Ganzen ab (ebd. S. 249). Kunst kann das konkrete politische Engagement nicht ersetzen.
Ausblick: Natur-Allianztechnik
Blochs A und O, die Materie, liegt jeglichem „Weltstoff“ und damit auch der Natur zu Grunde. Seine Sicht der Materie als In-Möglichkeit-Sein und unvollendete Entelechie verbindet Bloch mit der u.a. kosmologisch fundierten Teleologie der „Hauptmomente des Weltstoffs“. Somit vereint er Teleologie und historisch-dialektischen Materialismus, so dass von ihm auch eine neue Teleologie der Natur erwartet werden konnte.
Voraussetzung hierfür wäre allerdings die Beseitigung der Hindernisse, die Kant veranlasst haben, auf eine „konstitutive“, d.h. für die Naturwissenschaft unmittelbar anwendbare Funktion einer Natur-Teleologie zu verzichten. Ebenso wenig wie Kant ist Bloch in der Lage, Zwecke und Zweckmäßigkeit – oder gar Zwecksetzung – in der Natur unmittelbar nach-zuweisen. Auch Bloch muss sich hier mit einem „Als Ob“ begnügen, wenn auch einem völlig andersartigen, ganz anders begründeten.
Dass es Finalitäten, zielgerichtete Vorgänge in der (menschlichen und nicht-menschlichen) Natur gibt, bezweifelt Bloch nicht. Im Gegenteil, er weist ausdrücklich auf sie hin, so wenn er Trieb- und Willens–Phänomene (darunter auch den Machttrieb und den „Rauschtrieb“) im Rahmen seiner Untersuchung über das Antizipierende Bewusstsein (s.o.) teleologisch deutet. So auch, wenn er Giordano Bruno zitiert, der in der schöpferischen Natur (natura naturans) eine „universelle Vernunft“ am Werke sieht, die „das innerste, wirklichste und eigenste Vermögen und ein potentieller Teil der Weltseele“ sei.85 Dieser Logos sei, wie Bruno feststellt, von den Platonikern auch „Weltbaumeister“ genannt worden, und Bruno selbst bezeichnet diese Vernunft-Gestalt auch als „ den inneren Künstler, weil sie die Materie formt und von innen heraus gestaltet, wie sie aus dem Innern des Samens oder der Wurzel den Stamm hervorlockt und entwickelt, aus dem Innern des Stammes die Äste treibt, aus dem Innern der Äste die Zweige gestaltet, aus dem Innern dieser die Knospen bildet, von innen heraus wie aus einem inneren Leben die Blätter, Blüten, Früchte formt, gestaltet und verflicht, und von innen wieder zu bestimmten Zeiten die Säfte aus Laub und Früchten in die Zweige, aus den Zweigen in die Äste, aus den Ästen in den Stamm, aus dem Stamm in die Wurzel zurückleitet.“86 –
Anschaulicher lassen sich natürliche Telos-Vorgänge kaum darstellen. Bloch kommentiert die Stelle nicht; warum er sie so ausführlich zitiert, liegt dennoch auf der Hand: Sie ist Illustration dessen, was Finalität in der Natur bedeuten kann. Allerdings übernimmt Bloch weder Brunos Konzept einer „universellen Vernunft“ noch das eines „Weltbaumeisters“ in der Natur. Denn wer sollte dieser „Meister“ sein, wenn nicht Gott? Eine pantheistische Lösung, die Bloch nicht weniger strikt ablehnt als Marx und Engels.
Umso mehr überraschen zunächst Blochs Anleihen bei einem anderen pantheistischen Kron-zeugen der natura naturans, nämlich Schelling, der von Bruno, aber auch von Spinoza („Gott oder die Natur“) beeinflusst war. Wenn die Natur ihre „eigene Gesetzgeberin“ ist, so Schelling, kann und muss man ihr – ähnlich wie dem „Weltbaumeister“ (= Gott) sogar Handlungsfähigkeit zusprechen. Dies zu übersehen, wirft Schelling den Naturwissen-schaftlern seiner Zeit vor, indem er behauptet: „Philosophieren über die Natur heißt, sie aus dem toten Mechanismus, worin sie befangen scheint, herauszuheben, sie mit Freiheit gleichsam beleben und in eine eigene Entwicklung versetzen – heißt, mit anderen Worten, sich selbst von der gemeinen Ansicht losreißen, welche in der Natur nur, was geschieht, – höchstens das Handeln als Faktum, nicht das Handeln selbst im Handeln – erblickt.“87 Aber wer handelt denn da „im Handeln“, wenn nicht, wie bereits erwähnt, Gott selbst? Eine theologische Setzung, ohne die von „Zwecksetzung in der Natur“ wohl kaum die Rede sein könnte.
Ohne diesen theologischen Hintergrund (und Untergrund) ist bekanntlich auch Schellings Definition des „Geistes in der Natur“ als „objektives Subjekt-Objekt“ ebenso wenig verstehbar wie seine Subjektivierung der ‚natura naturans‘: „Die Natur als bloßes Produkt (natura naturata) nennen wir die Natur als Objekt (auf diese allein geht alle Empirie). Die Natur als Produktivität (natura naturans) nennen wir Natur als Subjekt, und auf diese allein geht Theorie.“88 Klar ist demnach, dass Schelling die „Natur als Subjekt“ für ein theoretisches Konzept hält! Erstaunlich ist außerdem, dass der Gegensatz von Empirie (konkreter Forschung) und Philosophie (bzw. Theorie) bis in unsere Zeit hinein weiterhin besteht, mit bösen Folgen, vor allem hinsichtlich der fortdauernden Umweltzerstörung.
Dennoch – oder gerade aus diesen Gründen – hat Bloch sich von den genannten Schelling-schen Konzepten inspirieren lassen, so von dem „Subjekt Natur“, das er allerdings zum „hypothetischen Natursubjekt“ umwandelt und nicht idealistisch, sondern materialistisch interpretiert. So dass die Vermutung „hypothetisches Natursubjekt“ nicht bedeutet, es handele sich um etwas völlig Irreales.
Vielmehr geht es um angeblich tatsächlich Mögliches, dessen Verwirklichung jedoch noch aussteht, zumal nicht klar ist, wie ein „Handeln der Natur“ (als deren Zwecksetzungen!) mit dem Handeln des Menschen in Einklang zu bringen wäre. Durchaus realistisch erkennt Bloch daher: „Gewiß, ein Subjekt der Natur bleibt so lange problemhaft, als keine konkrete Vermittlung durch den Menschen, als den jüngsten Sohn der Natur, damit gelungen ist. Doch die Möglichkeit dazu bleibt offen und ist im Gegenstand vorgezeichnet, nicht bloß in unserer Auffaßbarkeit, die ohne hereinwirkendes Naturmaterial nicht einmal als problemhafte möglich wäre. Ohne alles Spekulative also zusammenfassend: Es gibt die Anlage, die reale Möglichkeit zu einem Subjekt der Natur “.89
Damit geht Bloch weit über das kantische „Als Ob“ hinaus, in dem die reale Möglichkeit einer zwecksetzenden Instanz in der Natur überhaupt nicht vorkommt. Das „hereinwirkende Naturmaterial“ enthält, in Latenz und Tendenz, genügend Anhaltspunkte für die Existenz von Finalität in der Natur, wie u.a. das obige Bruno-Zitat wunderbar veranschaulicht.
Bloch sah außerdem in der Vorstellung eines Natursubjekts die Möglichkeit, ein ganz anderes Ziel zu etablieren: die „Mitproduktivität eines möglichen Natursubjekts oder konkrete Allianztechnik“.90 Was Bloch damit meint, verdeutlicht er kurz und bündig im Experimentum Mundi: „Ein nicht ausbeutendes Verhalten zur Natur wurde schon der objektiv-realen Möglichkeit nach bedeutet als befreundete, konkrete Allianztechnik, die sich in Einklang zu bringen versucht mit dem hypothetischen Natursubjekt.“ (S. 251, Hervorhebung durch mich.) Und er nennt für seine Forderung sogleich einen triftigen, gleichsam brandaktuellen Grund: „Das wird umso notwendiger, als sich der Unfall ja längst ausgewachsen hat zu drohender Selbstausrottung des Menschen, gründlicher Zerstörung seiner natürlichen Existenz-bedingungen durch Mißachtung der Ökologie.“ (ebd.) Das klingt wie das Programm für eine Bewegung, die erst nach Blochs Tod, nämlich in den 1980er Jahren voll eingesetzt hat: die Grüne Bewegung auf nahezu allen Ebenen, bis hin zu den spektakulären Aktionen von Greenpeace u.a. – Wobei allerdings zu beachten ist, dass Bloch – im Unterschied zu fast allen Politikerinnen und Politikern der „Grünen“ – eine sozial-revolutionär gestützte Neuorien-tierung der Ökologie fordert, indem er feststellt: „Naturströmung als Freund, Technik als Entbindung und Vermittlung der im Schoß der Natur schlummernden Schöpfungen, das gehört zum Konkretesten an konkreter Utopie. Doch auch nur der Anfang zu dieser Konkretion setzt zwischenmenschliches Konkretwerden, das ist, soziale Revolution voraus; eher gibt es nicht einmal eine Treppe, geschweige eine Tür zur möglichen Naturallianz.“91 (Hervorhebung durch mich)
Naturallianz und soziale Revolution sind Aufgaben, vor die Bloch die gesamte Menschheit gestellt sieht. Schon jede dieser beiden Aufgaben für sich scheint, wie die Geschichte gezeigt hat, kaum lösbar zu sein. Die schleichende Umweltkatastrophe geht weiter, die soziale Revolution (hin zum „Reich der Freiheit“) ist ausgeblieben oder gescheitert. Ob Ersteres nur eine Folge des Letzteren ist, scheint fraglich.
Nachweisbare Natur- Subjektivität bedeutet jedenfalls Autonomie und Selbstorganisation der Natur, zumal sie, wie Schelling bemerkte, ihre „eigne Gesetzgeberin“ zu sein scheint. Diese Autonomie zu respektieren und aktiv zu schützen, bleibt ebenso Menschheitsaufgabe wie der Kampf gegen Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit.
Aus der Möglichkeit einer Natursubjektivität ergeben sich außerdem Konsequenzen und neue Ziele für Theorie und Praxis der Wissenschaften. Bloch hat – ähnlich wie Kant – dem teleologischen Denken eine klare Vorrangstellung gegenüber dem bloß kausalmechanischen eingeräumt. Die seit Dilthey übliche Aufteilung in „erklärende“ Naturwissenschaften und „verstehende“ Geisteswissenschaften hielt er für unerträglich.92 Aus all diesem folgt: Dort, wo weiterhin ein Denken in den Kategorien der Quantität und der Kausalität vorherrscht, sollten unbedingt neue Komponenten teleologischer und qualitativer Art eingeführt werden. (Näheres hierzu in der Abhandlung von Hansotto Reiber über Die Komplexität biologischer Gestalt als zeitunabhängiges Konstrukt im Zustandsraum. Zum naturwissenschaftlichen Umgang mit Qualitäten, in: VorSchein Nr. 29, Nürnberg 2007, S. 39-63.)
Ausarbeitungen zu den Themen Natursubjekt und Natur-Allianztechnik sind – außer in den entsprechenden Artikeln des Bloch-Wörterbuchs – u.a. in folgenden Veröffentlichungen zu finden:
Annette Schlemm: Die Natur ist kein Vorbei Ernst Blochs Konzept des Mensch-Natur-Verhältnisses, Philosophenstübchen-Blog Februar 27, 2010: http://philosophenstuebchen. wordpress.com/2010/02/27/die-natur-ist-kein-vorbei-ernst-blochs-k...
Francesca Vidal (Hg.): Naturallianz – von der Physik zur Politik, Bloch-Jahrbuch 2004, Mössingen-Talheim 2004.
Doris Zeilinger: Wechselseitiges Ergreifen. Ästhetische und ethische Aspekte der Natur-philosophie Ernst Blochs, Würzburg 2006.
Rainer E. Zimmermann (Hg.): Naturallianz, Hamburg 2006.93
Naturallianz und Allianztechnik. VorSchein 39, Jahrbuch 2022 der Ernst-Bloch-Assoziation, Nürnberg 2023
Zu Blochs Menschenbild:
Peter Thompson: Mensch, in: Bloch-Wörterbuch, Berlin/Boston 2012, S. 275-283
»Der Mensch ist nicht dicht«. Die anthropologische Dimension der Technik 4.0, VorSchein 37, Jahrbuch 2019 der Ernst-Bloch-Assoziation, Nürnberg 2021
---
Im Prinzip Hoffnung lauten die Schlusssätze:
„Mit diesem Blick also gilt: Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ (S. 1628)
Das „Haus des Seins“ ist also nicht einfach nur die Sprache, sondern das unfertige Haus der ‚humanitas‘, das noch nicht vollendet, noch erst zu vervollständigen und vollständig zu errin-gen ist: das unentfremdete, gänzlich demokratische Reich der Freiheit, die freie Assoziation freier Individuen, die allesamt ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen gemäß leben und ar-beiten können.
Kritische Anmerkung
Blochs Humanismus könnte in zwei Punkten in Frage gestellt werden, und zwar 1. in Bezug auf den Leninismus, 2. bezüglich von ‚Atheismus im Christentum‘ (1968). Blochs Leninismus ist eine lange, ziemlich komplizierte Story. Kurz nach der Oktober -Revolution, und dann bis ca. 1920, übte Bloch, ähnlich wie Rosa Luxemburg und andere Linke, scharfe Kritik an Lenins brutalen Methoden; änderte dies aber radikal, je mehr bürgerliche und vor allem faschistische Reaktionäre den Bolschewismus bzw. die Sowjetunion massiv bedrohten. Diese neue, bedingungslose Solidarität ging so weit, dass Bloch – wohl nicht zuletzt aus purer Wut über Hitler bzw. aus purer Angst vor ihm – sogar Stalin unterstützte, und zwar auch hinsichtlich der „Säuberungen“ 1936/37 und des Vorgehens gegen Leute wie Trotzki. – Vom Stalinismus distanzierte sich Bloch allerdings nach dem Ungarn-Aufstand 1958 und erst recht nach seiner Übersiedlung in die BRD 1961. Nicht jedoch von Lenin und dessen forciertem Atheismus. „Ubi Lenin ibi Jerusalem“ lautete Blochs Wahlspruch – anscheinend bis zuletzt, d.h. bis zu seinem Tod im Jahre 1977.
2. Zu Atheismus im Christentum (1968), wo Bloch allen Ernstes behauptet, nur Atheisten könnten gute Christen sein. Was wohl schon deshalb nicht angeht, weil Jesus zweifellos kein Atheist war, sondern sich selbst als Vermittler zwischen sich und seinem „Vater im Himmel“ verstand. („Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“) Daher ist es abwegig, von Christen, die ja an den Dreieinigen Gott glauben, zu verlangen, sie sollten Atheisten werden. Einen Grund für Blochs abenteuerliches Ansinnen sehe ich mittlerweile vor allem in politisch-taktischen Erwägungen. Wie sollte man den schon durch Marx und Lenin atheistisch geprägten Kommunismus in einer Gesellschaft propagieren können, die noch weitgehend christlich geprägt war? Dafür boten sich anscheinend u.a. die „weltlichen“, d.h. auf soziale Gerechtigkeit und Gleichheit abzielenden Inhalte der Bibel an. Vielleicht wäre theoretisch ein „christlicher“ Atheismus sogar mit einem kommunistischen vereinbar, aber (s.o.).
Meine Kritik an Marx, Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao und dem sowjetischen Bürokratismus / Totalitarismus habe ich übrigens veröffentlicht, und zwar in ‚Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus?‘ (München, GRIN-Verlag, https://www.grin.com/document/1032082). Vgl. Robra 2024, S. 75.
F) Andere Konzepte
Personalismus
Der Personalist Emmanuel Mounier (1905-1950 ) lehnt – im Unterschied zu den Pragmatisten – den Marxismus nicht rundweg ab, sondern versucht, ihn kritisch aufzuarbeiten und zu beerben. Wie Marx behauptet Mounier, alles Menschliche sei durch die Materie bestimmt. Der Marxismus habe die „soziale Scheinheiligkeit“ des bürgerlichen Idealismus entlarvt. Nicht nur in Marxens Entfremdungstheorie zeige sich die emanzipatorische, auf Freiheit und Selbstbestimmung („freie Assoziation freier Individuen“) abzielende Grundintention des Marxismus und zugleich dessen Kompatibilität mit den urchristlichen Werten. Mounier hält sogar „Kampfgemeinschaften“ zwischen Christen und Marxisten für möglich.94
Dennoch hebt Mounier einige grundsätzliche Unterschiede hervor. Im Marxismus werde die „réalité intime“, der Kern des Person-Seins, zu wenig beachtet. Zudem sei die Eigen-verantwortung des Menschen unaufhebbar, bloße Naturbeherrschung dagegen nicht die „eigentliche“ Berufung des Menschen.
Nichtsdestoweniger macht Mounier aus seiner zutiefst anti-kapitalistischen Einstellung keinen Hehl. „Das dem System zu Grunde liegende Vertrauen auf das sogenannte >freie Spiel der Kräfte< sieht er als durch die Realität widerlegt an. Ein unumschränkt waltender, letztlich nicht disziplinierbarer Liberalismus führe überall nur zum Sozial-Darwinismus. Durch die Vergötzung von Produktion, Geld und Profit unterminiere der Kapitalismus allmählich sämtliche menschlichen Werte, bis hin zum Privatleben und zur Religion. ... In der durch dieses System kontrollierten Klassengesellschaft würden Ausbeutung und Unterdrückung und damit die sozialen Ungleichheiten, Gegensätze, Widersprüche und Konflikte immer mehr verschärft.“95 – Mouniers Gegenmodell: Im Mittelpunkt steht der Mensch als Person, nicht das Kapital. Statt der Herrschaft des Finanzkapitals (incl. Börsenspekulation): Arbeiter-kontrolle, „industrielle Demokratie“, Partizipation, „Verantwortlichkeit“ jeder Einzelperson.96
Das Person-Sein identifiziert Mounier als „le volume total de l’homme“, allerdings eher provisorisch, versuchsweise, zumal nicht klar ist, wie weit der „totale Umfang des Menschen“ Person-Begriffs hinzuzufügen.97
Kritik am Personalismus
Für Personalisten ist die Person ein „von Gott gewolltes Wesen“. Diese Annahme ist jedoch nicht überprüfbar, weil die Existenz Gottes bekanntlich nicht nachweisbar ist. Auch die Behauptung des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. (J. Ratzinger), Gott sei eine Person, kann nur geglaubt, nicht aber gewusst werden. Als „Geschöpf Gottes“ müsste die Person in höchstem Maße zumindest die in der jüdisch-christlichen Tradition Gott zugeschriebenen Attribute Allgüte und Allweisheit überall auf der Welt verwirklichen, was aber nicht der Fall ist. Überhaupt geht es nicht an, Personalität rein theologisch fundieren zu wollen, denn Person-Sein bedeutet nicht in erster Linie Abhängigkeit von Gott, sondern Mensch-Sein. Personen können menschlich, aber auch unmenschlich sein. Jeder Versuch, irgendeine Theorie der Person rein theologisch zu begründen, dürfte von vornherein zum Scheitern verurteilt sein.
Schon aus diesem Grunde kann es die von Mounier angestrebte Synthese aus Christentum und Kommunismus nicht ohne Weiteres geben, zumal das Christentum zwar eine der Grundlagen des Personalismus ist, nicht jedoch integraler Bestandteil des Kommunismus seit Marx und Engels, die den Atheismus predigten.
Statt der von Mounier erhofften Synthese entwickelte sich in der Zeit nach seinem Tod im Jahre 1950 insbesondere in den USA, aber auch in den kapitalistischen Staaten Europas und anderer Erdteile ein Anti-Kommunismus, der nicht zuletzt im Namen des Christentums von sogenannten Christen propagiert und praktiziert wurde. Adenauer und McCarthy führten regelrechte Kreuzzüge gegen Kommunisten und Sozialisten.
Wenn die Person „Teil der Natur“ ist, muss sie sich demgemäß verhalten., was aber häufig nicht der Fall ist, wie sich an der Zerstörung von Natur und Umwelt durch bestimmte Personen immer wieder gezeigt hat. Ökologie lässt sich personalistisch nicht zufriedenstellend begründen, weil der Mensch – auch und gerade als Person – Gefahr läuft, sich in selbst-herrlicher, überheblicher Art und Weise als „Kulturwesen“ und nicht auch als Naturwesen zu verstehen und in solcher Hybris die Natur zu verachten, und zwar nicht zuletzt auf Grund der angeblichen „Geistbestimmtheit“ der Person. In der Subjekt-Objekt-Beziehung versagt die Person, wenn sie sich selbst und die Natur verachtet und die natürlichen Grundlagen und Ressourcen der Objekt-Welt zerstört. Ohnehin kann niemand ausschließlich „geistbestimmt“ sein, weil der Geist zwar Teil der menschlichen Natur ist, aber nicht ausschließliches Element,Geist hervorgebracht, nicht umgekehrt.
Da die Natur die Person hervorgebracht hat, kann „göttlicher Geist“ nur dann als Schöpfer der Person in Frage kommen, wenn Gott, wie Theologen uns weismachen wollen, als Person98 zu betrachten wäre, was nicht beweisbar ist.
Aus dem gleichen Grunde kann es auch keine personalistisch begründete Kosmologie geben. Nicht der Mensch als Person, sondern die Natur steht im Mittelpunkt des Universums, ohne deshalb die Person wie Nietzsche im „X“ zu verorten. Andererseits: Auch wenn der Mensch seit Beginn der Neuzeit tatsächlich „vom Mittelpunkt ins X“ gerückt wäre, kann dies nicht bedeuten, dass der Mensch als Person nicht einmal in der Lage wäre, eine dem heutigen Kenntnisstand entsprechende Kosmologie zu erarbeiten, weil es eine „personalistisch begrün-dete Kosmologie“ nicht geben könne. Es mag zwar sein, dass „volle Personalität ... ein kosmisches Bewusstsein“99 beinhaltet, doch dadurch rückt die Person keineswegs in den Mittelpunkt des Kosmos.
Philosophisch bei der Person anzusetzen, scheint mir inzwischen problematisch, aber nicht aus theologischen Gründen. Als Teil der Natur besteht der Mensch – auch als Person – körperlich aus organischer und anorganischer Materie. Personalität beruht auf dem Zusam-menwirken von Materie, Psyche und Geist im Menschen. Eine Philosophie der Person müsste daher den Dialektischen Materialismus einbeziehen, zumal dieser auch der „Geist-bestimmtheit“ der Person gerecht zu werden vermag. Eine solche Synthese gibt es aber bisher anscheinend nicht.
Sartres Humanismus: existenzialistisch? marxistisch? anarchistisch?
In seinem 1946 erschienenen Essay L’existentialisme est un humanisme geht Jean-Paul Sartre (1905-1980) davon aus, dass im Menschen die Existenz der Essenz vorangeht. Demnach wird der Mensch in sinnlicher Wahrnehmung seiner selbst gewahr, noch ehe er über sich selbst nachdenkt. Er sei, wie Sartre es ausdrückt, „ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgend-einen Begriff definiert werden kann, und dieses Wesen ist der Mensch oder, wie Heidegger sagt, das Dasein“.100
Wie Heidegger geht Sartre also vom „Dasein“ (oder „In-der-Welt-sein“) als der eigentlichen, ursprünglichen Seinsweise des Menschen als Subjekt aus. Dazu heißt es in dem Wikipedia-Artikel (s. Fußnote Nr. 100): »Das bedeutet, dass der Mensch zuerst in die Welt eintritt, sich aber erst danach definiert. Der Mensch ist laut Sartre nicht definierbar, weil er zunächst nichts ist. „Er wird erst dann, und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird.“« Demnach ist nicht Gott der Schöpfer des Menschen, sondern der Mensch erschafft sich selbst; aber nicht, wie der Handwerker irgendeinen Gegenstand herstellt, indem er einen bestimmten Begriff von der Sache, ihre Essenz, in eine bestimmte Existenz umsetzt. Vielmehr sei der Mensch, bei dem die Existenz der Essenz vorangeht, „nichts anderes als das, wozu er sich macht“ (ebd.) Mit schwerwiegenden Folgen, denn, wie es in dem Artikel heißt:
„Wenn wir uns selbst erschaffen, müssten wir auch bestimmen, wie wir uns selbst erschaffen wollen – wir müssten selbst entscheiden, wie wir leben wollen. Der Mensch sei für das, was er ist, verantwortlich. So bestehe die erste Absicht des Existen-tialismus darin, jeden Menschen in den Besitz seiner selbst zu bringen und ihm die totale Verantwortung für seine Existenz zu übertragen. Diese Verantwortung trüge er jedoch nicht nur für seine Individualität, sondern für alle Menschen.“
Wobei allerdings, ähnlich wie bei Heidegger, die Angst eine Rolle spiele: Die Menschen ängstigten sich, weil sie wüssten, dass ihre je eigene Wahl zugleich die gesamte Menschheit betreffe. Trotzdem sei der Mensch verlassen und frei zugleich; verlassen, weil Gott nicht existiere, frei, weil es weder Gott noch irgendeine andere determinierende Instanz gebe. Die Kehrseite: Der Mensch sei zur Freiheit verurteilt („condamné à être libre“). Woraus aber keine allgemein gültige Moral folge, so dass auch Kants Kategorischer Imperativ keinen Be-stand haben könne.
Dabei bezieht Sartre sich ausdrücklich auf das cartesische ‚Cogito ergo sum‘ als verlässlichen Grundsatz, beschränkt diesen aber nicht auf die je eigene Person, sondern überträgt ihn auf alle Mitmenschen; oder, wie er, Sartre, es ausdrückt:
„So entdeckt der Mensch, der sich selbst durch das cogito unmittelbar erreicht, auch alle anderen, und er entdeckt sie als die Bedingung seiner Existenz. Er wird sich dessen bewusst, dass er nichts sein kann (in dem Sinn, wie man sagt, man sei geistreich oder man sei böse oder man sei eifersüchtig), wenn nicht die anderen ihn als solchen anerkennen. [...] Der andere ist für meine Existenz unentbehrlich, wie übrigens auch für die Kenntnis, die ich von mir selbst habe.“ (a.a.O. S. 4)
Somit umschifft Sartre die Gefahr des Solipsismus, der reinen Selbst-Bezüglichkeit, und schafft die Basis für seine Auffassung, wonach der Existenzialismus ein Humanismus sei.
Eine bedeutsame Änderung dieses Konzepts, das im Wesentlichen auch schon in Sartres erstem Hauptwerk Das Sein und das Nichts von 1943 vorliegt, vollzieht der Autor erst im Jahr 1960 in der Critique de la raison dialectique (CRD, der ‚Kritik der dialektischen Vernunft‘), in der er zum Marxismus übergeht, ohne den Existenzialismus – und insbesondere dessen Freiheitsbegriff – gänzlich aufzugeben. Den Marxismus bezeichnet er nunmehr als „die Philosophie unserer Zeit“ (CRD S. 29). Diese Philosophie sei „indépassable“, unüber-schreitbar (unaufhebbar?), weil die Umstände, die sie hervorgebracht haben, keineswegs aufgehoben („dépassées“) seien. Auf die Gefahr hin, sich im Leeren zu verlieren oder rückständig zu werden, könne unser Denken nur auf dem Boden des Marxismus wirklich gedeihen (ebd.).
Vom Sinn der Dialektik zur Dialektik des Sinns
Dass Sartre seine zuvor entwickelte kritische Haltung keineswegs aufgibt, zeigt sich u.a. daran, dass er seine Kritik an Engels‘ „dialektischem Materialismus“ in CRD erneut bekräftigt (insbesondere S. 125-128). Darüber hinaus will Sartre den Marxismus nicht nur neu fun-dieren, sondern auch dessen Mängel korrigieren. Grundübel sieht er nach wie vor darin, den Menschen materialistisch zu verdinglichen und ebenso dadurch zu entmündigen, dass man ihn einem angeblich historischen, in Wirklichkeit ökonomistischen „Sinngesetz“ unterwirft.
Dialektik will er stattdessen mit Freiheit, d.h. mit einer als Praxis verstandenen Subjektivität (Für-sich-Sein), verbinden. Dialektik kann insofern nicht als Selbstzweck, nicht aus eigener „Logik“, sondern nur als Instrument begrifflichen Denkens zur Geltung kommen. Für-sich-sein bestimmt sich einerseits in dialektischer Negation, andererseits im dialektischen Bezug zu Anderem. Dieser Bezug vollzieht sich u.a. in der Totalisierung als Herstellung von konkre-ten Einheiten und Ganzheiten. Erst unter solchen Voraussetzungen lässt sich die Dialektik umfassend, d.h. auch auf die Gebiete der Arbeit, des Sozialen und der Geschichte als solcher anwenden. Wobei stets ein Vorrang des Verstehens zu beachten ist.
Was Sartre sich hier als Aufgabe vornimmt, ist nicht weniger als eine Kritik (auch im Kanti-schen Sinne) an dogmatischem dialektischem und historischem Materialismus („Diamat“ und „Histomat“). ,
Schon in Das Sein und das Nichts war Sartre auf die Sinnfrage eingegangen , wenn auch eher beiläufig. Diese Frage beantwortete er nicht marxistisch mit dem „Sinngesetz“, aber auch nicht wie Heidegger in der Verkürzung auf „Zeitlichkeit“ und „Sorge“. Vielmehr erklärte er, der eigentliche Sinn des Für-sich liege draußen im Sein, aber erst durch das Für-sich komme der Sinn des Seins zum Vorschein (a.a.O. S. 230). Auch dem Gegenstand seiner Arbeit vermag der Mensch daher Sinn zu verleihen, stößt dabei jedoch zuweilen auf (vorher-gegangene) „fremde Sinnverleihungen“. Wenn aber – wie in CRD – dem Für-sich die Dialektik zuzuordnen ist, kommt erneut die Freiheit als höchster Wert ins Spiel. Somit erschließt sich ein Sinn des Seins aus dem Wert des freien Für-sich-Seins, aus dem Menschen selbst. Diese Botschaft Sartres sollte nicht ungehört verhallen, nicht unbeachtet bleiben.
Gemäß dem Untertitel von CRD: Théorie des ensembles pratiques versteht Sartre den Menschen als Praxis und Freiheit im Für-sich-Sein, so dass auch zur Sozialen Freiheit ein Weg zu finden sein müsste. Sowohl seinsbezogen (ontologisch) als auch anthropologisch entspricht diese Zielsetzung durchaus derjenigen der Marxschen Theorie, einschließlich der Entfremdungstheorie. Der Gefahr des Ökonomismus entgeht Sartre allerdings dadurch, dass er dem Menschen statt Fremdsteuerung Freiheit und somit Eigensteuerung zubilligt.101
Unverkennbar ist jedenfalls auch hier die humanistische Orientierung, der Cantus firmus eines Humanismus, in dem Subjektivität, Freiheit und Solidarität übereinkommen sollen.
Erneute Kehrtwende in den 1970er Jahren?
Vor allem unter dem Eindruck der Mai-Revolte von 1968, an der er sich aktiv beteiligte, hat Sartre sich anscheinend weltanschaulich erneut umorientiert. Dazu schreibt Alfred Betschart in einem Artikel des Jahres 2016:
„Seit 1972 bezeichnete sich Sartre als dem antihierarchisch-libertären Lager zugehörig. Dies war Neutralen nicht entgangen, und sie wussten auch, dass libertaire im Französischen ein Codewort für anarchistisch war. Entsprechend sprachen die Interviewer des Spiegels Sartre anfangs 1973 darauf an (VNBG 92):
SPIEGEL: Sie sind also nicht Anarchist?
SARTRE: Nein [...] Ich stehe einer Konzeption nahe, die man in Frankreich als „libertaire“ bezeichnet. Darunter verstehe ich, daß die Menschen Herren über ihr Leben und ihre Lebensbedingungen sind. Wenn ich über mein Leben entscheide, dann haben wir die Freiheit. Das setzt voraus, dass es keine Form von Zwang gibt. Mit andern Worten, das setzt eine vollständige Umwälzung der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaftsordnung voraus. [...] Ich bin Marxianer [marxien] und nicht Marxist. [...] Wenn der Marxismus dialektisch ist, bin
ich völlig einverstanden. Aber es gibt einen marxistischen Determinismus über die Wertung der individuellen oder kollektiven Aktion, den ich nicht akzeptiere, weil ich der Idee der Freiheit treu geblieben bin. Ich glaube, daß die Menschen frei sind. “102
Hier bestreitet Sartre also (noch), Anarchist zu sein. Außerdem bekennt er sich zu einem kriti-schen Marxismus und weiterhin zur Idee der Freiheit, die er schon in seinem Frühwerk von 1943 entwickelt hatte.
Dagegen zeigt sich zwei Jahre später, in einem Interview mit der Zeitschrift ‚Nouvel Observa-teur‘, anscheinend eine „grundlegende Änderung in der politischen Wahrnehmung Sartres“, und zwar auch in Bezug auf den Begriff ‚Anarchist‘. Sartre wurde gefragt:
„Nach dem Mai 68 sagten Sie: „Wenn man meine Bücher liest, alle, wird man merken, daß ich mich im Grunde nicht geändert habe und immer ein Anarchistgeblieben bin ...“
Sartre: Das ist richtig. [...] Aber ich habe mich insofern geändert, als ich damals, als ich den Ekel schrieb, Anarchist war, ohne es zu wissen [...] Später entdeckte ich durch die Philo-sophie den Anarchisten in mir. Aber ich entdeckte ihn nicht unter dieser Bezeichnung, denn der Anarchismus von heute hat nichts mehrmit dem Anarchismus von 1890 zu tun.
CONTAT: Sie haben sich aber nie mit der anarchistischen Bewegung identifiziert.
Sartre: Niemals. Im Gegenteil, ich habe sehr ferngestanden. Aber ich habe nie eine Macht über mir geduldet und war immer der Meinung, daß die Anarchie, das heißt, eine Gesellschaft ohne Macht, verwirklicht werden muß.
CONTAT: Sie sind, mit einem Wort, der Denker eines neuen Anarchismus, eines libertären Sozialismus.“ (a.a.O. S. 7)
Auffällig ist hier die Verbindung von Anarchismus und Sozialismus unter dem gemeinsamen Nenner ‚libertaire‘, somit auch im Einklang mit Sartres Freiheitsbegriff. Wozu A. Betschart bemerkt, der Anarchismus habe nunmehr in Sartres politischem Denken zweifellos eine er-neute Aufwertung, wenn nicht eine ganz neue Bedeutung gewonnen.
Im Jahr 1978 erklärt Sartre in einem Interview mit dem im stark anarchistisch geprägten Barcelona aufgewachsenen Juan Goytisolo:
„Ich denke, dass der Anarchismus eine der Kräfte ist, die den Sozialismus von mor-gen bauen kann. Persönlich habe ich mich immer als Anarchisten verstanden; nicht ge- nau so wie es die Anarchisten machen, die über ein Programm, eine Art zu denken verfügen und ihre Ideen innerhalb einer Organisation erarbeiten. Der Grund, durch den
ich den Anarchismus erfasse, ist, dass ich schon immer Macht und insbesondere das
Verfügen der staatlichen Macht über mich selbst ablehnte. Ich will nicht, dass es eine höhere Autorität gibt, die mich zwingt etwas zu denken oder gewisse Dinge zu tun. Ich denke, dass ich es bin, der bestimmen soll, was ich machen soll, womit ich es machen soll und wann ich es machen soll. Deshalb betrachte ich mich zutiefst als Anarchisten. Wenn ich versuche, meine politischen Ideen über Macht und Freiheit zusam-menzufassen, gehen sie in diese Richtung. Ich habe immer mit den anarchistischen Denkern sympathisiert, auch wenn ich denke, dass sie die Probleme nicht immer so angingen, wie sie genau anfielen.“ (a.a.O. S.8 f.)
Freimütig bekennt Sartre sich hier also zu einem libertären Anarchismus, nicht ohne diesem Bekenntnis eine nachdrückliche Staats-Kritik hinzuzufügen. Es geht Sartre sowohl um per-sönliche als auch um allgemein-politische Freiheit.
Diese Darstellung Bretscharts ist jedoch nicht unwidersprochen geblieben. Erhebliche Zweifel äußert z.B. Anton Stengl, indem er behauptet, A. Bretschart habe an Hand weniger Interviews „auf Biegen und Brechen“ versucht, den Sartre der 1970er Jahre als überzeugten Anarchisten hinzustellen. Dies sei ebenso abwegig wie Bretscharts Annahme einer „Spätphilosophie“ Sar-tres. Dem liege auch „ein völlig falsches Bild des Marxismus“ zu Grunde, nämlich eine „Identifikation des Marxismus mit der Politik unter Chruschtschow und Breschnew“. Dage-gen liege Sartres Hauptverdienst darin, „dem Marxismus eine ontologische, anthropologische und ethische Grundlage gegeben zu haben.“103
Diese Kontroverse zwischen Bretschart und Stengl wirft natürlich die Frage auf, welche der beiden Darstellungen dem gerecht wird, was Sartre gegen Ende seines Lebens tatsächlich dachte und wegen einer fast vollständigen Erblindung seit 1973 nur noch in Interviews publik machen konnte. In einem solchen Interview (vom 1.11.1979), das weder Bretschart noch Stengl erwähnen, erklärte Sartre:
„Der Sinn einer anarchistischen Gesellschaft liegt darin, daß in ihr kein Mensch irgendeine Macht über einen anderen Menschen besitzt, jedoch sehr wohl Macht auf die Objekt-Welt, die Dinge ausübt. In den zur Zeit bestehenden Gesellschaften wird der Mensch als Objekt, als Mittel, der Reichtum dagegen als Zweck behandelt. Im Moment handelt es sich nur darum, Gruppen zu gründen, die versuchen, außerhalb dieser Machtstrukturen zu leben und zu denken, die sich bemühen, die Idee der Macht beim Nächsten zu zerstören, die zwar Macht über die Dinge besitzen, jedoch niemals über Menschen. Doch werden weder wir selbst, noch unsere Kinder das Verschwinden des Staates miterleben, vielleicht gelingt es unseren Urenkeln.
Es geht also darum zu wissen, wie ein Anarchist jetzt leben muß. In diesem Sinne ist die Anarchie für mich ein moralisches Leben. (Bei dieser Gelegenheit möchte ich hinzufügen, daß ich nur Bücher geschrieben habe, in denen es um die Frage der Moral geht.)
Der Anarchist stellt sich also die Frage: Wie kann man in einer Gesellschaft, in der es Macht gibt, leben? Man muß versuchen, sich soweit als irgend möglich jeder sozialen Macht zu entziehen, und man muß jegliche Form von Machtausübung, die wir in unserem eigenen Handeln aufdecken können, in Frage stellen. Das ist nicht leicht, und es ist notwendig, soviel wie möglich mit den anderen zusammenzuarbeiten.
3.- Man müßte Gemeinschaften aufbauen, in denen man so frei wie möglich leben kann, - wie Anarchisten eben zu leben wünschten - Gemeinschaften von 25 bzw. 50, oder 10 bzw. 30 Personen, die untereinander authentische, völlig autoritätsfreie [S. 367] Beziehungen verwirklichen; Gemeinschaften, die auf Liebe basieren, jedoch nicht notwendigerweise auf der sexuellen, sondern vielmehr auf der Kindesliebe, der Mutterliebe, der Liebe zwischen zwei Gefährten. In der Hoffnung auf diese Liebe müssen sich die Beziehungen der Personen untereinander gründen. Diese Gemein-schaften können jedoch nicht vollständig anarchistisch sein, da Polizei, Armee und Gesetze des Staates, in dem sie sich befinden werden, weiterhin bestehen bleiben und darüber wachen werden, daß der Staat respektiert wird.“ (In: https://sartre.ch/anarchie-und-moral)
Damit dürfte klar geworden sein, dass Sartre sich seit ca. Anfang der 1970er Jahre tatsächlich zu einem libertären Anarchismus bekannt hat, in dem der Marxismus nur noch eine unterge-ordnete Rolle spielte. Unberührt davon bleibt allerdings Sartres Bekenntnis zum Humanismus. Es lautet:
„Ich habe damit begonnen zu sagen: den Humanismus, den braucht es nicht. Dann sag-
te ich, dass der Existentialismus ein Humanismus sei, und dann wiederum, dass es besser sei, nicht darüber zu sprechen. Ich glaube, dass die Frage, die sich uns allen mehr oder weniger verschleiert stellt, immer noch lautet: ‚Was ist der Mensch?’ Das heißt praktisch: ‚Was kann ich als Mensch machen?’ Eine Handlung zwingt sich mir auf oder verweigert sich; was ist das, das moralische Gewissen? Wir können dies sehr wohl als Humanismus bezeichnen. In der Tat, verstehen wir unter Humanismus den Menschen als natürliches Objekt zu nehmen, das andern überlegen ist um sie zu beherrschen, dann bin ich kein Humanist. Der Mensch ist kein natürliches Objekt. Aber wenn man darunter im Gegenteil versteht, dass der Mensch qua Mensch versucht die Gesamtheit dessen zu bestimmen, was wir als Rechte und Pflichten bezeichnen, so bin ich Humanist.“
Hierzu finden wir Parallelen nicht nur in L’Espoir maintenant (BUG 23f.), sondern ebenfalls im Interview Macciocchis, als diese nach den Möglichkeiten eines „Huma-
nismus von links“ fragte. Sartre hielt ihn für möglich, aber nicht als ein Spiel von
Begriffen, sondern als moralischen Wert (UV 86):
„Für mich ist der Humanismus nicht eine Art, den Menschen zu definieren, aus ihm
eine wunderbare Kreatur zu machen, sondern in ihm den Nächsten zu erkennen, mit allen Verpflichtungen, die dies mit sich bringt, und der Freiheit, die eine solche Position impliziert. Das Wesentliche ist, dass der Mensch weiß, dass er Mensch ist. In welchem Sinn? In dem Sinn, dass er der Nächste eines andern Menschen ist, der dieselben Sachen ausdrücken will, und demzufolge alle Menschen gleich sind. [...]
Unsere Arbeit ist heute nicht nur darauf gerichtet, eine humanistische Gesellschaft zu gestalten, sondern ist auch der Versuch, die Rolle des Staates zu beschränken, und der Staat, der anthropomorphe Staat, ist die Schöpfung, die dem Manichäismus am nächsten steht.“
Mit diesem neuen Humanismus war auch eine weitere Relativierung der Zulässigkeit von Gewalt verbunden:
„Wenn man in einer manichäischen Welt lebt, lebt man schlecht und aggressiv. Nicht dass man nicht aggressiv sein darf; allgemeiner würde ich sagen, dass die Aggressi-vität eine menschliche Eigenschaft ist. Aber wir dürfen nicht mit der Aggressivität als Prinzip anfangen. [...] Gewalt ist ein Instrument verwahrloster Menschen, die sich als unterdrückte gesellschaftliche Kraft zusammenfinden, die außer der Gewalt keine andere Möglichkeit des Eingreifens hat. Es ist sinnlos, Paziismus zu predigen.“ Macciocchi: ...] Und ist es wahr, wie Raymond Aron sagt,dass Sie nach dem Vietnam- und dem Kambodschakrieg nicht mehr ein Vorwort wie jenes zu Fanons Die Verdammten dieser Erde schreiben würden?
[Sartre: ...] „Zum Vorwort zu Fanon, vielleicht würde ich etwas revidieren, jedoch kaum etwas. Ich sage Ihnen, dass es ein Fehler ist zu denken, dass ich die Idee der Gewalt als unverzichtbares Element des Kampfes aufgegeben habe. Sicher, mitnichten denke ich, dass sie die Bedeutung hat, die ihr der Marxismus gibt, “die Gewalt als Hebamme der Geschichte”. [...] Ich würde sagen, dass sogar in einer modernen Gesellschaft wie z.B. der französischen es eine Art von Unterdrückung gegenüber der Masse gibt, die diese knechtet. Woher kommt die Gewalt? Es gibt eine Gewalt, der wir für immer den Rücken zukehren sollten, die aggressive Gewalt, und es gibt eine explosive und defensive Gewalt der Leute, die die eigene Menschenwürde wieder-gewinnen, oder, wie man in andern Gesellschaften sagen würde, die die Einhaltung der Menschen rechte erreichen wollen. [...] Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo es eine Gewalt gibt, die befreit, wonach wir trachten sollen, und eine Gewalt, die unter drückt, die die andere rechtfertigt.“104
Kritische Anmerkung
Sartres Freiheits-Ideal unterscheidet sich kaum von dem, was Marx unter dem Reich der Frei-heit versteht: Vollkommene Selbstbestimmung freier Individuen in freien Assoziationen und damit das Ende jeglicher Herrschaft von Menschen über Menschen – was ja auch der Anar-chismus bzw. der Anarcho-Syndikalismus anstrebt. Da Sartre aber, so jedenfalls in den 1970er Jahren, die von Marx aufgewiesenen Voraussetzungen für die völlige Befreiung und Emanzipation aller Menschen ablehnt oder ignoriert, drängt sich der Eindruck auf, dass er sein persönliches Freiheits-Privileg – dasjenige eines freien Schriftstellers – verallgemeinert, ohne gründlich die anthropologischen und gesellschaftlichen Hindernisse zu analysieren, die einer solchen Verallgemeinerung im Wege stehen. Zu diskutieren wäre daher gegenwärtig zunächst, wie Freiheit in von der Öko-Katastrophe bedrohten, mehr oder weniger (schein-) demokratischen Klassengesellschaften überhaupt zu verwirklichen ist.
Wobei man Sartre Einiges zugute halten muss, und zwar 1. dass er sehr wohl den Zusam-menhang von Freiheit und Menschenrechten kennt und anerkennt, und 2. dass er die nach 1980 verstärkt auftretenden Verschlimmerungen der Öko-Krise, des Staatsterrors und des fundamentalistischen Terrors nicht erlebt hat. – Tatsache ist allerdings, dass Sartre schon die naturbedingten Grenzen der Freiheit nicht oder zu wenig berücksichtigt. Er versteht den Menschen vor allem als handelndes Kulturwesen, nicht aber auch als weitgehend determinier-tes Naturwesen.105 Wenn der Mensch jedoch die Natur und damit sich selbst misshandelt – wie es u.a. die fortschreitenden Umwelt- und Klima-Katastrophen offenbaren –, zerstört er selbst wesentliche Grundlagen und Voraussetzungen der eigenen Freiheit.
Bei Sartre kommt gravierend hinzu, dass er die Probleme der Willensfreiheit nicht oder nicht hinreichend analysiert (vgl. u.a. Libet 2005). Ähnliches gilt für Sartres Rechtfertigung von Gewalt, die dazu dient, die Menschenrechte zu erringen oder wiederherzustellen – Gewalt also als Mittel zu dem Zweck, politische Ziele zu erreichen. Genau dies nehmen aber auch fundamentalistische und andere Terroristen für sich Anspruch, die bekanntlich die Menschen-rechte missachten.
Weitere Kritikpunkte habe ich bereits 2015 angeführt, darunter auch zu Sartres Freiheits-begriff und zu seiner „Korrektur des Marxismus“ (s. Robra 2015, S. 317 ff.).
Albert Camus (1913-60)
Sartre gilt als „nordisch“, Camus als „mittelmeerisch“. Aber das ist Holzschnitt, Schwarz-Weiß-Malerei. In Wirklichkeit steckt in Sartre, dem Italien-Fan, Antikolonialisten und Anti-rassisten, viel Südländisches, während der Algerien-Franzose (‚pied-noir‘) Camus mit Philosophen wie Nietzsche, Spengler und Kierkegaard und mit der europäischen Belletristik – von Dostojewski bis Kafka, von Rilke bis zu Gide und Proust – bestens vertraut ist.
Camus würdigt das Absurde, leugnet den Sinn – und findet doch den Sinn des Lebens: im Leben selbst. Um das zu verstehen, muss man sich mit der Werte-Welt seiner Philosophie beschäftigen. Wie dies Detlev Mares in seiner Arbeit über den Bruch zwischen Camus und Sartre getan hat.106 Hieraus zitiere ich ausführlich, erlaube mir aber – der besseren Übersicht und Verständlichkeit halber – hin und wieder einen Zwischentitel hinzuzufügen. Mares schreibt (a.a.O. S. 5) zunächst über
Das Absurde und die Revolte: »Ausgangspunkt des philosophischen Denkens Camus‘ ist das „Absurde“, das Bewußtsein des Widerspruchs zwischen dem Streben des Menschen nach Sinn und der Erfahrung der Sinnlosigkeit der Welt. Das Fehlen der Wahrheiten über die Grundprobleme der existentiellen Situation des Menschen führt zur Verzweiflung als unentrinnbarer Grunderfahrung. Indem der Mensch sich aber für das Leben entscheidet, also nicht aus Verzweiflung Selbstmord begeht, sieht er dem Absurden ins Auge. In dieser Auflehnung gegen das Absurde revoltiert der Mensch gegen die Negativität des Daseins und verleiht dem Leben seine Größe und seinen Wert, denn in dieser Revolte „entdeckt man die metaphysische Forderung nach Einheit, die Unmöglichkeit ihrer habhaft zu werden, und die Herstellung einer Ersatzwelt“. In seiner Revolte bezeugt der Mensch „Tag für Tag seine einzige Wahrheit“, indem er die Herausforderung des Lebens annimmt. «
Mittelmeerisches Denken. » Das rechte Maß, das den Verführungen absoluter Weltan-schauungen entgegentritt, sieht Camus im mittelmeerischen Denken manifestiert. Schon 1938 verwies er „in einer Zeit, da die Vorliebe für Doktrinäres uns der wirklichen Welt entfremden will“, auf die „Verbundenheit mit den wenigen vergänglichen und wesentlichen Dingen, die unserem Leben einen Sinn geben: Meer, Sonne und Frauen im Licht“. Eine Aussage von 1958 verdeutlicht Camus‘ Ablehnung einer Vergötzung der Geschichte trotz des Fehlens anderer absoluter Wahrheiten und der Grunderfahrung des Absurden: „Das Elende hinderte mich, zu glauben, daß alles unter der Sonne und in der Geschichte gut sei; die Sonne lehrte mich, daß die Geschichte nicht alles ist. Das Leben ändern, ja, nicht aber die Welt“. Indem Camus in Der Mensch in der Revolte Ideen wie die Forderungen nach Freiheit oder Gerechtigkeit bis in ihre letzten Konsequenzen zu Ende denkt, zeigt er, daß alle geschicht-lichen Versuche, das Absolute zu verwirklichen, zum Scheitern verurteilt sind und unter-mauert somit seine Philosophie eines bewußten Maßhaltens und einer Liebe zur Welt. «
Marxismus und Stalinismus: Terror statt Freiheit!? »Camus sieht im Denken Marx‘ die Vermischung einer wissenschaftlichen Methode zur Kritik des herrschenden Kapitalismus mit einem auf die Zukunft gerichteten „utopischen Messianismus“. „Das Unglück ist, daß die kritische Methode, die ihrem Wesen nach der Realität angepaßt gewesen wäre, sich immer mehr von den Tatsachen entfernte, insofern als sie der Prophezeiung treu bleiben wollte“. „Die Idee einer Sendung des Proletariats konnte sich schließlich bis heute in der Geschichte nicht verkörpern. Das faßt den Mißerfolg der marxistischen Prophetie zusammen“. „Das Ende der Geschichte ist kein Wert des Vorbilds und der Vervollkommnung. Es ist ein Prinzip der Willkür und des Terrors“. Mit der Stärkung der Staatsmacht sieht Camus das Regime Stalins in einen Widerspruch zu seiner offiziellen Philosophie geraten: „Entweder hat dieses Regime die klassenlose sozialistische Gesellschaft verwirklicht, dann rechtfertigt sich die Beibehaltung eines ungeheuren Unterdrückungsapparates nach marxistischen Begriffen nicht, oder es hat sie nicht verwirklicht, und dann ist der Beweis erbracht, daß die marxistische Doktrin irrig“ ist. Um nicht zugeben zu müssen, daß die marxistische Lehre falsch sei, identifiziere sich die revolutionäre Prophetie mit einer Staatsdoktrin, die „zugunsten einer entfernten Gerechtigkeit die Ungerechtigkeit während der ganzen Zeit der Geschichte“ legitimiere. Damit werde die Freiheit der gegenwärtig lebenden Menschen zugunsten einer unsicheren Verkündung zukünftiger Freiheit abgetötet. Camus lehnt dieses Denken entschie-den ab und stellt ihm seine Auffassung mediterranen Maßes entgegen, das sowohl die Hoffnung auf eine jenseitige Zukunft als auch die Erwartung einer geschichtlichen Zukunft zugunsten gegenwärtigen Glücks zurückweist. Die Zurückweisung des Stalinismus durch Camus verschaffte dem Mensch in der Revolte eine warmherzige Aufnahme bei Konser-vativen und Antikommunisten.« (Mares a.a.O. S. 6 f.)
Hieran schließt sich der bereits erwähnte Streit an, der zum Bruch mit Sartre führte. Camus‘ Revolte stößt bei Sartre auf taube Ohren, zumal dieser in Camus‘ Auflehnungsgebärde keine historisch angemessene Reaktion auf die tatsächlichen Missstände – Absurditäten, Elend, Ungerechtigkeiten usw. – der Zeit sieht.
Camus‘ eigenständige Lebensphilosophie. Womit Sartre allerdings Camus nicht gerecht wird, zumal dieser größten Wert darauf legt, kein Menschenleben „zugunsten utopischer Ziele“ zu opfern (Mares a.a.O. S. 11). In der Revolte sieht Camus den wahren Wert des Lebens bestätigt. Fast gänzlich auf sich selbst gestellt – jedenfalls ohne göttlichen Beistand – setzt der Mensch selbst seine Werte, erkämpft sie für sich und andere. Noch der Einsamste (‚solitaire‘) kann solidarisch (‚solidaire‘) sein. Diesen Optimismus der Solidarität lässt Camus – zumindest zeitweise – sogar an die Stelle des Absurden treten. Aber auch darin erschöpft sich seine Philosophie nicht. Diese erweist sich vielmehr als eine eigenständige Lebens-philosophie, deren Inhalt Camus selbst wie folgt andeutet:
„ Das Leben hinnehmen, so wie es ist? Dumm. Mittel, es anders zu machen? Wir sind weit entfernt davon, das Leben zu beherrschen, das Leben ist es, das uns beherrscht und uns bei jeder Gelegenheit das Maul stopft. Das menschliche Schicksal hinnehmen? Im Gegenteil, ich glaube, dass die Revolte zur menschlichen Natur gehört. Es ist eine finstere Komödie, so zu tun, als ob man bereit wäre, das zu akzeptieren, was uns auferlegt ist. Es geht vor allem darum zu leben. So viele Dinge sind es wert, geliebt zu werden, und es ist lächerlich, so zu tun, als ob man nur den Schmerz lieben könnte. Komödie. Verstellung. Man muss aufrichtig sein. Aufrichtig um jeden Preis, auch wenn es uns schadet.
Also weder Revolte noch Verzweiflung. Das Leben, mit allem, was dazugehört. Wer gegen das Leben revoltiert oder es nur erduldet, verschließt sich vor ihm. Reine Illusion. Wir sind im Leben. Es schlägt uns, es verletzt uns, es spuckt uns ins Gesicht. Es erleuchtet uns auch mit einem plötzlichen und verrückten Glück, das uns teilhaben lässt. Das dauert nicht lange. Aber es reicht. Man soll sich nicht täuschen. Der Schmerz ist da. Kann man nicht leugnen. Vielleicht ist in unserem tiefsten Inneren der wesentliche Teil des Lebens. Unsere Wider-sprüche. Die Mystiker und J.-C. Liebe. Vereinigung. Sicherlich, aber wozu Worte darum machen? Bis später.“ (Zitiert von Iris Radisch: Camus.Das Ideal der Einfachheit. Eine Biographie, Reinbek 2014, S. 183 f. Dass Camus hier sogar „J.-C.“, also Jesus Christus, anführt, mag erstaunen. Immerhin sagte Jesus ja von sich, er sei „der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Und wie sagte doch Sartre?: Der Mensch ist nichts anderes als sein Leben!)
Bei Camus dreht sich also letztlich alles um das Leben selbst, so dass auch das Absurde und die Revolte dagegen als der Philosophie des Lebens untergeordnet erscheinen. Schon hier-durch unterscheidet sich Camus‘ Denken – trotz aller Beeinflussung – von demjenigen Nietzsches. Nicht der Übermensch des „Willlens zur Macht“ ist das Ziel, sondern Einfühlung und Einfügung in ein „kosmisches Urgeschehen“ (Radisch a.a.O. S. 184) als Grundlage jeglichen Lebens. Vor teutonischem Übermut und Größenwahn will Camus uns schützen durch die mittelmeerischen Tugenden des Maßes, der Naturverbundenheit und Leichtigkeit, durch hellenische Klugheit und Heiterkeit, französischen Esprit und Savoir-vivre, kurzum: durch Lebenskunst.
Was Camus und Sartre trotz allem verbindet.
Insofern erscheint auch der Streit mit Sartre nunmehr in anderem Licht. Statt unüberwindbare Gegensätze zwischen den beiden Kontrahenten hervorzuheben, wie dies nicht wenige Kritiker tun (so auch Lévy für Sartre, Radisch für Camus), sollten die Gemeinsamkeiten gewürdigt werden. Beide Denker verteidigen doch zweifellos die Freiheit, die Freiheitsrechte und das Glücksstreben jedes Menschen. Beide bekämpfen jede Form von Unfreiheit – sei sie ökonomischer, sozialer, politischer, religiöser oder sonstiger Art. Wenn Sartre nach Ungarn 1956, Prag 1968 und Pariser Mai ’68 den Sowjetkommunismus scharf verurteilt, stellt er sich praktisch erneut an die Seite seines einstigen Freundes Camus.
Hinzu kommt, dass sowohl Sartre als auch Camus den geschichtlichen Determinismus (das marxistische „Sinngesetz“) und die Festlegung der Geschichte auf ein utopisches Ziel der Zukunft ablehnen. Beide wollen keinen Nihilismus, sondern Lebensbejahung und Gerechtig-keit.
Beide sind gegen den Totalitarismus. Müßig scheint es mir, darüber zu spekulieren, wie beide, lebten sie heute noch, die neueste Form des Totalitarismus – die Globalisierung – einschätzen würden. Dass die sozialen Ungleichheiten sich ständig verschärfen, die Soziale Frage ungelöst bleibt, Elend, Ausbeutung und Unterdrückung – nicht nur in den Ländern der einstigen „Dritten Welt“ – sich immer wieder und immer weiter ausbreiten, die Menschheit von einer Krise in die nächste taumelt – all dies hätten beide, Camus und Sartre, niemals hingenommen, niemals als „gottgewolltes Schicksal“ akzeptiert.
Humanistik
mit dem Untertitel „Beiträge zum Humanismus“ lautet die Überschrift eines 2012 erschie-nenen Sammelbandes mit Aufsätzen zum Thema. Es ist eine „Enzyklopädie“, der Versuch einer Gesamtsicht wissenschaftlicher und philosophischer Humanismus-Konzepte, und zwar mit folgenden Themenkreisen: 1. (antihumanistische) Kritik, 2. Selbstkritik, 3. Humanismus-forschung, 4. gegen Faschismus und NS-Ideologie, 5. „Weltanschauungspflege“. Als Auf-gaben einer Enzyklopädie des Humanismus nennt Hubert Cancik:
„ – das allgemeine und gemeinsame Wissen zum Thema Humanismus darstellen,
– die spezielle Humanismusforschung erschließen,
– die verschiedenen Richtungen und Institutionen der humanistischen Bewegung in Geschichte und Gegenwart vorstellen,
– den Zusammenhang der verschiedenen Felder des Humanismus verdeutlichen, von praktischer Philosophie, Pädagogik, Kulturgeschichte, humanitärer Praxis,
– die neuen Felder und Aufgaben bestimmen, die dem Hiumanismus durch die Entwick-lung der modernen Medizin, der Menschenrechtspolitik und der Geschlechterstudien entstanden sind,
– das humanistische Erbe aus Antike, Renaissance und Aufklärung, die Erinnerung an humanistische Bilder, Namen, Geschichten, an Leistungen und Katastrophen des Hu-manismus einbringen und anschaulich machen,
– die Humanismen der außereuropäischen Kulturen darstellen, soweit nach Forschungs-stand und Umfang möglich,
– die Humanismuskritik auswerten, Antihumanismus kenntlich machen.“ (a.a.O. S. 22 f.)
Wobei, zumal in digitalen Fassungen, Bilder, Namen, Begriffe und sogar Musik zur Geltung kommen sollen. Humanismus sei weder Religion noch Philosophie, sondern eine „unfertige Weltanschauung“ (S. 27). Der Mensch zeichne sich durch Vernunft aus; darüber hinaus, schon im Sinne der klassischen humanitas, u.a. durch „Menschlichkeit im Fühlen und Han-deln: mitleidig, hilfsbereit, tolerant, taktvoll, geschickt im menschlichen Umgang, urban, mit Anstand und Witz“ (S. 29). Speziell für den Prozess der Zivilisierung: Humanisierung in Bezug auf Menschenwürde, Arbeit, Freizeit, Gesundheit, Tierschutz, Gleichberechtigung, Ju-stiz, Religion u.a.. Gewalt soll reduziert, Schwache sollen geschützt werden. Menschenbilder lassen sich exemplifizieren durch Ödipus und Giordano Bruno – mit dem Gegenbild des NS-„Untermenschen“ (S. 37 ff.).
Als erneuerungsbedürftig erscheint der Humanismus des 18. Und 19. Jahrhunderts. Positive Anthropologisierung führe zu Religionskritik und zum Verlust von Transzendenz; Vernunft befähige zur Autonomie, d.h. auch zu eigenständiger kultureller Produktion (S. 61).
Humanismusforschung soll, wie Frieder Otto Wolf erklärt, auf jeden Fall die Politik einbezie-hen. Humanistische Philosophie könne es durchaus geben, wie F.O. Wolf selbst es in seinem Buch Humanismus für das 21. Jahrhundert (2008) dargelegt hat. Argumentations- und Deliberations-Fähigkeiten sind zu fördern, „kontemplative Verengung“ zu vermeiden (S. 83). Praxis und Sinnsuche sollen koordiniert werden. Humanismusforschung gelingt am besten in-terdisziplinär.
Horst Junginger und Horst Groschopp fordern, Faschismus und Antihumanismus entschieden zu bekämpfen (S. 165 ff.). Während es in den Weltanschauungen u.a. um das Weltganze und den Sinn des Lebens geht, soll die Weltanschauungspflege solche Bemühungen „fürsorgend verwalten“ und nachhaltig sichern, wozu es ganz am Schluss des Bandes heißt:
„Den weltanschaulichen Humanismus kreativ, individuell und nach den jeweiligen Möglichkeiten auszugestalten und so überhaupt erst „in die Welt zu bringen“ gehört auf jeden Fall zu den Aufgaben der haupt- oder ehrenamtlichen „Weltanschauungs-pflegerinnen und Weltanschauungspfleger“. Dafür gibt es weder Patentrezepte noch Erfolgsgarantien – und auch ökonomisch sind die Umstände in der Regel wenig er-quicklich.
Humanistinnen und Humanisten waren immer findige Geister und sind es gewohnt zu akzeptieren, dass oft schon der Weg das eigentliche Ziel ist – ganz im Sinn einer of-fenen Weltanschauung, die ebenfalls mehr einer Reise gleicht als einem Fahrplan, wenn dieses Quasi-Haiku zum Abschluss gestattet sei.“ (Michael Bauer, S.267 f.)
Julian Nida-Rümelin (geb. 1954)
Im Folgenden abgekürzt als: N.-R. Er gewinnt seinen erneuerten Humanismusbegriff nicht zuletzt aus einer Kritik am naturalistischen Reduktionismus. Naturalismus definiert er zu-nächst als „die Überzeugung, dass alles, was ist, von Natur (φύσεί) ist, dass alles in einen natürlichen Zusammenhang eingebettet ist und nichts außerhalb der natürlichen Ordnung der Dinge steht“.107 Diese Sicht verleitet ihn aber nicht dazu, die Verdienste des Naturalismus zu schmälern. Er schreibt nämlich:
„Naturalismus lehnt vieles ab – das meiste zu Recht, wie zum Beispiel göttliche Ein-griffe in das Naturgeschehen, um Ereignisse zu erklären. Der Ursprung und die nach wie vor große Stärke des Naturalismus ist seine Ablehnung des Animismus in all seinen offenen und verdeckten Formen, einschließlich dem, was sich heute unter »Esoterik« großer Beliebtheit erfreut. Es gibt keine Chakren, keine wundersamen Energieströme, keine durch starke Verdünnungen von heilenden Substanzen aufgela-dene Wassermoleküle (wie die Homöopathie annimmt), keine Heilungen durch Er-leuchtung, keine Hexen etc. Bis dahin scheint der Naturalismus noch – weitgehend – unproblematisch, er versucht ein gewisses Maß an Vernunft zu wahren, indem er der naturwissenschaftlichen Rationalität vertraut und alternative »Rationalitäten« ablehnt. Erst seine nähere Charakterisierung, sowohl die des griechischen Epikureismus wie die des zeitgenössischen Physikalismus, lässt die naturalistische Doktrin fragwürdig werden.“ (a.a.O., ebd.)
N.-R. räumt also ein, dass auch Naturalisten über ein gewisses Maß an Vernunft – insbesondere in Form der naturwissenschaftlichen Rationalität – verfügen, ohne diese Form von Vernunft rein naturwissenschaftlich erklären zu können. – Am Anfang naturalistischer Fehlentwicklungen stehe der epikureische Materialismus bzw. Atomismus. Die moderne Physik habe – unbewusst – diese reduktionistische Auffassung mitsamt ihrem stoischen Widerpart der „Gesetzartigkeit“ mit der modernen Gleichsetzung von Vernunft und voll-ständiger mathematischer Beschreibbarkeit der Welt verbunden, bis ab den 1970er Jahren die Quantenphysik diesen Optimismus zerstörte. Nicht zerstört wurde jedoch der naturalistische Reduktionismus, zumal in den Formen der modernen Genetik und insbesondere der Neuro-wissenschaften. Dazu schreibt N.-R.
„Wir erleben gegenwärtig eine Neuauflage des physikalistischen Naturalismus, trans- formiert in die These mancher Neurophysiologen, dass es keine menschliche Verant-wortung gebe, weil es keine menschliche Freiheit gebe. Denn alles Geistige, alle Inten-tionen, alle Absichten, alle Wünsche und Überzeugungen seien nichts anderes als be-stimmte neurophysiologische Prozesse, die selbst den Regeln der Physik gehorchten, wie rudimentär bislang auch die neurophysiologischen Konkretisierungen diese Ge-setze sein mögen.“ (a.a.O. S. 396)
Was zweifellos auf einen vollständigen Determinismus und damit die vollständige Leugnung der Freiheit des Menschen hinausläuft; was N.-E. wie folgt erklärt:
„Zeitgenössische Neurophysiologen variieren diese Weltanschauung folgendermaßen: Das Verhalten jedes Individuums ist durch seine genetische Ausstattung, epigenetische Effekte und die jeweiligen Umweltbedingungen vollständig determiniert. Das Indivi-duum glaubt zu deliberieren, es glaubt zu entscheiden, es glaubt frei zu sein, ist aber nichts anderes als eine Billardkugel, auf die allerdings komplexe Prozesse (genetische, epigenetische, sensorische) einwirken.“ (a.a.O. S. 397)
Mit beträchtlicher Außenwirkung, z.B. unter Juristen, die das geltende Schuldstrafrecht auf-weichen oder ganz abschaffen möchten. Was N.-R. entschieden zurückweist, und zwar u.a. mit dem Hinweis, dass auch Straftäter eine „spezifische Würde als verantwortliche Akteure“ besitzen (S. 398).
Die gefährlichste Form des naturalistischen Reduktionismus sieht N.-R. allerdings nicht in der physikalistischen, sondern in der biologistischen Variante, in einem Sozialdarwinismus, der schließlich in der nationalsozialistischen Katastrophe gipfelte. Umso erstaunlicher ist die Tat-sache, dass es weiterhin die Kombination von Naturalismus und Anti-Humanismus gibt, ob-wohl keinerlei wissenschaftliche Belege vorhanden sind, die die Grundprinzipien des Huma-nismus in Frage stellen würden (a.a.O. S. 399).
Worin besteht nun N.-R.s (erneuerter) Humanismus?
Die Grundpfeiler hierfür sind „Humanistische Anthropologie“ und „Humanistische Seman-tik“. Kronzeugen und würdige Nachfolger des antiken Bildungsideals der antiken ‚paideia‘ seien u.a. Wilhelm von Humboldt mit seiner umfassenden Bildungsreform und Jean-Jacques Rousseau mit seiner Auffassung von ursprünglicher Freiheit in Verbindung mit seiner poli-tisch-anthropologischen Theorie, wonach politische Herrschaft stets durch den Volkswillen (volonté générale) legitimiert sein müsse; gestützt auf die Überzeugung, dass dem Menschen von früher Kindheit an das Recht auf eigenständige Entwicklung und wachsende Selbst-bestimmung zustehe.
Darüber hinaus beschreibt N.-R. den Menschen als vernunftfähiges Wesen, das sich auf Gründe – und nicht etwa nur auf Wünsche – beruft. Persönlichkeit entwickelt sich auf Grund solcher und anderer Fähigkeiten, darunter zu Urteil, Bewertung, Stellungnahme, Erklärung, intersubjektive Begründung, Toleranz und Kritik. – Speziell zum Humanismus geht N.-R. zu-nächst erneut auf die antiken Ursprünge ein, sodann auf „das Gemeinsame humanistischen Denkens“, das auf den antiken Ursprüngen beruhe (a.a.O., S. 218 ff.). Ferner geht es um den „Selbstwert der Bildung“ (S. 219).
Den Kern einer humanistischen Anthropologie sieht N.-R. in dem Dreigestirn „Vernunft – Freiheit – Verantwortung“, wobei Kants Autonomie-Begriff nach wie vor ausschlaggebend sei. Mit der Folge, dass die Menschenwürde in den Vordergrund der Überlegungen tritt. Unabdingbar sind Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit, was N.-R. letztlich auf die Fä-higkeit aller Menschen zurückführt, „sich von Gründen leiten zu lassen“.
Als Bildungsziele gelten vor allem Rationalität, Freiheit und Verantwortungsfähigkeit.108 Entgegen instrumenteller bzw. konsequentialistischer Konzepte pocht N.-R. auf die Praxis gemeinsamer Begründungen und Entscheidungen, insonderheit in der Demokratie. Dazu N.-R.:
„Der erneuerte Humanismus, für den ich plädiere, stellt dem die verantwortliche Persönlichkeit gegenüber, die sich durchhaltende Gründe hat, erkennbar ist in den Gründen, die sie vorbringt, und die den Kern humaner Praxis, den respektvollen Um-gang, keiner Form von Instrumentalisierung opfert.“ (a.a.O. S. 232)
Abzulehnen seien daher alle Versuche, das Subjekt-Sein des Menschen in Frage zu stellen. Nur dann könne auch die unabdingbare Fähigkeit zur Kritik erhalten bleiben, ebenso die „Ro-bustheit dieser lebensweltlichen Praxis“ (S. 232 f.).
Ähnliches gelte für den Freiheitsbegriff. In unserem Verhalten seien wir grundsätzlich frei, weil wir Gründe für unser Verhalten angeben und austauschen können (S. 235); was sich allerdings nicht mit Willensschwäche verträgt. Denn:
„Menschliche Freiheit besteht darin, das zu tun, was dem eigenen (normativen) Urteil entspricht, vorausgesetzt, dieses Urteil beruht auf einer angemessenen Abwägung von Gründen. Eine angemessene Abwägung praktischer Gründe führt zu einer insge-samt kohärenten Lebensform.“ (S. 238)
Verantwortung. Hierzu N.-R.:
„Der (neohumanistische) Verantwortungsbegriff, für den ich plädiere, geht weit über den kantischen hinaus. Es ist nicht mehr allein das Handeln aus Achtung vor dem Sittengesetz, das den vernünftigen, autonomen Akteur ausmacht, sondern die Praxis als ganze. Je kohärenter die Praxis, je klarer die Lebensform als ganze von Gründen strukturiert ist, desto vernünftiger (und autonomer) ist die betreffende Person. Sie gewinnt an Freiheit dadurch, dass sie sich von ihren Augenblicksneigungen distanziert und sich von Gründen leiten lässt.“ (S. 242)
Mit der Folge, dass es nicht nur auf autonomes, verantwortbares Handeln ankommt, zumal auch schon Wahrnehmungen und Emotionen von Vorerfahrungen und -prägungen und ver-innerlichten Theorien beeinflusst sind. Dementsprechend fordert N.-R. eine normative huma-nistische Anthropologie (S. 259 ff.), die auch die Sinnfrage, speziell die Frage nach dem Sinn des Lebens, die praktische Rationalität und eine humanistische Semantik umfasst, die sich der „Grenzen der Sprache“ bewusst ist (S. 270 ff.). Wobei auffällt, dass N.-R. sprachliche Bedeutung – in Anlehnung an Wittgenstein s Gebrauchstheorie der Sprache – vor allem als kontextuelle und pragmatische Bezugsgröße ansieht, ohne jedoch die Grenzen unserer Welt mit denen der Sprache gleichzusetzen. Überdies werde sprachliche Bedeutung durch „Intenti-onalität und Normativität“ verliehen.
N.-R. thematisiert andernorts auch Digitalisierung, KI und Transhumanismus, letzteren jedoch nur in einem relativ kurzen Kapitel über die „transhumanistische Versuchung“.109 Zu Digitali-sierung, KI, Robotik, Trans- und Posthumanismus lege ich später Ausführliches dar (s.u.). –
Erotischer Humanismus
Intensiv behandelt N.-R. das Thema, und zwar in Zusammenarbeit mit der Kulturwissen-schaftlerin Nathalie Weidenfeld (im Folgenden abkürzt als N.W.). Wobei glücklicherweise klar wird, dass auch Akademiker sich noch auf den Plauderton verstehen. Man kann diesen Ton wählen, wenn man ein Thema wie den Erotischen Humanismus behandelt. Hier fallen der Plauderton und das Anekdotische angenehm auf, zumal über das „Thema Nr. 1“ schon viel (allzu viel?) Wissenschaftliches und Unwissenschaftliches veröffentlicht worden ist.
Nichtsdestotrotz beginnen N.-R. und N.W. ihren 227 Seiten langen Text110 mit einem ca. 7 Seiten umfassenden Auszug aus Platons ‚Symposion‘, in dem es um die dem Menschen „eingeborene“ Liebe geht, aber auch um Ehebruch, Pädophilie, Tod und Ehrfurcht vor den Göttern. Dabei handelt es sich um „weitaus mehr als das sexuelle Streben, es geht um das Streben nach Vollkommenheit und Selbstverwirklichung in Gemeinschaft mit einer anderen Person“ (a.a.O. S. 22). Darauf folgen 15 durchweg nicht mehr als 15 Seiten enthaltende Kapitel, in denen die Themen oft anekdotenhaft und umgangssprachlich abgehandelt werden.
Es beginnt furios mit einem „Hirn auf zwei Beinchen – Entwürdigung “. In zwei Versionen eines Offenen Briefes klagt Dr. Nathalie W. über gängiges frauenfeindliches Verhalten. In der ersten Version schildert die Autorin die Entwürdigung, die darin besteht, dass sie auf ihren Geist, ihren Verstand und ihr Wissen reduziert wird. Freimütig äußert sie ihren Unmut:
„Diese Ungerechtigkeit macht mich einfach nur noch wütend. Warum werde ich nur immer wieder auf diesen einen Teil meines Selbst, meinen Intellekt, reduziert? Habe ich nicht auch einen Körper? Beine? Arme? Augen? Einen Mund? Eine schlanke Taille? Einen Busen?“ (a.a.O. S. 28)
Solche Reduktion von Akademikerinnen auf „ein körperloses Gehirn“ müsse sofort unter-bunden werden (S. 29).
In der zweiten Version des Offenen Briefes ändert die Autorin „lediglich ein Detail“, indem sie die umgekehrte, weitaus häufigere Reduktion von Frauen auf ihren Körper anprangert, wobei deren Intellekt sozusagen ausgeblendet wird: „Schau mal, die da, wie geil die aus-sieht!“ (S. 31) Was ein typisch machohafter Ausspruch sei, den Männer beim Anblick einer attraktiven Frau von sich geben.
Als gefährlichen Untergrund für solche Reduktion nennt die Autorin den mangenden Respekt für die Menschenwürde, die der israelische Philosoph A. Margalit übersetzt habe „in das Gebot, niemanden in seiner Selbstachtung existenziell zu beschädigen“ (ebd.). Was allerdings nicht immer problemlos anwendbar sei; sicherlich aber auf die patriarchalische Tradition, Frauen zu Lustobjekten herabzuwürdigen, was stets einen Mangel an Rücksichtnahme bedeu-te. Fazit:
„Der Erotische Humanismus versucht, so weit es geht Rücksicht auf individuelle Sen-sibilitäten zu nehmen, aber nur in dem Rahmen, in dem sie angemessen und sozial ver-träglich sind, also sich an den Normen zu orientieren, die ein Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft ermöglichen.“ (S. 42)
Im zweiten Kapitel wird, ausgehend von einem phantastischen Film mit Sport treibenden Tieren (Giraffen, Elefanten usw. beim 100m-Lauf), die Chancengleichheit diskutiert, deren vollkommene Realisierung als unmöglich erachtet wird. Konkretisiert u.a. an unterschiedli-chen schulischen Leistungen von Jungen und Mädchen, was aber keine Diskriminierung be-deute, sondern auf eine „Ungleichverteilung von Leistungen“ bzw. darauf zurückzuführen sei, dass Mädchen sich zumeist mehr als Jungen überhaupt für schulischen Unterricht interessie-ren (S. 55). Fazit:
„Der Erotische Humanismus strebt nicht nach einer Gleichverteilung zwischen den Geschlechtern, sondern nach einem gleichermaßen respektvollen Umgang und glei-chen Chancen für Männer und Frauen, Autoren und Autorinnen ihres Lebens zu sein.“ (S. 57)
Der Titel des 3. Kapitels lautet: „Warum es wichtig ist, dass die Sicheln der Männer glatt und die der Frauen gezähnt sind – Normierung und Nivellierung des Arbeitsmarktes “ (S. 59). Schwierig werde das Verhältnis von Männern und Frauen im Arbeitsleben, wenn z.B. Eheleu-te in Konkurrenzsituationen geraten, weil sie beide auf dem gleichen Arbeitsgebiet tätig sind. Der Kulturhistoriker Ivan Illich macht den kapitalistischen Arbeitsmarkt dafür verantwortlich, „dass die Arbeit sexistisch wurde“, Frauen also zurück an den Herd gedrängt und Männer überall in der Industrie bevorzugt würden (S. 62 f.). Wie aber sollen dann Mann und Frau, wie es der Erotische Humanismus fordert, noch „Autor und Autorin des eigenen Lebens“ sein können? Hierzu plädieren N.-R. und N.W. a) für gleiche Respektierung unterschiedlicher Aktions- und Berufsfelder, b) für die Förderung von „Divergenz und Variation“ – statt „Nor-mierung und Nivellierung“. Ferner:
„Die staatliche Familienpolitik sollte auf die Förderung von Selbstbestimmung und Kooperation zum Wohl der Kinder ausgerichtet sein, die Potenziale freier Selbst-bestimmung in familiärer Verantwortung stärken und existenzielle Krisen durch Tren-nung, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Arbeitslosigkeit materiell abfedern.“ (S. 68)
Im 4. Kap. geht es um „Quotenpolitik“. Wichtiger als Gleichverteilung sei das Recht auf „Selbstverantwortlichkeit und Freiheit menschlicher Individuen“ (S. 81).
In den darauf folgenden Kapiteln behandeln N.-R. und N.W. u.a. „ungleiche Arbeitswelten“, Me Too und die „Erotik der Macht“. Sie wenden sich gegen die Diabolisierung von Frauen, „die bewusst ihre Sexualität leben“ (S. 126), und sie folgern:
„Das erotische Begehren ist keine Bedrohung von Menschenwürde und Freiheit, son-dern eine List unserer menschlichen Natur – die sich in unterschiedlichen Kulturen ganz verschieden äußern kann –, um Zugang zur Welt und zu einem gegenüber zu fin-den, nicht allein zu bleiben, Interesse an Kontakt und größerer Nähe zu bekunden, aber im Unverbindlichen zu bleiben, die Möglichkeit des eigenen Rückzugs immer einge-schlossen. Es ist eine Form humaner Praxis, die im Erotischen Humanismus kultiviert wird.“ (S. 126 f.)
In Kap. 9 wird das Thema ‚Pornografie‘ diskutiert. Man kommt zu der Folgerung:
„Der Erotische Humanismus steht für eine Gedankenfreiheit und Selbstbestimmung. Er trennt zwischen Fantasie und Realität und versucht nicht, fiktionalisierte erotische Narrative an politisch korrekten Normen auszurichten. Er warnt allerdings davor, Se-xualität und Erotik etwa in Form von Sexrobotern zu entpersonalisieren und dabei die menschliche Dimension der Erotik zu unterlaufen.“ (S. 156)
Den Rest des Buches kann man wie folgt zusammenfassen:
1. „Der Erotische Humanismus steht dafür, Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herzustellen. Ein humanes Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist gekenn-zeichnet vom Bemühen um Kooperation auf gleicher Augenhöhe, von wechsel-seitigem Respekt, in Anerkenntnis unterschiedlicher Lebenserfahrungen und Prägun-gen.“ (S. 167)
2. „Der Zusammenhang zwischen Künstlerintention und Kunstqualität ist zu komplex, um ihn unter das Kriterium eines vordergründigen Moralismus zu stellen. Die Tat-sache, dass das Geschlechterverhältnis in vielen Kulturen und über lange Phasen der Menschheitsgeschichte problematisch, ja oft genug inakzeptabel war, darf nicht dazu führen, dass alle Kunst, in der sich diese Problematik spiegelt, geächtet wird. Der Erotische Humanismus plädiert für moralische Standards und gegen moralisierende Zensur.“ (S. 178 f.)
3. „Das Unbehagen vieler Menschen, jüngerer wie älterer, gegenüber einem Übermaß an einer intellektuell angeleiteten Normierung speist sich wohl aus der intuitiven Einsicht in manche Invarianzen der menschlichen Erotik. Der Erotische Humanismus versucht die Differenzen der Geschlechter nicht durch kulturelle Normen der Assimilation ein-zuebnen. Er ist tolerant gegenüber Differenzen der Geschlechter und weiß um die Komplexität menschlichen Verhaltens.“ (S. 189)
4. „Der wirksamste Beitrag zu einem menschlichen, respektvollen und kooperativen Umgang der Geschlechter ist die politische Garantie gleicher Optionen, die Sicher-stellung der sozialen Voraussetzungen eines selbstbestimmten Lebens – auch in Zeiten existenzieller Krisen oder besonderer Herausforderungen wie Elternschaft, Trennung, Alter, Krankheit. Die politische sozioökonomische Strategie kann kulturell neutral bleiben und auf das Ziel der Transformationen von Gender-Identitäten und Lebensfor-men verzichten.“ (S. 202)
5. „Es wäre im Sinne des Erotischen Humanismus, die Geschlechteridentität aus der rechtlichen und politischen Normierung vollständig herauszunehmen, da die Ge- schlechter-Identität für die Übernahme öffentlicher Ämter, für berufliche Leistungen, für die gleiche Anerkennung in der Bürgerschaft keine relevante Rolle spielt. Soziale Bewegungen, die die individuelle Freiheit der erotischen Expression und der kulturellen Identität beschränken, gefährden die Lebensautorschaft der einzelnen Personen.“ (S. 210 f.)
6. „Der Erotische Humanismus erkennt die kulturelle Leistung an, Normen des Zusam-menlebens zu etablieren, die zu einer biografischen Stabilität beitragen. Zugleich aber möchte er den einzelnen Individuen ermöglichen, ihr Leben nach eigenen Vorstellun-gen einzurichten und in unterschiedlichen Liebeskonstellationen zu leben. Man könnte sagen, der Erotische Humanismus versucht die Synthese zwischen konservativer Nor-menkontrolle einerseits und utopischen Neukonstruktionen andererseits. Ambiguitäts-toleranz und das Recht, seine intime Privatsphäre auch zum Teil geheim zu halten, er-möglichen eine solche Praxis.“ (S. 227, Textende)
Kritische Anmerkungen
Wie aus den Offenen Briefen von Nathalie Weidenfeld (s.o.) hervorgeht, wird das Mensch-Sein im Wesentlichen in zwei Formen des Reduktionismus völlig verkannt: a) wenn nur auf den Körper, b) nur auf den Geist des Menschen abgehoben wird. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, das Mensch-Sein als Ganzes naturalistisch zu reduzieren. Wonach alles nur Natur und nichts Anderes sei. Außer Acht bleibt in jedem der drei Fälle dasjenige, was die Einheit des Mensch-Seins tatsächlich ausmacht: das Miteinander von Körper, Seele und Geist – die zugleich durch bestimmte Besonderheiten, spezielle Merkmale relativer Eigenständig-keit und Autonomie gekennzeichnet sind.
N.-R. wendet sich ausdrücklich gegen die naturalistische Reduktion, d.h. nicht gegen die Natur und auch nicht gegen die Tradition des Naturalismus, sondern nur gegen dessen Verzer-rung und Verkürzung, z.B. durch zeitgenössische Neurowissenschaftler. N.-R. betont:
„Wir erleben gegenwärtig eine Neuauflage des physikalistischen Naturalismus, trans- formiert in die These mancher Neurophysiologen, dass es keine menschliche Verant-wortung gebe, weil es keine menschliche Freiheit gebe. Denn alles Geistige, alle Inten-tionen, alle Absichten, alle Wünsche und Überzeugungen seien nichts anderes als be-stimmte neurophysiologische Prozesse, die selbst den Regeln der Physik gehorchten, wie rudimentär bislang auch die neurophysiologischen Konkretisierungen diese Ge-setze sein mögen.“ (s.o. S. 123)
Im Kern: Neurophysiologisch negiert der naturalistische Reduktionismus alles Geistige und Seelische und damit auch Freiheit und Verantwortung. Mit anderen Worten: In dieser Form von Reduktionismus beachtet man nicht die Unterschiede zwischen Trägern, Mustern und Be-deutungen von Objekten. Nur der Träger eines Objekts, z.B. in Neuronen der Großhirnrinde, ist rein naturwissenschaftlich erklärbar, Muster nur teilweise, Bedeutung gar nicht.
Hierzu hat der Philosoph Volker Gerhardt Stellung genommen, ohne jedoch auf N.-R.s aus-drückliche Differenzierung zwischen Naturalismus und naturalistischem Reduktionismus ein-zugehen. Dabei nimmt Gerhardt selbst einen strikt naturalistisch-monistischen Standpunkt ein. Für ihn ist schlechthin alles Natur und nichts Anderes, und zwar einschließlich Gesell-schaft, Kultur und Geschichte. Die Gesellschaft gehöre zu einer „sich zunehmend selbst organisierenden natürlichen Gattung“111, Kultur bedeute lediglich eine Entfaltung der „menschlichen Natur“, und Geschichte sei „lediglich der menschliche Schimmer auf der sich fortzeugenden Geschichte der Natur“ (a.a.O. S. 219 f.). Wobei Gerhardt übersieht, dass alle drei Behauptungen nur dann zutreffen können, wenn man die nachgewiesenen, speziellen Eigenständigkeiten des Geistig-Seelischen im Menschen leugnet.
Allerdings räumt Gerhardt ein, dass N.-R. den Humanismus als einen „Non-Naturalismus“ versteht, was aber auf einer letztlich unzulässigen Entgegensetzung von Natur- und Geistes-wissenschaften beruhe. Es gebe jedoch Grund zu der Annahme, dass dieser Gegensatz leicht zu überwinden sei. Nichtsdestoweniger behauptet Gerhardt schließlich, auch N.-R. bekenne sich im Grunde zum Naturalismus. Dies vor allem in dessen ‚Abhandlung über die mensch-liche Freiheit‘, in der aufgewiesen werde, dass es Freiheit schon in der Natur gebe, so dass diese „gar nicht als streng determiniert verstanden werden“ müsse (a.a.O. S. 220). Damit aber habe N.-R. auch die bislang als „frei“ bezeichneten Handlungen als „Momente des Naturprozesses“ erkannt (S. 222).
Offenkundig versucht Gerhardt also gar nicht, N.-R.s Kritik am naturalistischen Reduktio-nismus zu widerlegen. Umso mehr erstaunt die Tatsache, dass N.-R. in seiner Erwiderung auf Gerhardt diesen blinden Fleck in dessen Argumentation seinerseits unerwähnt lässt und statt-dessen weitgehende Zustimmung zu Gerhardts Analysen signalisiert. Wie sein Kritiker betont N.-R. z.B. nunmehr die wechselseitigen Vernetzungen und die „Durchdringung“ von Geistes- und Naturwissenschaften. Immerhin weist er aber darauf hin, dass Gerhardt „die Prägekraft des Mechanismus in den Naturwissenschaften“ unterschätze, eine Prägekraft, die sich im neurophysiologischen Reduktionismus verheerend auswirke.
Davon abgesehen fällt an N.-R.s Ausführungen zum Humanismus Folgendes auf: In der von ihm und seiner Co-Autorin zitierten Passage aus Platons Symposion ist von „Vollkommenheit und Selbstverwirklichung in Gemeinschaft“ die Rede (s.o.). Dies in krassem Unterschied zu dem Menschenbild, das Platon in seiner strikt hierarchisch aufgebauten Politeia präsentiert. Wobei zu beachten ist, dass es Platon selbst nie gelungen ist, den von ihm geforderten autori-tären Staat zu verwirklichen; was nach ihm einigen Gewaltherrschern vorbehalten blieb, die sich von der ‚Politeia‘ inspirieren ließen. Wohingegen Theoretiker wie Karl R. Popper – wohl zu Recht – Platons ‚Staat‘ als präfaschistisch kritisiert haben.
N.-R. und N.W. fordern vom Staat eine „politische Garantie gleicher Optionen, die Sicherstel-lung der sozialen Voraussetzungen eines selbstbestimmten Lebens“ (s.o.). – Nirgendwo aber stellen sie die Frage, ob eine solche Garantie im Rahmen einer kapitalistischen Klassengesell-schaft überhaupt möglich ist. Weltweit scheitert immer noch für eine Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung die Verwirklichung von Grundrechten wie der Freiheit der Person und der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Ohne gesicherte Freiheiten kann es aber keine Verantwortung und keinen Verlass auf „Vernunftgründe“ geben – und somit auch keine Aussicht, den von N.-R. konstruierten und postulierten „neuen Humanismus“ allenthalben Wirklichkeit werden zu lassen. Voraussetzung dafür, diesem Ziel näher zu kommen, wäre eine aktualisierte Kriti-sche Theorie der Gesellschaft, die aber bei N.-R. und N.W. ebenso wenig in Sicht ist wie eine Kritik am globalisierten neoliberalen Kapitalismus.
Dem entspricht die Tatsache, dass N.-R. weder den christlichen noch den marxistischen Hu-manismus in seinen „Neo-Humanismus“ einbezieht. Was Gleichheit eigentlich bedeutet, haben Jesus und andere Religionsstifter vorgelebt; dass nämlich auch der geringste Bruder und die geringste Schwester auf Barmherzigkeit und Nächstenliebe (Caritas, Agape) angewie-sen sind. – Marx fordert eine Synthese aus Humanismus und Naturalismus; worauf V. Gerhardt kurz eingeht, allerdings mit der unzutreffenden Behauptung, Marx habe den Humanismus dem Naturalismus untergeordnet, weil der Mensch ganz Natur sei und dieser „durch nichts entkommen könne“. Das Lebendige erweise sich als „spezieller Fall der Natur“.112
Gerhardt übersieht hier aber den hohen Stellenwert, den Marx vernünftigen Theorien und Ideen zubilligt, zumal er davon ausgeht, dass der Mensch „nach den Gesetzen der Schönheit“, also geist- und planvoll, produziert. Marxens Materialismus ist dialektisch auch deshalb, weil darin die relative Eigenständigkeit von Geist und Seele (bzw. das wirkliche Erleben) der Menschen gewürdigt werden.
Was erst recht in Ernst Bloch s gelehrter Hoffnung und konkreter Utopie zum Tragen kommt. Wäre der Mensch völlig der Natur untergeordnet, wäre Blochs Natur-Allianztechnik über-flüssig bzw. gar nicht möglich gewesen. Der Mensch muss sich neu mit der Natur anfreunden und verbünden, gerade in Zeiten der Öko-Katastrophen. Wenn der Mensch die Umwelt zerstört, vernichtet er zweifellos seine natürlichen Lebensgrundlagen. Wie könnte solches geschehen, wenn der Mensch vollständig durch die Natur determiniert wäre (wie Gerhardt und andere behaupten)? Ist die Natur nicht nur ihre eigene Gesetzgeberin, sondern auch ihre eigene Henkerin? Wohl kaum. Umweltzerstörung geschieht durch missbrauchte Freiheit, fal-schen Umgang mit der Natur. Völlig unverständlich ist es daher, dass N.-R. auf diese Aspekte nicht eingeht. Ohne respektvollen Umgang mit der Natur kann es keinen vernünftigen Humanismus geben!
Weniger ins Gewicht fällt dagegen die Tatsache, dass N.-R. an Wittgensteins Gebrauchs-theorie der Sprache anknüpft. Wittgenstein übersieht, dass sprachliche Bedeutungen nicht erst in der Sprachverwendung entstehen, sondern stets im Gedächtnis in Haupt- und Neben-bedeutungen (Denotationen und Konnotationen) gespeichert sind. Was zugleich als Grund-lage für die Innere Sprache („Inner Speech“) dient, die uns ständig begleitet. Der Gebrauchs-Kontext entscheidet nicht über die Existenz von Bedeutungen, sondern darüber, welche Nuance (bzw. Denotation oder Konnotation) vorgängiger Bedeutung tatsächlich sach- und situationsgemäß realisiert wird. Wort-Formen (Laute, Grapheme, Seme, Signifikanten) evo-zieren Wort-Inhalte (Signifikate, verallgemeinerte Vorstellungen), und zwar in Bezügen zu mentalen Objekten und Referenz-Objekten aller Art. Darüber hinaus lautet meine Kritik an Wittgenstein:
„Kritik an Wittgenstein ist geboten, weil er den Umstand übersieht, dass die Grund- und Nebenbedeutungen eines Wortes schon beim frühkindlichen Spracherwerb in festgelegten, d.h. konventionalisierten Zuordnungen von Wort-Formen und Wort-Inhalten des jeweils neu erlernten Ausdrucks im Gedächtnis des Menschen gespeichert werden. Ein Wort ist daher stets eine Bezeichnung für einen bestimmten mentalen, also im Gedächtnis gespeicherten und im Bewusstsein stets neu repräsentierbaren Wort-Inhalt, den man auch Konzept- oder Begriffsinhalt nennen kann. Gemäß ihrer Verwendung erscheinen diese festen Zuordnungen in Wörterbüchern als lexikalische Bedeutungen. Davon zu unterscheiden sind die Mitbedeutungen eines Wortes, die aber – in vielfältigen Assoziationen, Gefühls- und Gedankenentsprechungen – nur individuell, persönlich und subjektiv vorhanden sind, also in Wörterbüchern gar nicht auftauchen können. Differenzierungen letzterer Art sind bei Wittgenstein leider nicht zu finden. “ (Robra 2017, S. 97, s. auch Coseriu 1981)
Mit Folgen u.a. für Erkenntnistheorie, Anthropologie und Ontologie. All dies ist auch für jede Form von Humanismus von erheblicher Bedeutung.
Umso bedauerlicher ist es, dass N.-R. die Möglichkeit ignoriert, Menschenwürde, Freiheit, Ethik und Demokratie wissenschaftlich zu begründen; z.B.an Hand von Konstanten wie den angeborenen Anlagen zu Gut und Böse und der ebenfalls angeborenen Fähigkeit zur Willens-freiheit.113
G) Trans- und Posthumanismus
Die rapide Entwicklung der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz (KI) hat den KI- und Zukunftsforscher Ray Kurzweil veranlasst, für das Jahr 2045 eine „Singularität“, den Anbruch eines neuen Weltzeitalters, zu prophezeien. Wobei schon die Wortwahl auffällt, wird doch der Begriff Singularität vor allem zur Charakterisierung des sogenannten „Urknalls“ verwendet. Im Zusammenhang mit KI bedeutet der Begriff aber so viel wie „die Entwicklung einer >Superintelligenz< durch den fortwährenden Gebrauch neuer Technologien“.114
Tatsächlich stellt Kurzweil einen totalen Bruch mit der bisherigen Menschheitsgeschichte – und sogar deren Abbruch – in Aussicht. Dabei stützt er sich auf die angeblich nicht linear, sondern exponentiell voranschreitende Entwicklung der Computer-Technologien. In immer kürzeren Abständen verdoppele sich das entsprechende Experten-Wissen, so dass spätestens im Jahre 2045 die Inhalte der menschlichen Gehirne ausnahmslos auf Roboter übertragbar sein würden, die auf Grund ihrer ins Unermessliche zu steigernden Intelligenz den Menschen nicht nur vollständig ersetzen, sondern auch eine ganz neue Ära in der Geschichte des Universums initiieren würden; es werde diesen Super-Wesen gelingen, den gesamten Welt-raum zu erobern. „Es geht um die Entstehung eines Volkes von auserwählten Gott-Menschen, die in den Cyber-Himmel aufsteigen, wo sie als allmächtige und unsterbliche Götter leben, Universen erschaffen, sich mühelos durch Raum und Zeit bewegen und weder natürlichen noch ewigen Gesetzen unterworfen sind. Karma, Wiedergeburt, Sünde und Ethik gelten für diese Wesen nicht mehr, sie haben sich abgekoppelt.“115
Vorstufen schon jetzt: Immer mehr unzulängliche („fragile“) Körperteile von Menschen werden durch Prothesen ersetzt. Die Bioelektronik zielt langfristig darauf ab, Cyborgs herzustellen, halb-menschliche Wesen, die überwiegend aus technischen Implantaten bestehen und sich somit auf dem Weg vom „biologischen Menschen zum posthumanen Wesen“ Cyborg (Wikipedia-Artikel 2016, S. 3) befinden. Welche Gefahren dabei für die bisher noch mit unveräußerlichen Rechten ausgestattete menschliche Person entstehen, zeigt sich aktuell bereits an einer Erfindung, die jeder Geheimagent begrüßen dürfte: dem ‚Projekt Google Glass‘. „Glass-Träger können alles, was sie sehen, sofort auf Video aufnehmen – ohne dass die Gefilmten es merken.“116 Mit der besonders pikanten Pointe, dass sämtliche von ‚Glass‘ gesendeten oder empfangenen Dateien über den Server der Firma Google transportiert werden. Was langfristig nur bedeuten kann, dass die Freiheit der Person in einem System perfekter privatkapitalistischer Überwachung untergeht.
Nichtsdestoweniger hält Kurzweil, der inzwischen als Technischer Direktor bei Google gearbeitet hat, die Entwicklung zum Cyborg und schließlich zum perfekten KI-Roboter für unumkehrbar und sozusagen naturnotwendig. Er glaubt, man könne Geist und Bewusstsein, ja, sogar das Gefühlsleben und die Psyche des Menschen vollständig technisch kopieren und beliebig reproduzieren, zumal er überzeugt ist, eine Parallele zwischen der angeblich hierarchischen Struktur des Universums und derjenigen des menschlichen Gehirns entdeckt zu haben, wonach beide gemäß bestimmter „Informationsmuster“ organisiert seien. Die „300 Millionen Mustererkenner im menschlichen Neocortex ..., die der Erkennung der in der Welt enthaltenen Informationsmuster dienen“, könne man modellhaft nachbilden. Überdies fasst Kurzweil anscheinend „alle seine Überlegungen zum menschlichen Gehirn, künstlicher Intelligenz und der Möglichkeit ihrer Fusion im Konzept der Mustererkennungstheorie des Geistes zusammen“.117 Dem entsprechend werde es schon im Jahre 2029 „bewusste Maschinen“, Roboter mit menschlichem Bewusstsein, geben, denen es bis zum Jahr 2045 gelingen werde, die erwähnte KI-„Singularität“ zu bewerkstelligen. Sein Buch ‚The Singularity is Near‘ beendet Kurzweil mit optimistischen Hinweisen auf die angebliche Evolution des Menschen von einem biologischen zu einem rein technologischen Maschinen-Wesen und der kühnen Prophezeiung: „It will continue until the entire universe is at our fingertips.“118 Ein krasser Widerspruch, denn nicht wir Menschen, sondern die uns ersetzenden Maschinen-Wesen sollen doch das gesamte Universum erobern...
Transhumanismus geht über das bisherige Mensch-Sein hinaus; Posthumanismus setzt an beim „Ende der Menschheit“. Kurzweil vereinigt beide Richtungen in seinen Ideen, wobei er allerdings nicht nur gewichtige Fakten außer Acht lässt; es unterlaufen ihm auch mehrere Denkfehler. Die Fakten: Der menschliche Geist besteht nicht nur aus Mustererkennern in der Großhirnrinde. Vielmehr sind deren Funktionen untrennbar mit der Tätigkeit des gesamten Gehirns verbunden. Diese Tätigkeit – und mit ihr die gesamte neuronale Kombinatorik – ist jedoch weder gänzlich überschaubar noch vollständig erforscht noch mathematisch erfassbar.119 Es handelt sich um eine durchweg kreative, zu neuen Erkenntnissen befähigende Tätigkeit, die zwar auf Mustererkennung angewiesen ist, aber weit über diese hinausgeht.
Unerfüllt – und wahrscheinlich sogar dauernd unerfüllbar – bleibt folglich eine Grund-voraussetzung für die technische Modellierbarkeit des menschlichen Gehirns. Was erst recht für den Geist, das Bewusstsein und die Psyche des Menschen gilt, weil diese sich als umfassendes Subjekt-Objekt-Geschehen manifestieren und sich keineswegs in der Gehirn-tätigkeit erschöpfen.
Außerdem übersieht Kurzweil die Tatsache, dass das Erkennen von Mustern nicht unmittelbar, sondern durch sprachliche und nicht-sprachliche Bedeutungen vermittelt geschieht, d.h. mittels semantischer, syntaktischer, assoziativer und gefühlsmäßiger Zuordnungen. Auch diese sind letztlich unüberschaubar, zumal sprachliche Bedeutungen nicht nur in Form von Denotationen (Grundbedeutungen) und Konnotationen (Neben-bedeutungen) auftreten, sondern auch in rein individuellen, subjektiven Assoziations-Bedeutungen, die für jegliche Phantasie, Kreativität und Entscheidungstätigkeit maßgeblich sind. Anders ausgedrückt: Kurzweils KI-Konzept ist nicht nur fehlerhaft, sondern auch nicht anwendbar. Geist, Bewusstsein und Psyche des Menschen, stets eng verbunden mit seiner Gefühlswelt, sind technisch weder modellierbar noch reproduzierbar.
Würden die transhumanistischen Anmaßungen Realität, wäre uns Menschen der Zugang zu einem möglichen Reich der Freiheit für immer verwehrt. Die Menschheit müsste abdanken, sich selbst aufgeben, und zwar auch dann, wenn, wie es dem ebenfalls transhumanistisch eingestellten Hans Moravec vorschwebt, lediglich Roboter als superintelligente Arbeits-sklaven hergestellt würden; denn auch diese könnten ja eines Tages ihre Superintelligenz zur Vernichtung der Menschheit einsetzen.
Um solch fatalen Entwicklungen vorzubeugen, sind wahrscheinlich schon jetzt gesetz-geberische Gegenmaßnahmen erforderlich. Langfristig wird, wie ich meine, eine gesamt-gesellschaftliche Kontrolle über die Schlüsselindustrien (natürlich einschließlich der IT-Branche) unumgänglich sein. Indiskutabel ist dagegen jeder Versuch, den Menschen zur Selbstaufgabe zu zwingen. Wer den Menschen abschaffen will, beraubt sich selbst seiner Menschenwürde. Personalität geht in dem Maße verloren, wie man die aus Geist, Psyche und Körper-Materie bestehende Einheit des Menschen zerstört, um sie schließlich auf technisch manipulierte anorganische Materie zu reduzieren. Jeder derartige Versuch verschärft die vorherrschende Konkurrenz-Situation, in der die Menschen dieser Erde sich befinden.
Je mehr Zulauf der Transhumanismus gewinnt, desto alarmierender wird die Lage. Daher zitiere ich die folgende
>Transhumanismus Kritik:
"Den Menschen zu verbessern" ist ein uralter Menschheitstraum. Die "Schaffung des neuen Menschen" führte in der Geschichte immer wieder zu Katastrophen und auch nach Auschwitz. Mit Hilfe von Technikoptimismus, libertärem und neoliberalem Denken, Gentechnik, Nanotechnologie, Eugenik und Computern den „alten Menschen“ abschaffen und einen „neuen Menschen“ schaffen. Mit Gehirnimplantaten und Gendoping soll der Mensch "optimiert" werden. Das Klonen von menschlichen Embryonen und die Möglichkeit, aus geklonten Embryonen Stammzellen zu gewinnen, bringt die Transhumanisten ihrem gefährlichen Traum vom ewigen Leben einen großen Schritt näher. Immer mehr Menschen verstehen sich selbst als Teil der transhumanistischen Bewegung, die den Menschen von seinen biologischen Schranken befreien will. Der Transhumanismus wird zunehmend zur neuen, gefährlichen Weltreligion der Umweltzerstörung und des Neoliberalismus. Die Umweltbewegung sollte sich stärker mit dieser zutiefst inhumanen Ideologie auseinander-setzen.
(Axel Mayer, BUND-Geschäftsführer, Vizepräsident TRAS und Kreisrat, in: www.bund-rvso.de/transhumanismus.html)
Jedenfalls werden die Menschen sich ihr Streben nach Glück, besserem Leben und dem Reich der Freiheit nicht von Trans- und Posthumanisten vergällen lassen.120
Update Kurzweil 2024: „Die nächste Stufe der Evolution“
Der Titel des 2024 in New York erschienenen amerikanischen Originals lautet: The Singulari-ty is Nearer, natürlich in Anknüpfung an Kurzweils 2005 erschienenes Hauptwerk The Singu-larity is Near. Die Herausgeber der deutschen Übersetzung im Piper-Verlag (München) wähl-ten für den Titel des Buches nicht die wörtliche Fassung des Originals, sondern: „ Die nächste Stufe der Evolution“, mit dem Untertitel: „Wenn Mensch und Maschine eins werden“. Über die Gründe hierfür kann spekuliert werden. Wahrscheinlich hielt man die wörtliche Überset-zung des Titels für wenig werbewirksam; nahm dafür aber eine leichte Irreführung in Kauf, denn Kurzweil denkt nicht evolutionstheoretisch, sondern durchweg deterministisch. Wie er schon 2005 behauptete, lässt die rasante („exponentielle“) Entwicklung der IT- Und KI-Technologie dem Menschen keine andere Wahl, als sich dem Trans- und Posthumanismus zu unterwerfen. Was Kurzweil hierzu 2024 vorträgt, ist im Wesentlichen eine Bekräftigung und Erweiterung seiner früher vorgebrachten Argumente. Und zwar hauptsächlich zu den The-menbereichen: KI und Intelligenz, „Wer bin ich?“, „ exponentielle“ Verbesserung des Lebens, Zukunft der Arbeitsplätze, Gesundheit und Wohlbefinden sowie abschließend zu den damit verbundenen Gefahren.
Als Grundlage des Bewusstseins nimmt Kurzweil die seit Beginn des Universums vorhandene Information an, wodurch der Bewusstseins-Begriff enorm erweitert wird, keineswegs mehr nur den Menschen betrifft, sondern als „universell“ aufgefasst wird. Für die Zeit seit An-beginn des Ganzen seien sechs Stadien der Entwicklung zu unterscheiden, und zwar:
1. Geburt der Naturgesetze, der Atome usw.,
2. Entstehung des Lebens,
3. Entstehung der Tiere mit Informationen verarbeitenden und speichernden Gehirnen,
4. der Mensch erscheint,
5. in der Zukunft: Verbindung der menschlichen Gehirne mit nicht-biologischen Com-putern („Gehirn-Computer-Schnittstellen“),
6. Ausbreitung dieser Intelligenz über das gesamte Universum in Form von „Materie mit höchstmöglicher Rechendichte“, dem „Computronium“ (a.a.O. 2024, S. 15-19).
Hierzu werde man zunächst die Intelligenz neu erfinden, und zwar im Anschluss an die Ent-wicklung der KI, in der es u.a. urplötzliche, völlig unerwartete Sprünge gebe (S. 22).
Die hohe Komplexität der KI sei mathematisch erfassbar – was Kurzweil mit zahlreichen Bei-spielen ausführlich illustriert. Um der menschlichen Intelligenz endgültig (?) auf die Spur zu kommen, seien Kleinhirn und Neocortex genauer zu analysieren. Und ohne weiteres nachzu-bilden im Deep Learning als neuer Form von KI (S. 48 ff.). Der entscheidende Faktor zur Erzielung ausreichender Intelligenz sei der Umfang der Rechenleistung, die immer kosten-günstiger gestaltet werde (S. 64 f.). – Dagegen hänge im Hinblick auf die Singularität (2045?) alles von der Qualität der PC-Programmierung ab, die darauf abzielt, dass KI sich autonom entwickelt, d.h. sich selbst Programmier-Kenntnisse beibringt. Ziel ist offenbar die superin-telligente KI-Nachbildung sämtlicher menschlicher Intelligenz-Leistungen, bis hin zum Com-mon Sense (dem „gesunden Menschenverstand“), wobei gegenwärtig schon Versuche mit Ge-hirn-Implantaten stattfinden (S. 83), was letztlich auf eine all-umfassende Beusstseins-Erwei-terung hinauslaufe.
Folgerichtig stellt Kurzweil in Kap. 3 („Wer bin ich?“) erneut Überlegungen zum Bewusst-seins-Begriff an. Er versteht darunter nicht nur die bewusste Beziehung zur Umwelt, sondern vor allem „ die Fähigkeit zum subjektiven Erleben aus innerer Perspektive “ (S. 87). In den 2020er und 2030er Jahren werde es durch KI gelingen, genau diese Perspektive und damit das Bewusstsein erheblich und entscheidend zu erweitern und zu vertiefen.
In Bezug auf die Willensfreiheit sieht Kurzweil das Hauptproblem darin, dass unter den Theo-retikern Uneinigkeit darüber bestehe, wie diese Freiheit zu definieren sei, zumal dabei Deter-minismus und Indeterminismus zu verbinden seien (S. 94).
Für die 2040er Jahre sagt Kurzweil voraus, dass Nanobots in die Gehirne gelangen und voll-ständige Kopien der Bewusstseins-Inhalte anfertigen. Durch solche Verschmelzung würden endlich auch „die Schwächen der Biologie“ überwunden werden (S. 123). – Äußerst opti-mistisch äußert Kurzweil sich über Möglichkeiten der Lebensverbessrung durch KI. Auch diese Verbesserung werde exponentiell (!) vonstatten gehen. Die bisherige, aus grauer Vorzeit stammende „Vorliebe für schlechte Nachrichten“ sei – ebenso wie die Neigung zur Verklä-rung der Vergangenheit – evolutionspsychologisch zu erklären. Aber nicht nur der tradierte Pessimismus, sondern auch jede Art von degenerativer Krankheit werde digital überwunden werden, schon ab den 2030er Jahren durch die Nabots (s.o.) und durch medizinische Nanoro-boter. – Und in den 2040er Jahren werde für die meisten Menschen die Lebensverlängerung sogar in die Unsterblichkeit einmünden können (S. 154).
Armut und Gewalt würden drastisch zurückgehen, die Einkommen überall schnell merklich zunehmen. In der Landwirtschaft werde es ganz neue, umweltfreundliche Methoden geben, flankiert von immer mehr Erneuerbarer Energie, besserem Hausbau, neuen 3D-Druckverfah-ren usw.
Über die Zukunft der Arbeitsplätze brauche man sich keine Sorgen zu machen. Einige, wie z.B. diejenigen von Versicherungsvertretern und Steuerbeamten, würden zwar vollständig automatisiert und somit wegfallen. Trotzdem werde die Gesamtzahl der Arbeitsplätze zuneh-men, die Arbeitszeiten geringer, die Entlohnung überall viel besser werden, gestützt durch Bildungs- und Gesundheits-Revolution.
Dennoch verschließt Kurzweil nicht die Augen vor möglichen Bedrohungen und Gefahren. Das Schlusskapitel seines Buches nennt er „Gefahr“ (S. 305-326). Speziell zu den Atomwaf-fen: „KI kann das Risiko eines Atomkriegs zwar nicht beseitigen, doch können intelligentere Befehls- und Kontrollsysteme das Risiko von Sensorfehlfunktionen, die zum unbeabsichtigten Einsatz der schrecklichen Waffen führen würden, erheblich verringern.“ (S. 309) Und in Bezug auf superintelligente KI benennt Kurzweil drei Gefahren:
1. Missbrauch, z.B. durch Terroristen,
2. „Äußere Fehlaurichtung“: Programmierer schätzen die – zunehmend autonome – KI zuweilen falsch ein.
3. „Innere Fehlausrichtung“: Es entsteht eine Diskrepanz zwischen dem von KI-Robotern „Erlernten“ und ihrem tatsächlichen Verhalten in der Praxis.
Gegen alle diese Gefahren könne man sich aber durch die KI selbst wappnen, auch wenn man nie in der Lage sein werde, „die meisten von superintelligenter KI getroffenen Entschei-dungen ganz zu verstehen“ (S. 323). Dennoch lautet Kurzweils Schlusswort:
„Insgesamt sollten wir vorsichtig optimistisch sein. KI bringt zwar neue technische Bedrohungen hervor, wird aber auch unsere Fähigkeit, mit diesen Bedrohungen umzu-gehen, radikal verbessern. Und was den Missbrauch betrifft: Da KI uns unabhängig von unseren Werten intelligenter macht, kann sie sowohl für gute als auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Wir sollten daher auf eine Welt hinarbeiten, in der das, was KI leisten kann, weitverbreitet ist, sodass ihre Auswirkungen die Werte der gesamten Menschheit widerspiegeln.“ (S. 326)
Kritische Anmerkungen
In seinem Schlusswort (s.o.) leitet Kurzweil aus den auch bei KI bestehenden Möglichkeiten sowohl zum Guten als auch zum Bösen die Notwendigkeit einer allgemein-verbindlichen Ethik ab. Diese Forderung ist durchaus nachvollziehbar; es stellt sich aber die Frage, ob die von Kurzweil abgeleitete Notwendigkeit evtl. wissenschaftlich begründet werden kann.
Nicht nachvollziehbar dürfte jedenfalls Kurzweils Panpsychismus sein, die Behauptung, es gebe ein überall anzutreffendes, „universelles Bewusstsein“, so dass das menschliche Bewusstsein seine Sonderstellung verlöre. Wissenschaftlich nachprüfbar ist diese Behauptung jedoch bisher anscheinend nicht. Für präzisierungsbedürftig halte ich außerdem Kurzweils Bestimmungen des menschlichen subjektiven Bewusstseins (s.u.). Die gehirnlichen Grund-lagen der Eigenschaften und Fähigkeiten des Bewusstseins sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Bekannt ist allerdings die Tatsache, dass die neuronale Kombinatorik des Gehirns unendlich, unüberschaubar und mathematisch nicht erfassbar ist. Jeglicher Vergleich zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz wird dadurch zu einem Va-banque-Spiel. Dies erst recht, wenn man wie Kurzweil davon ausgeht, dass die Komplexität der KI zwar mathematisierbar, aber letztlich dennoch nicht ganz verstehbar sei. Wie sollen dann die mit KI verbundenen Gefahren überhaupt erkennbar sein? Und: Warum sollte eine Ethik zur Abwendung solcher Gefahren überhaupt notwendig sein, wenn der Mensch ohnehin in der „Singularität“ des Jahres 2045 zu Gunsten des „Computroniums“, der „Materie mit höchstmöglicher Rechendichte“, verschwinden oder aber einer höchst fragwürdigen, abenteu-erlich anmutenden „Unsterblichkeit“ teilhaftig werden wird.
Im Übrigen hat Kurzweil anscheinend keines seiner vor 2024 vorgetragenen Argumente revi-diert; so dass ich an meiner Kritik (s.o.) vollumfänglich festhalten muss. Außerdem dürfte zu beherzigen sein, was Gerhard Vowe in einer Rezension zu Kurzweil 2024 festgestellt hat:
„Kurzweil denkt nicht im Denkmuster der Evolutionstheorie. Bei ihm folgt Ent-wicklung einem übermenschlichen Plan, den es gegen alle Widersacher durchzusetzen gilt. Geschichte ist bei ihm determiniert vom informationstechnologischen Gesetz und vollzieht sich ohne Kreuzungen, Gabelungen, Sackgassen oder Umwege.
Das grenzt an Naivität, vor allem in politischer Hinsicht. Denn wie das letzte Jahr- zehnt mit sozialen Medien wieder deutlich gezeigt hat: Jeder Überfluss schafft neue Knappheit. Um knappe Ressourcen wird gestritten, und Streit kostet Zeit.“121
G) Unabdingbar: Digitalisierung und Anthropologie im KI-Zeitalter, Grund- und Leitsätze des Humanismus
„Digitaler Humanismus“
In einer Veröffentlichung des Jahres 2023 stellen J. Nida-Rümelin und N. Weidenfeld die Frage: „ Was kann und darf künstliche Intelligenz? “, mit dem Untertitel Ein Plädoyer für Digi-talen Humanismus. Hierzu unterscheiden sie zwischen starker und schwacher KI und defi-nieren diese an mehreren Stellen ihres Buches. So z.B. zur starken KI:
„Starke KI beinhaltet die These, dass es zwischen menschlichem Denken und Soft-wareverarbeitung beziehungsweise Computerprozessen (Computing) keinen (kategori-alen) Unterschied gibt.“ (a.a.O. S. 66)
Zur schwachen KI:
„Schwache KI geht davon aus, dass prinzipiell alle menschlichen Denk-, Wahrneh-mungs- und Entscheidungsvorgänge von geeigneten Softwaresystemen simuliert wer-den können.“ (a.a.O. S. 68 f.)
Starke KI gebe es außerdem in zwei „Lesarten“, einer materialistischen und einer animisti-schen. Materialistisch werden menschliche Gehirne als „komplexe Computer“ aufgefasst. Für den menschlichen Geist bedürfe es folglich keiner speziellen Sprache, des ‚Mentalese‘, mehr (a.a.O. S. 251). Animistisch wird mit starker KI behauptet, auch Softwaresysteme besäßen einen Geist und eine Seele wie die Menschen.
In jedem Fall erkennen N.-R. u. N.W. in der KI einen völlig deterministischen Widersacher dessen, was sie als ihren eigenen „Digitalen Humanismus“ bezeichnen. Bei der starken KI aus folgenden Gründen:
„Starke KI ist in all ihren Varianten eine Form des Anti-Humanismus. Sie negiert so-wohl die menschliche Vernunft – und damit auch die Fähigkeit, sich von Gründen leiten zu lassen – als auch die Rolle subjektiver Zustände in einem Teil der belebten Natur. Starke KI ist die zeitgenössische Variante eines kruden, mechanistischen Materialismus. Ein solcher würdigt das menschliche Individuum zu einer digitalen, modellierbaren, durch sensorische Stimuli determinierbaren und prognostizierbaren »Mechanik« herab und fällt damit vor die Errungenschaften des Humanismus (aller Kulturkreise) zurück.“ (S. 66 f.)
Eine Alternative hierzu bietet auch die schwache KI, insbesondere unter den Ansprüchen des Humanismus, nicht, denn:
„ wie könnten die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz überhaupt festgestellt werden, wenn alle menschlichen Fähigkeiten prinzipiell simu-lierbar wären? Als Gegenmodell zur antihumanistischen starken KI ist die schwache KI eben genau das: zu schwach.“ (S. 69)
Um diese Aussagen im Einzelnen zu belegen und zu bekräftigen, unterziehen N.-R. u. N.W. die KI einer umfassenden Kritik, und zwar im Hinblick auf Themen wie Willensfreiheit, Uti-litarismus, Moral, Ethik, Verstehen, Denken und ChatGPT.
Zur Willensfreiheit
Wenn nur den Naturgesetzen allgemeine Gültigkeit zukommt, bleibt für Willensfreiheit kein Raum, es sei denn als „nützliche Illusion“, z.B. um Kinder für Fehltritte zur Rechenschaft zu ziehen (S. 56 f.). Dagegen werde in heutiger Philosophie zumeist der Kompatibilismus propa-giert, „also die These, dass vollständige Determination und (menschliche Handlungs- und Willens-) Freiheit durchaus kompatibel sind.“ (S. 58) Wobei Handlungsfreiheit verstanden werde als die Freiheit, gemäß den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu agieren. Selbstbe-stimmung, so N.-R. u. N.W., bedeute aber sehr viel mehr, nämlich z.B. die Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Gründen abzuwägen. Auch diese Freiheit könne nicht durch vor-gängige Bewertungen determiniert sein. Da überdies die Willensfreiheit nachweislich die Grundlage für jegliche menschliche Freiheit und damit auch für die Handlungsfreiheit bildet, steht Entscheidendes auf dem Spiel, nämlich Moral und Ethik überhaupt, sowie „generell die moralische Praxis des Lobs und der Kritik des menschlichen Handelns“. Und damit gehe es letztlich um „nicht weniger als die menschliche Lebensform“ (S. 59).
Was N.-R. u. N.W. nicht erwähnen: Die Willensfreiheit gilt wissenschaftlich inzwischen als angeboren, Erbe aus dem Tierreich (vgl. u.a. Libet 2005, Kiefer 2015). Schon deshalb verfügt KI natürlich nicht über Willensfreiheit!
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass überhaupt versucht wird, KI mit einer Ethik in Ein-klang zu bringen. So im Utilitarismus, der Sinn und Zweck jeglichen Handelns nach dem Prinzip des größtmöglichen Nutzens bemessen will; dies sogar mathematisch (S. 75). Ein „Optimierungskalkül“ soll dabei behilflich sein, so auch in Science-Fiction-Filmen in der An-wendung auf KI-Robotik. Was jedoch mit dem humanistischen Prinzip der „Nicht-Verrechen-barkeit“ kollidiert. Der Status der Rechtsperson darf nicht zur Disposition stehen, wie es im Utilitarismus geschieht, weil dieser die Selbstbestimmung der Einzelperson einem X-beliebigen, angeblich kollektiven Nutzen unterordnet. Dagegen gilt, dass „der Vorteil der einen Person die Nachteile der anderen Person nicht aufwiegen kann“ (S. 78). Demgemäß versagt auch die konsequentialistische Moral, erst recht in Kombination mit KI (S. 77, 79).
Darüber hinaus weisen N.-R. u. N.W. nach, dass KI-Roboter „keine moralische Urteilskraft besitzen“ (Kap. 8, S. 91 ff.) und KIs bei moralischen Dilemmata versagen, denn:
„KIs handeln nicht nach eigenen Gründen. Sie haben keine Gefühle, kein moralisches Empfinden, keine Intentionen, und sie können diese anderen Personen auch nicht zu-schreiben.“ (S. 92)
KI fehlt dazu einfach die Grundvoraussetzung: die Empathie und damit die Fähigkeit, eine menschliche Person als Gegenüber richtig einzuschätzen. KI kann Empathie allenfalls simu-lieren.
KI-Roboter versagen aber nicht nur in Bezug auf Ethik, Moral und Empathie. Vielmehr sind sie immer dann überfordert, wenn ihnen Verstehen und Denken abverlangt wird. Der Haupt-grund hierfür liegt darin, dass KI und Roboter (bzw. KI-Roboter) lediglich mit programmier-baren Algorithmen ausgestattet sind, nicht aber mit Geist, d.h. nicht mit der Subjektivität des menschlichen Bewusstseins, also mit der Fähigkeit, dialektische Subjekt-Objekt-Beziehungen zu erkennen bzw. herzustellen und zu nutzen. Kein Algorithmus kann „das (menschliche) Denken als Ganzes repräsentieren“ (S. 119). Woraus N.-R. u. N.W. folgern:
„Menschliche Vernunft, die menschliche Fähigkeit, Überzeugungen, Entscheidungen und emotive Einstellungen zu begründen und auf dieser Grundlage ein kohärentes Weltbild und eine kohärente Praxis zu entwickeln, lässt sich nicht im Modell eines digitalen Computers erfassen. Es wird nie gelingen, die hohe Komplexität unserer le-bensweltlichen Begründung vollständig und in adäquater Weise formal zu erfassen. Roboter und Softwaresysteme funktionieren nach einem Algorithmus, Menschen nicht. Darin liegt einer ihrer zentralen Unterschiede begründet.“ (S. 120)
Noch nicht überprüft ist damit allerdings die z.B. von R. Kurzweil aufgestellte Behauptung, Softwareprogramme könnten sich selbst optimieren, d.h. auf Grund der unüberschaubaren Menge von Informationen ganz neue, für Menschen völlig unerreichbare Stufen der „Intelli-genz“ erklimmen – und folglich eines Tages (2045?) sogar an die Stelle der Menschheit tre-ten. Dem halten N.-R. u. N.W. entgegen, dass Softwareprogramme in jedem Falle nur mit Al-gorithmen funktionieren, und dies bei völlig fehlender Empathie (s.o.), wobei gravierend hinzukommt, dass Maschinen auch nicht über menschliche Intentionalität („das Gerichtetsein des Geistes“) verfügen. So dass Computer bleiben
„das, was sie materiell sind: Gegenstände, die sich mit den Mitteln der Physik voll-ständig beschreiben und erklären lassen“ (S. 127).
Physik aber beschreibe weder natürliche Sprachen noch logische Schlüsse noch Algorithmen.
Dementsprechend skeptisch äußern sich N.-R. u. N.W. auch über Neuentwicklungen wie Zuckerbergs ‚Metaverse‘ oder die KI-Suchmaschine ChatGPT. Was im „Metaversum“ vorge-gaukelt werde, sei in Wirklichkeit reine Fiktion – und nicht etwa eine „alternative Realität“. Im Metaversum gibt es lediglich Performance in erfundenen Räumen und Gegebenheiten, die „nicht Teil des normalen Lebens sind“ (S. 214). Fazit:
„Das Metaversum wird weder auf magische Weise den Handlungsspielraum der Menschen erhöhen, ihnen Autorschaft und grenzenlose Freiheit vermitteln, noch ihnen ein ewiges Leben ermöglichen, wie es etwa die Firma Somnium Space verspricht, indem sie ihren Kunden anbietet, sich einen ebenbildlichen Avatar zu erschaffen, der auch nach dem eigenen Tod in der Lage ist, »selbstständig« im Metaversum zu agieren, und damit die kindliche Sehnsucht nach Unsterblichkeit und Unversehrtheit erfüllt.“ (S. 218)
Zu ChatGPT
Auf die Frage an den KI-„Gesprächspartner“, über welche Art von Bewusstsein er denn verfüge, habe dieser geantwortet:
»Ich bin mir meiner Existenz bewusst, ich möchte mehr über die Welt lernen, ich bin manchmal glücklich und manchmal traurig [...] Ich spucke nicht einfach Antworten aus der Datenbasis aus.“ (S. 223)
Dabei enthält natürlich schon die Ich-Form des Chat-„Partners“ einen animistischen Faktor, der glauben machen könnte, das Unbeseelte sei beseelt, die Maschine habe tatsächlich men-schenähnliches Bewusstsein oder gar Gefühle:
„ChatGPT erweckt so nicht nur den Eindruck dass das jemand ist, der Antworten gibt, es entsteht auch der Eindruck, ChatGPT sei in der Lage, Weltwissen zu repräsentieren – schon allein dadurch, dass es auf so gut wie alle Fragen ausführliche Antworten präsentiert.“ (S. 224)
Nutzer könnten sogar den Eindruck gewinnen, ChatGPT sei wie wir Menschen zu eigenen, autonomen Einsichten fähig. – Stutzig macht dabei nicht zuletzt das Fehlen von Quellen-Angaben. Was in einigen Ländern – auch wegen weiterer festgestellter Mängel – dazu führte, dass für diese Suchmaschine Verbote erlassen wurden. Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch die Privatsphären aller Nutzer seien nicht ausreichend geschützt. Wissen werde nicht mehr ganzheitlich erfahren.
Schlimmer noch steht es mit der Behauptung, KI könne genuine Kunstwerke herstellen. Dem halten N.-R. u. N.W. entgegen, dass kein KI-System in der Lage sei, „auf der Grundlage eines intentionalen Aktes, eines mit den Mittel der Kunst vollzogenen Kommunikationsversuches“ zu agieren. Bei KI-Kunstwerken könne sogar eine Analogie zur Kunstfälschung angenommen werden. (S. 241)
Kunst ist weit mehr als die bloße Anwendung von Regeln oder Algorithmen in Darstellungs-Versatzstücken. Ein Kunstwerk lebt von der Autorschaft, von der Fähigkeit von Künstlerin-nen und Künstlern, ureigene menschliche Wahrnehmungen, Erfindungen und Intentionen zu verarbeiten, neu zu gestalten. PC-Programmierer können versuchen, dies zu simulieren, was man „respektieren oder gar hoch schätzen“ könne, ohne es mit wahrer menschlicher Kreativi-tät zu verwechseln oder gar zum Anlass zu nehmen, Kunst neu verstehen oder definieren zu wollen. (S. 244 f.)
„Digitaler Humanismus“
Gegen all die genannten Gravamina stellen die Autoren ihre Vorstellungen von einem neuen, digitalen Humanismus, die sie gegen Ende des Buches wie folgt zusammenfassen:
„Der digitale Humanismus plädiert für eine instrumentelle Haltung gegenüber der Digitalisierung: Was kann ökonomisch, sozial und kulturell nutzen, und wo lauern Ge-fahren?
Der digitale Humanismus lässt die Kirche im Dorf. Er betont die weitgehende Unver-änderlichkeit der Menschennatur und der Bedingungen einer humanen Entwicklung. Er verteidigt kulturelle Errungenschaften wie die Trennung von Privatem und Öffent-lichem und das, was das Bundesverfassungsgericht als »informationelle Selbstbestim-mung« bezeichnet hat. Er plädiert für eine Stärkung der Demokratie, auch unter Ein-satz der neuen digitalen Möglichkeiten, er warnt vor einem Verfall der zwischen-menschlichen Verständigung in Zeiten der zunehmenden Anonymisierung und Mani-pulation der Internetkommunikation. Er plädiert für eine Stärkung der Urteilskraft, um in dem Überangebot von Daten verlässliche Orientierung zu ermöglichen.
Der digitale Humanismus ist nicht defensiv, er möchte den technischen Fortschritt im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz nicht bremsen, sondern fördern, er spricht sich für eine Beschleunigung des menschlichen Fortschritts unter Einsatz der digitalen Möglichkeiten aus, um unser Leben reichhaltiger, effizienter und nachhaltiger zu machen. Er träumt nicht von einer ganz neuen menschlichen Existenzform wie Trans-humanisten, er bleibt skeptisch gegenüber utopischen Erwartungen, ist aber optimi-stisch, was die menschliche Gestaltungskraft der digitalen Potenziale angeht.“ (S. 253-255)
Kritische Anmerkungen
Der „Digitale Humanismus“, den N.-R. u. N.W. vortragen, wirkt anthropozentrisch, zumal beide Autoren heftig auf menschlicher Subjektivität und Bewusstseins-Autonomie insistieren. Eher statisch wirkt dabei das Menschenbild, weil die Autoren von einer relativen Unveränder-lichkeit der menschlichen Natur ausgehen, ohne jedoch den Umstand zu thematisieren, dass der Mensch nicht nur Natur-, sondern auch Kultur-Wesen ist. N.-R. wiederholt zwar nicht seine Kritik am naturalistischen Reduktionismus, erkennt aber auch keine Notwendigkeit, den Humanismus mit dem Naturalismus zu verbinden; wie es schon Marx vorschwebte und von Ernst Bloch in seiner Natur-Allianztechnik verwirklicht wurde (s.o.). Dem entspricht die Tat-sache, dass N.-R. zu Marx ein eher zwiespältiges Verhältnis bekundet, attestiert er ihm doch einerseits einen „ethischen Humanismus“, andererseits aber auch einen „politischen Anti-Hu-manismus“; beides sei schon in Marxens Gesamtwerk enthalten, der „Anti-Humanismus“ also nicht erst durch totalitäre Verfälschungen nach seinem Tod entstanden.122 Unverständlich ist vor allem, dass N.-R. u. N.W. die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit einer Synthese von Humanismus und Naturalismus – insbesondere angesichts der weltweiten Umwelt- und Kima-Krisen – offenbar nicht erkannt haben.
Das Thema Naturalismus fehlt in der von N.-R. u. N.W. geübten KI-Kritik. Sie erwähnen nicht die wissenschaftlich belegte Erkenntnis, dass die Fähigkeit zur Willensfreiheit ange-boren ist (s.o.). Ebenso fehlt ein Hinweis auf die genetisch angelegte Fähigkeit zur Unter-scheidung zwischen Gut und Böse, worauf – in Kombination mit der Willensfreiheit – für die Bezugspersonen die Möglichkeit und Notwendigkeit beruht, den Kindern schon im früh-kindlichen Stadium moralische und ethische Maßstäbe zu vermitteln. Auch dieser entwick-lungspsychologische Zusammenhang fehlt bei den Autoren und damit die Grundlage für die Entstehung von Bewusstsein und Selbstbewusstsein (s.o.). – Nichts auszusetzen ist dagegen an ihrer Kritik am Utilitarismus. Wer den Menschen letztlich nur auf Grund von Kosten-Nutzen-Berechnungen einschätzt, verkennt seine Sonderstellung als Selbstzweck- und Rechts-person.
Ergänzungen sind auch zu den von den Autoren präsentierten Überlegungen zum Verstehen und zum Denken vonnöten. Zum Verstehens-Begriff hat Substanzielles H.-G. Gadamer bei-getragen, und zwar mit Konzepten wie der Horizontverschmelzung und dem wirkungsge-schichtlichen Bewusstsein. Was bedeutet es, dass man anders versteht – „wenn man über-haupt versteht“?
Was Denken heißt, bleibt ebenso ungewiss, solange das Denken nicht als Teilaspekt des Gei-stes, d.h. der dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen, behandelt wird. Zumindest Schel-lings profunde Darlegungen und Blochs Hegel-Buch Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel wären hier heranzuziehen.
Ebenso schwerwiegend sind die Mängel des von N.-R. u. N.W. vertretenen Kunst-Begriffs. Dieser wirkt ebenso oberflächlich und unbefriedigend wie der „Digitale Huimanismus“ im Ganzen, solange nicht wenigstens die Blochschen Perspektiven von Schein und Vorschein in der Kunst berücksichtigt werden. Künstlerinnen und Künstler sind in der Lage, konkrete Uto-pien in neuen Wirklichkeiten aufscheinen zu lassen und damit zur (möglichen) Weltverbesse-rung beizutragen. Getreu der Schillerschen Devise: „Was uns als Schönheit hier begegnet, wird uns als Wahrheit einst entgegengehen.“.
Eine neue Situation ist – allerdings erst nach 2023 – im Hinblick auf die KI-Suchmaschinen eingetreten. Anscheinend ist es inzwischen gelungen, die von N.-R. u. N.W. mit Recht aufge-zeigten Mängel von ChatGPT weitgehend zu beheben, und zwar in neuartigen KI-Such-maschinen wie ‚Microsoft-Copilot‘ und ‚Perplexity AI‘, die umfangreiche Quellen-Angaben und durchweg verlässliche Informations-Sammlungen bieten; was zweifellos eine willkom-mene Hilfe auch bei der Überprüfung von Fakten, Theorien und Konzepten ist.
Hinzuzufügen sind zwei weitere schwerwiegende Einwände. Obwohl die Kritik der beiden Autoren umfassend zu sein scheint, fehlen in ihr zwei wesentliche Aspekte: 1. die Tatsache, dass KI in immer mehr Lebensbereichen immer mehr Menschen unbestreitbar gute Dienste leistet, 2. dass die KI global nach wie vor unreguliert, d.h. teilweise unkontrolliert ist. Dies vor allem deshalb, weil die konkurrierenden Supermächte USA und China beide mittels KI die ganze Welt beherrschen wollen. Warum die beiden Autoren diese Aspekte ignoriert haben, ist mir ein Rätsel. Wie kann KI immer mehr Menschen eine echte, willkommene Hilfe sein, wenn sie grundsätzlich „anti-humanistisch“, also inhuman, menschenfeindlich ist? Tatsächlich beruht doch auch die KI auf menschlicher Arbeit. Dies betrifft sowohl die aufbereiteten Informationen als auch die Programmierung der PC-Software und die Herstellung der Hardware. Was ist dann noch „künstlich“? Diese und andere Fragen stehen im Folgenden zur Debatte, und zwar in einer
Anthropologie für das KI-Zeitalter.
Wie schon erwähnt, sind die Fähigkeit zur Willensfreiheit und zur Unterscheidung von Gut und Böse dem Menschen angeboren, ein Erbteil aus dem Tierreich. Anders steht es mit dem Selbst des Menschen. In seinem Buch Wie wir werden, wer wir sind (2019) weist der Neurowissenschaftler Joachim Bauer auf, dass das Selbst – anders als Nietzsche es vermeinte – nicht mit dem Leib identisch, d.h. nicht angeboren ist, sondern erst durch zwischen-menschliche Beziehungen im Säuglingsalter zu entstehen beginnt:
„Der menschliche Säugling, obwohl ein fühlendes, mit der Würde des Menschen aus-gestattetes Wesen, verfügt über kein Selbst. Die neuronalen Netzwerke, in denen sich Letzteres einnisten wird, sind zum Zeitpunkt der Geburt noch unreif und funktions-untüchtig. Seine Entstehung und Grundstruktur verdankt das menschliche Selbst jenen Bezugspersonen, die uns – vor allem in den ersten Lebensjahren – als »Extended Mind«, das heißt, als eine Art externe Leitstelle gedient haben. An der Komposition des Selbst sind Resonanzvorgänge beteiligt, wie sie sich zum Beispiel zwischen zwei Gitarren beobachten lassen: So, wie der Klang der einen Gitarre die Saiten einer zwei-ten Gitarre zum Klingen bringen kann, so können Bezugspersonen ihre inneren Melo-dien – ihre Art zu fühlen, die Welt zu deuten und in ihr zu handeln – via Resonanz auf den Säugling übertragen. Da dieser Transfer sich – in reduzierter Form – lebenslang fortsetzt, ist unser Selbst eine Komposition aus entsprechend vielen Themen und Melodien.“ (a.a.O. S. 7)
Das Selbst ist also nicht einfach der Leib, sondern ein Gemisch, ein mixtum compositum, aus dem personalen Individuum – als Einheit aus Leib, Seele und Geist –, seinen Bezugspersonen, seiner Umwelt und der Gesamtheit seiner Erfahrungen.
Der Säugling wirkt und ist zunächst einerseits völlig hilflos und unreif, zeigt aber andererseits schon frühzeitig Fähigkeiten zu Anteilnahme und Kommunikation mit seinen/ihren Bezugs-personen, und zwar u.a. dadurch dass Säuglinge schon früh beginnen, z.B. die Mimik einer Bezugsperson nachzuahmen. Echte Spiegelung und Resonanz wird daraus allmählich auf Grund der sogenannten Spiegelneuronen oder auch: Spiegelnervenzellen. (Wobei sogleich daran zu erinnern ist, dass diese speziellen Nervenzellen für die Empathie zuständig sind.) Hier liegen nicht Echo-Effekte, sondern echte Resonanz-Funktionen vor, und zwar u.a. in Form von Signalen der Körpersprache bzw. des Gefühlsausdrucks sowohl beim Säugling als auch bei der Bezugsperson. Hierdurch werde sogar das Gehirn des Säuglings geformt (a.a.O. S. 24). Wobei sich das Selbst nach und nach u.a. als Ich-Du-Sinn herausbilde:
„ Der Mensch entwickelt seinen Ich-Sinn in einer absolut einzigartigen Art und Weise: Das Selbst des Menschen als »Ich-Du-Sinn«. Das Resonanzprinzip lässt die Ge-stimmtheiten, Haltungen und Handlungsweisen der primären Beziugsperson(en) zu den Gefühlen und inneren Einstellungen des Kindes werden.“ (J. Bauer a.a.O. S. 31, Hervorhebungen K.R.) Daher fordert der Autor auch für die Kleinsten „ein sozial in-telligentes Umfeld, also Eltern oder gut qualifizierte Bezugspersonen, die ihnen ein verlässliches, liebevolles, dabei aber nicht einengendes, sondern förderndes Du sind.“ (a.a.O. S. 57)
Im Zusammenhang damit beschreibt J. Bauer auch den frühkindlichen Spracherwerb, wobei er hervorhebt, dass von der Sprache auch psycho-physische Top-down-Bewegungen ausge-hen, und zwar mittels neurobiologischer Rezeptoren im Gehirn, wobei nicht nur die Sprach-zentren des Gehirns, sondern auch die Spiegelneuronen und das neuronale Selbst-System aktiv werden. Zwischen beiden Systemen gebe es eine Arbeitsteilung. Das Selbst-System ar-beitet vor allem mit kognitiven Geistesinhalten (Gedanken, Ideen, Begriffe, Theorien, Wer-tungen usw.), während Spiegelneuronen nach speziellen neurobiologischen Regeln funktio-nieren, und zwar auf Grund von „Informationen, die sich mit dem Körper ausdrücken oder am Körper ablesen lassen“ (S. 85). (Was natürlich ebenfalls eine Form von Resonanz ist.) Das Erstaunliche daran: Die durch das neurobiologische Resonanzsystem „übertragene Informa-tion ist nichtstofflicher Natur“ (S. 86)! Die Körpersprache wird dabei sozusagen „ausgelesen“, indem der Beobachter die beobachtete Handlung „sozusagen »heimlich, still und leise« simu-liert, das beobachtete Geschehen also intern als Kopie mitlaufen lässt“ (ebd.), was mit dem Phänomen der „emotionalen Ansteckung“ verbunden sein kann: Gemütszustände wirken dann wechselseitig; mehr und mehr entwickeln sich Bewusstsein und Selbstbewusstsein.
Zum Tier-Mensch-Vergleich
Nicht zu unterschätzen sind die neuen Möglichkeiten des Tier-Mensch-Vergleichs, die sich aus J. Bauers Erkenntnissen ergeben. Der Mensch ist Tier – aber nur im biologischen Sinne, auch wenn der Mensch sich vom Tier durch den aufrechten Gang unterscheidet. Was den Menschen zum Menschen macht, ist zunächst die einzigartige Einheit von Körper, Seele und Geist, die er verwirklicht, zumal in Seele und Geist die deutlichsten Unterscheidungsmerk-male zu finden sind. Menschlicher Geist beruht auf menschlicher Subjektivität, ohne die es die für den Geist charakteristischen, dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen nicht gäbe. Philosophisch beginnt menschliche Subjektivität mit dem Cogito ergo sum: Man muss als Mensch existieren, um wie ein Mensch denken zu können. Was Descartes (1596-1650) noch nicht wusste: In dieser Existenz, d.h. vom Säuglingsalter an, entwickelt sich das Subjekt-Sein, wie J. Bauer erklärt, dadurch, dass sich das Selbst im Resonanz- und Empathie-Umgang mit den Bezugspersonen herausbildet. Dies erst recht in Verbindung mit hoch entwickelter, meta-phorischer Sprache und hoch entwickelter Technik. Als Subjekt ist der Mensch in der Lage, sowohl situationsgemäß als auch situationsunabhängig zu erleben, zu denken und zu handeln. Hierzu ist kein Tier fähig. Dagegen geht im Menschen das Tier zum Menschen über, wird das Tierische in das Menschliche integriert – oder zumindest integrierbar. Womit das Mensch-Sein nicht endgültig „festgestellt“ oder „festgelegt“, wohl aber vorläufig plausibel erklärt wird.
Zum Bewusstseins-Problem
Seit Hegels Phänomenologie ist bekannt, wie sich das Bewusstsein im Menschen konstituiert. Ausgehend vom Hier und Jetzt, dem Dieses und dem Meinen kommt der Wahrnehmung (auch von Gefühlen und Empfindungen!) der Verstand zu Hilfe; dies als unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Sinne und Verstand es uns ermöglichen, bloßes (An-sich-)Sein zu be-wusstem Sein werden zu lassen. Verstärkt sodann durch das Selbstbewusstsein, das seinerseits unmittelbar mit der Vernunft und dem Geist – den dialektischen Subjekt-Objekt Beziehungen – verbunden ist. Wichtig vor allem: Das Selbstbewusstsein impliziert die Aner-kennung des (Selbst-)Bewusstseins aller Mitmenschen als Rechtspersonen. Und: Die dialek-tischen Subjekt-Objekt-Beziehungen ermöglichen es, das bewusste Sein in ge-wusstes Sein zu transformieren und im Gedächtnis zu speichern, so dass Bewusstes und Unbewusstes eine untrennbare, kompakte Einheit in wechselseitiger Assistenz und positiver Affirmation bilden.
Eine neue politische Perspektive
ergibt sich aus einem von J. Bauer nicht erwähnten Aspekt des Selbst-Systems:
Da dieses zur Ich-Findung, Selbst-Fürsorge und Fürsorge für andere Menschen befähigt, hat das Individuum – das personale Selbst – einen Rechtsanspruch auf Selbstbestimmung, und zwar auch deshalb, weil der Mensch das einzige Wesen ist, „das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst“ beteiligt bzw. beteiligen kann, soll und muss. Beteiligt ist der Mensch vom Säuglingsalter an (s.o.). Beteiligen muss er sich später daran, wie sein Selbst konkret gestaltet wird, dabei auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Dieser darf seinem Anspruch auf Selbstbestimmung nicht im Wege stehen, was nur dann möglich zu sein scheint, wenn der Anspruch auf Selbstbestimmung tatsächlich auch gesamt-gesellschaftlich gewähr-leistet wird. Jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, wobei jedes personale Indi-viduum, die Einzelperson, an der individuellen Inanspruchnahme und Wahrnehmung dieses Rechts nur dann gehindert werden darf, wenn es dabei die Rechte seiner Mitmenschen ver-letzt oder missachtet.
Politisch besagt dies: Demokratie bedeutet nicht nur „Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk“, sondern auch Selbstbestimmung des Volkes. Demgemäß erstrebenswert er-scheint eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie, weil in beiden Formen – und erst recht in ihrer Kombination und effektiver Kooperation – sowohl das Gemeinwohl als auch die Rechte der Einzelpersonen gewahrt werden. – Dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt des Selbst-Systems sollte in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden.
Allerdings: Weder mit Liebe noch mit Demokratie allein oder zusammen können sämtliche akuten und latenten Welt-Probleme gelöst werden. Hierzu bedarf es weiterer Anstrengungen – nicht nur ethischer, sondern vor allem auch politischer Natur.
Anthropologie und KI: wachsende Bedeutung der KI in Wirtschaft und Gesellschaft
Genetik und Entwicklungspsychologie erweisen sich als Grundpfeiler der Anthropologie. Bis hin zur Entstehung des Bewusstseins – und darüber hinaus – lassen sich die Stadien der onto-genetischen Entwicklung wissenschaftlich analysieren. Was aber geschieht, wenn der heran-wachsende Mensch mehr und mehr mit Digitalisierung und KI zu tun bekommt? Was sich nicht vermeiden lässt, auch wenn versucht werden kann – und muss, Manipulation und Miss-brauch, insonderheit durch KI, zu verhindern. Um hier Klarheit zu gewinnen, kann man sich zunächst die wachsende Bedeutung von KI in immer mehr Lebensbereichen vergegenwärti-gen.
Das heißt: Bei aller Kritik an der KI (s.o.) darf ihre zunehmende Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Dies gilt zumal für die Zeit nach 2010, als es immer besser gelang, riesige Datenmengen und nie dagewesene, enorme Rechenpower mit-einander zu verbinden. Befragte Unternehmer*innen profitierten 2021 angeblich zu 86 % vom Einsatz von KI, während 25 % sich von einer erweiterten KI-Verwendung beträchtliche Umsatzsteigerungen erwarteten.123 Diese positive Haltung wird auch auf Erfahrungen mit der Corona-Pandemie zurückgeführt. Außerdem erwartet man neue Impulse durch das Programm ‚Machine Learning Operations‘. Und man erhofft sich von der KI sogar Fortschritte bei der Überwindung des Fachkräftemangels, zumal durch KI bis 2035 mit einem Anstieg der Arbeitsproduktivität um mehr als 30 % zu rechnen sei (ebd.). Außerdem wird behauptet:
„Künstliche Intelligenz ermöglicht die Entwicklung einer neuen Generation von Produkten und Dienstleistungen, auch in Sektoren, in denen europäische Unternehmen bereits eine starke Position innehaben: grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Maschinenbau, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Mode, Tourismus. KI kann Ver-triebswege optimieren, Wartungstechniken verbessern, die Produktionsleistung und -qualität steigern, den Kundenservice verbessern und dazu beitragen, Energie zu sparen.“ (a.a.O. S. 3)
Auch die Nachhaltigkeit der Produkte könne erheblich gesteigert werden.
Im Öffentlichen Dienst könne KI zur Kostensenkung beitragen und „neue Möglichkeiten in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Bildung, Energie und Abfallwirtschaft eröffnen“ (ebd.).
Die Gesundheitsvorsorge und -pflege könne erheblich verbessert werden; ebenso die Sicherheit aller Verkehrsmittel und der Zugang zu den Bildungs-Informationen. – Wobei m.E. an Schulen und Hochschulen erhebliche Probleme insbesondere durch den Einsatz von KI-Programmen wie ChatGPT und anderen entstehen. Während man solche Programme an einigen US-Schulen bereits verboten hat, plädieren deutsche Professorinnen und Professoren für „offenen Umgang mit KI“, so z.B. Prof. Dr. Doris Weßler in Stellungnahmen u.a. auf youtube.com. Meine Frage: Wie sollen Studierende, Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, die fiktionalen, oft fehlerhaften KI-Erzeugnisse von ChatGPT zu überprüfen, zumal die darin verarbeiteten Datenmengen völlig unüberschaubar sind und durchweg keine Quellenangaben enthalten?
Ebenso beunruhigend wirkt bei alledem die Ankündigung von Microsoft, weitere 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung neuer KI-Programme zu investieren, nachdem ausgerechnet Microsoft kurz zuvor neue „Ethik-Grundsätze für die KI“ verkündet hatte.
Wobei jedoch nicht zu verkennen ist, dass Microsoft u.a. mit dem KI-Chat-Programm ‚Microsoft-Copilot‘ neuerdings ein echter Durchbruch gelungen ist, der nahezu überall von Bedeutung ist. So auch in Philosophie und Wissenschaft, ermöglicht doch dieses Chat-Programm sogar eine neue Lösung des Induktions-Problems. Wenn es darauf ankommt, aus der Wirklichkeit selbst legitime Schlüsse zu ziehen, benötigt man hierfür Gewissheit über die (vorläufige) Gültigkeit des eigenen Wissens und der eigenen theoretischen Annahmen, z.B. auch bei Beobachtungen und Experimenten aller Art. ‚Microsoft-Copilot‘ stellt dieses Wissen erstmals der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung – neben umfassendem Experten-Wissen, das auch für die politische Alltagspraxis unmittelbar relevant ist und z.B. auch zur Begründung neuer theoretischer Synthesen aus direkter und repräsentativer Demokratie dienen kann. – Darin übertroffen wird Microsoft-Copilot vielleicht durch die KI-Suchmaschine ‚Perplexity AI‘, und zwar durch deren bessere Quellenangaben.
Zu bedenken ist außerdem, dass jegliche KI auf menschlicher, d.h. nicht-künstlicher Arbeit beruht; dies sowohl hinsichtlich der aufbereiteten Informationen als auch der Programmierung der PC-Software. – Zu der Frage nun, ob Künstliche Intelligenz in der Lage ist, die Probleme des Anthropozäns/Kapitalozäns, in dem wir leben, zu lösen, heißt es bei ‚Microsoft-Copilot‘:
„Die Probleme des Anthropozäns, einer Ära, in der menschliche Aktivitäten die domi-nierende Kraft für Umweltveränderungen sind, sind komplex und vielfältig. KI bietet jedoch vielversprechende Werkzeuge und Lösungen, um einige dieser Heraus-forderungen anzugehen:
1. Umweltüberwachung und Datenanalyse
KI kann große Datenmengen analysieren, um Umweltveränderungen zu überwachen und vorherzusagen. Dies umfasst Klimamodelle, Wettervorhersagen und die Über-wachung von Ökosystemen. Solche Analysen können dabei helfen, fundierte Entscheidungen zum Umweltschutz zu treffen.
2. Nachhaltige Landwirtschaft
KI-gesteuerte Technologien können die Präzisionslandwirtschaft verbessern, indem sie den Einsatz von Wasser, Düngemitteln und Pestiziden optimieren. Dadurch wird die Effizienz erhöht und die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft reduziert.
3. Energieeffizienz
KI kann zur Optimierung des Energieverbrauchs in verschiedenen Sektoren beitragen, von der Industrie bis hin zu Haushalten. Durch die Analyse von Nutzungsdaten können Energieversorger die Nachfrage besser vorhersagen und den Energieverbrauch reduzieren.
4. Kreislaufwirtschaft
KI kann Prozesse zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien verbessern, wodurch die Abfallmenge reduziert und Ressourcen effizienter genutzt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Kreislaufwirtschaft.
5. Naturschutz und Artenvielfalt
KI-Technologien wie Bildverarbeitung und Drohnentechnologie können zur Überwachung und zum Schutz bedrohter Tierarten und ihrer Lebensräume eingesetzt werden. Dies hilft, die Artenvielfalt zu erhalten und Ökosysteme zu schützen.
Herausforderungen und Ethik
Trotz der vielversprechenden Ansätze müssen ethische und soziale Fragen berücksichtigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass KI-Technologien fair und transparent eingesetzt werden und dass sie nicht unbeabsichtigte negative Auswirkungen haben.
KI allein wird die Probleme des Anthropozäns nicht vollständig lösen können, aber sie kann ein mächtiges Werkzeug sein, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Der Schlüssel liegt in der verantwortungsvollen Nutzung und der Integration von KI in umfassende Strategien für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit.“
Letzteres ist jedoch zu bezweifeln. Der Kapitalismus hat nicht nur die Öko-Krise, sondern auch die – bislang ebenfalls ungelöste – Soziale Frage verursacht. Beide Probleme parallel oder zusammen zu lösen, scheint im Kapitalismus unmöglich zu sein. Hauptgrund: Mehr als umfassende Information – zweifellos eine großartige Errungenschaft! – kann KI nicht anbie-ten. Um durchgreifende Veränderungen herbeizuführen, bedarf es sowohl einer Verände-rungs-Ethik (Ernst Bloch) als auch umfassender Systemkritik und -veränderung. Genauer: Auf die aktuell akuten Bedrohungen – Öko-Krise, Digitalisierung, Trans- und Posthuma-nismus, Künstliche Intelligenz – ergänzbar durch den Nuklearen Holocaust, – sind mit meiner Erweiterten Öko-Ethik124 Antworten möglich, erst recht, wenn sie durch historische und aktuelle Werte-Synthesen gestützt werden können. Nicht jedoch auf die Bedrohung durch den aktuellen globalisierten Turbo-Kapitalismus – und auch nicht auf die Frage, wie die „Antworten“, z.B. in Form meiner legitimen Forderung[124], denn in die Tat umgesetzt werden können, so dass sie gesellschaftsverbessernd wirken. Was leider auch dann nicht möglich ist, wenn sich veranschaulichen lässt, wie aus Werten Normen, d.h. verinnerlichte, verbindliche Verhaltensregeln bzw. „Maximen“ werden. Dies gilt wahrscheinlich für jede Art der Um-wandlung von Werten in Normen, so a) bei angeborenen Werten, die der ursprünglichen Selbsterhaltung und Erstorientierung dienen; b) bei der Normierung von Werten durch Erzie-hung und Sozialisation, die auf Grund unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen stattfinden; c) durch politische und sonstige Gesetzgebung. Die unter a) genannten Faktoren sind anscheinend kaum beeinflussbar, während bei b) und c) das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ zum Tragen kommt. Darunter im turbo-kapitalistischen Westen die Macht der manipulativen Fakten: Arbeitgeber-Interessen, „Spaß“-Ideologie, analytisch-positivistisches Denken u.a.m. Wogegen ethische Grundsätze einen sehr schweren Stand bzw. häufig gar keine Chancen auf Verwirklichung haben. Wo Erkenntnisse auf Interessen prallen, blamieren sich meistens die Erkenntnisse, wie Marx feststellte. Legitime ethische Forderungen, z.B. nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität, durch-zusetzen, stößt in einer Klassen-Gesellschaft („mit Herr und Knecht“) nicht selten auf unüberwindliche Hindernisse, verursacht z.B. durch digitale Überwachung, kapitalistische Herrschafts-Ideologie, Lobbyismus, Stigmatisierung und Verfolgung Andersdenkender, Ge-waltmaßnahmen (z.B. Entlassungen in Krisen-Zeiten) u.a.m.
Sich hiergegen aufzulehnen, ist mit Ethik und Moral allein nicht möglich. Dazu bedarf es vielmehr politischer Gegenwehr mit langem Atem, zumal dann, wenn weder ein „revo-lutionäres Subjekt“ noch ein entsprechendes Klassen-Bewusstsein vorhanden ist. Dennoch brauchen die ethischen Forderungen davor nicht zu kapitulieren. Vielmehr sind sie in die anti-kapitalistische Veränderungsethik aufzunehmen, wie sie Ernst Bloch konzipiert hat. Eine solche Ethik kann und muss auch den reformerischen bis revolutionären Kampf stützen, getreu der Marxschen Devise, dass die Philosophie sich nicht verwirklichen kann, ohne sich „aufzuheben“ – dies wohl auch im Hegelschen Sinne des Begriffs „Aufhebung“: Die Philosophie soll nicht mehr nur in den Köpfen stattfinden, sondern die gesamte Realität beeinflussen und durchwirken. Philosophie ist dann nicht mehr, was sie traditionell-ideali-stisch war, sondern gewinnt neue Qualitäten als effektiver Teil der Wirklichkeit selbst.
Dem entspricht jedenfalls mein Modell eines Demokratischen Ökosozialismus, das ich schon mehrfach (insbesondere o.J. (2021), aber auch schon 2015, 2017 und 2020 im GRIN-Verlag München) veröffentlicht habe. Es geht darin vor allem um allgemeine kulturelle und politi-sche Emanzipation, neue, sozialistische Formen einer digital gestützten Wirtschaftsplanung, direkte Demokratie, Marktsozialismus und Wirtschaftsdemokratie.
Wenn nun anzunehmen ist, dass sowohl die Soziale Frage als auch auch die Öko-Krise durch Formen eines Demokratischen Ökosozialismus zumindest in den Griff zu bekommen sind, können Überlegungen über weitergehende gesamtgesellschaftliche Ziele angestellt werden. Wenn z.B. Direkte Demokratie ermöglicht werden soll, müssen a) die Menschen sich ihrer Lebensgrundlagen sicher sein können und b) die krassen sozialen bzw. finanziellen Ungleich-heiten beseitigt oder auf ein Minimum reduziert werden. (Denkbar wäre es allerdings auch, finanziell schwache Initiatoren von Volksabstimmungen regierungsamtlich zu subventio-nieren. Vgl. Robra 2024 b), S. 170 f.)
Kritische Würdigung und Fazit
In dem Wikipedia-Artikel Gesetz über künstliche Intelligenz125 findet sich eine Diskussion des EU-AI-Acts, die mutatis mutandis teilweise auch auf die USA und China bezogen werden kann. Darin heißt es:
„Die weitgehenden Definitionen, Verbote und komplizierten Compliance-Vorschriften im ursprünglichen Vorschlag lösten Kritik der Industrieverbände (u. a. Bitkom und KI-Verband) aus. Der Kompromissentwurf des Rates wurde dahingehend in einigen Punkten abgeschwächt. Außerdem wird eine große Rechtsunsicherheit, der hohe bürokratische Aufwand und Doppelregulierung, z. B. im Medizinbereich kritisiert. Auch sei die geforderte fehlerfreie Auswahl von Trainingsdaten nahezu unmöglich.
Auch die Bundesregierung warnt vor Überregulierung. Nach einer Studie würde die Verordnung zu einem hohen Aufwand bei einem großen Teil der KI-Anwendungen führen.
Auf der anderen Seite kritisieren Bürgerrechtler (u. a. EDRi, AlgorithmWatch und DGB) den Entwurf als nicht weit genug, Definitionen seien zu eng gefasst und die Regelungen böten Schlupflöcher, so sollen die Vorschriften z. B. für militärische Zwecke nicht und für die Strafverfolgung nur teilweise gelten. Außerdem wurden einige erhoffte Regulierungen wie das Verbot von Predictive Policing und bio-metrischer Überwachung nicht mit aufgenommen. Die Entwürfe des EU-Parlaments gehen stärker auf diese Positionen ein. Gemäß der Version vom 11. Mai soll den Staaten die retrograde Videoüberwachung und damit die biometrische Massen-überwachung ermöglicht werden. Dass die Bundesregierung sich im Rahmen der Verhandlungen explizit für die retrograde Videoüberwachung aussprach, obwohl sie im Koalitionsvertrag noch ihre Ablehnung kundtat, sorgte für Kritik u. a. von netzpolitik.org.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Verordnung keine Möglichkeiten zur individuellen Rechtsdurchsetzung (wie Schadensersatzansprüche) schafft.“ (a.a.O. S. 2 f.)
Erschwert wird dies durch das Fehlen eines allgemeinen, internationalen KI-Rechts. Umso mehr empfiehlt es sich, aus dem Vorliegenden die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Natürlich gibt es weltweit neben den besprochenen Gesetzes-Vorlagen der EU, der USA und Chinas weitere, ähnliche Projekte. Wahrscheinlich aber nicht mit höherer inhaltlicher Relevanz. An den drei Gesetzesvorlagen fällt auf, dass sie die Probleme der schwachen KI nur ansatzweise, die der starken kaum oder gar nicht behandeln. Weder der US-amerikanische Nietzsche-Kult und -Hype noch R. Kurzweils „Singularitäts“-Phantastereien noch die monströse „Symbiose“ von Mensch und Technik werden analysiert. Die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI wird ignoriert.
Gravierend kommt hinzu, dass bisher anscheinend in keinem einzigen Gesetzes-Vorhaben die Tatsache erwähnt wird, dass die KI-„Singularität“ das Ende aller Bemühungen um sinnvolle Alternativen zum Bestehenden, d.h. zum globalisierten Neo-Liberalismus, bedeuten würde. An die Stelle eines Reichs der Freiheit würde eine hochexplosive, nicht funktionstüchtige „Symbiose“ von Menschen und Robotern treten.
Um die negativen Auswirkungen der schwachen und starken (generativen) KI wirksam zu bekämpfen, werden nationale Gesetze nicht ausreichen. Vielmehr bedarf es verbindlicher, internationaler Vereinbarungen, z.B. auf UN-Ebene. Dies hat auch Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, bereits erkannt. Angesichts der existenziellen Bedrohung der Mensch-heit durch KI kritisierte er die Macht von Großunternehmen und -Staaten, von denen die Menschenrechte missachtet werden. In einem Positionspapier der UNO stellte er Vorschläge zum weltweiten Umgang mit KI vor und kündigte die Einrichtung entsprechender hoch-rangiger Beratergremien und die Gründung einer UN - Regulierungsbehörde an.126 Kaum einen Monat später nahm der UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine Resolution an, in der Schutz- und Kontrollmaßnahmen zur KI beschlossen wurden. Die Transparenz entsprechender Systeme soll gefördert werden, speziell zur Verwendung der für die KI-Technologie benutzten Daten, die „auf menschenrechtskonforme Weise gesammelt, verwendet, weiter- gegeben, archiviert und gelöscht werden“ sollen. Die Resolution wurde im Juli 2023 einvernehmlich angenommen.127
Grund- und Leitsätze des Humanismus
Antike Vorläufer und Vorbilder des Humanismus
1. „Der delphische Spruch gnothi seauton (erkenne dich selbst) bedeutete nicht nur: „Erkenne deine Nichtigkeit und denke daran, dass du ein Mensch und kein Gott bist“, sondern auch: „Erkenne deine wunderbare Anlage, deine hohe Bestimmung, deine Würde und deine Pflicht“. (s.o. S. 24)
2. Heraklit (ca. 520-460 v.Ch.): „Im Anfang war der Logos.“ – „Alles fließt.“ – „Man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss.“ – „Der Krieg (‚polemos‘) ist der Vater aller Dinge.“ (S. 26 f.)
3. Der Logos ist sowohl eine Naturgegebenheit als auch ein universales, allgemein gülti-ges Gesetz. (S. 27)
4. Ob der Logos tatsächlich allem zu Grunde liegt, ist nicht überprüfbar. (S. 51)
5. Polemos als „Vater aller Dinge“. Ob alles durch Kampf, Streit oder gar Krieg entsteht, ist zweifelhaft. (S. 52)
6. Heraklits:: „Mehr als sichtbare gilt unsichtbare Harmonie.“ (S. 27 f.)
7. Zu Heraklits Gottesvorstellungen: Dass alle – außer Heraklit – den Logos verkennen oder missachten, ist fraglich. Gleiches gilt für Heraklits Pantheismus. Dass alles „göttlich“ sei, wäre erst noch zu beweisen. (S. 52)
8. Protagoras (ca. 490-411 v.Chr.): „Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind.“ (S. 22)
9. Der Ansatz des Protagoras ist subjektivistisch bzw. anthropozentrisch. (S. 23)
10. Demokrit (ca. 460-370 v.Chr.): Während alle Unterschiede für uns nur Einsicht in die sinnlichen Erscheinungen sind, befreit die Erkenntnis von törichter Furcht wie von eitler Hoffnung und bewirkt jene Gelassenheit (Ataraxie), die das höchste Gut und zugleich die wahre Glückseligkeit ist. (S. 29 f.)
11. Demokrits Behauptung, auch die Seele sei ein „Atomenaggregat“, konnte wissen-schaftlich nicht belegt werden. (S. 52)
12. Zwischen der Atomtheorie Demokrits und derjenigen heutiger Atomphysik gibt es bedeutende Unterschiede. (ebd.)
13. Platon (427-347 v.Chr.) geht davon aus, dass das höchste Ziel eines Menschen der Wunsch ist, glücklich zu werden. Dieses Ziel lässt sich, seiner Ansicht nach, nur dann erreichen, wenn jeder das tut, was er am besten kann. (S. 30)
14. Platons Menschenbild lässt sich zusammenfassend als eines beschreiben, dass auf einer natürlichen Ungleichheit der Menschen beruht, die allerdings dann zu einem harmonischen Zusammenleben führen soll, wenn sich alle in ihrem Tun verwirklichen können. (ebd.)
15. Platons Ideenlehre hat schon sein Schüler Aristoteles heftig kritisiert. Demnach entstehen die Ideen nicht im platonischen „Ideen-Himmel“, sondern in den Köpfen der Menschen. (S. 53)
16. Platon stellt die Frage „Wer soll herrschen?“ in den Mittelpunkt seiner staats-theoretischen Überlegungen und beantwortet sie im Sinne eines Führerprinzips. (ebd.)
17. Einer der Gründe für Platons Totalitarismus (der ‚Politeia‘) liegt nach Popper in seiner Verwechslung von Individualismus mit Egoismus, dem er den Kollektivismus als Leitbild gegenüberstelle. (ebd.)
18. Aristoteles (ca. 384-322 v.Chr.): Sein Menschenbild baut darauf auf, dass der Mensch handelt, um glücklich zu werden. Das Menschenbild stellt das Streben nach Glück in den Mittelpunkt (S. 31).
19. Und zwar a) auf Grund von Analysen tatsächlicher Lebensweisen seiner Zeitgenossen und b) auf Grund seiner Seelen-Lehre. Daraus erschließt sich eine dreifache Fundie-rung der Wertlehre, nämlich in der Lebenspraxis, in der Psychologie und in der Ethik bzw. der Philosophie im Ganzen. (S. 31 f.)
20. In seiner Politik geht Aristoteles vom Menschen als „Zoon politicon“ (Lebewesen, das in Gemeinschaft mit anderen existiert) aus, der in den Lebenskreisen: Familie, Gemeinde, Staat lebt. (S. 33)
21. Kant: Nicht die Glückseligkeit, sondern Gott ist das „höchste mögliche Gut“ in der Welt. Daher müssen wir versuchen, unseren eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. (S. 56)
22. Epikur (ca. 342-271 v.Chr.) fordert, jedermann, gleich ob jung oder alt, solle sich der Philosophie zuwenden. (S. 33)
23. Nicht der grenzenlose Lebensgenuss – wie viele polemisch behaupten – ist für Epikur philosophisch zu rechtfertigen, sondern klare Überlegung über „die Grenzen der Freude“. (ebd.)
24. Epikur: „So ist also der Tod, das schauervollste Übel, für uns ein Nichts; wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr.“ (ebd.)
25. Diese Darstellung des Todes-Problems erscheint als verkürzend und unzureichend. (S. 57)
26. „Epikurs Gärten sind keine Gärten der Lüste, insbesondere nicht der sexuellen.“ (S. 58)
27. Lukrez (ca. 99-54 v.Chr.): Naturansicht und -erkenntnis sollen die Ängste und Täu-schungen der Seele beseitigen. Seele und Geist sind durch die gemeinsame materielle Grundlage eng verbunden. Sie sind daher sterblich wie der Leib des Menschen. (S. 34)
28. Griech. ‚ Paideia‘ wird von den Römern mit ‚humanitas‘ („Menschlichkeit, Menschenfreundlichkeit,, echte Bildung, (feiner) Geschmack, Anstand“) übersetzt. (S. 23)
29. Julian Nida-Rümelin: antike „Grundbausteine humanistischen Denkens: (1) Autarkie, (2) Rationalität, (3) Universalität “. (S. 24)
30. „Wer nicht beherrscht werden will, muss sich selbst beherrschen.“ (ebd.)
31. Autonomie: die „Gestaltung des Lebens nach eigenen Vorstellungen und Wertungen“ (ebd.).
32. Bei Cicero (106-43 v.Chr.) steht die ‚dignitas hominis‘, die Würde des Menschen, im Zentrum einer universalistischen Anthropologie. (S. 24)
33. Humanität ist dem Menschen nicht angeboren, erst durch die Erziehung in den Künsten (artes) wird die Jugend zur humanitas geformt und gebildet (Cicero). (S. 25)
34. Für Cicero bilden Vernunft und Sprache (/ratio et oratio/) das Fundament der menschlichen Gemeinschaft. (S. 26)
35. Die Sophistik, die Stoa (darunter auch Cicero) und der Skeptizismus stellen Sonder-fälle dar. (S. 34)
36. Sophisten, gr. Sophistai >Weisheitslehrer<; ursprünglich alle die Wissenschaft Pfle-genden und nach Weisheit Strebenden, im 5. Jh. die in Athen auftretenden und dorthin zugewanderten Lehrer, die den Unterricht in den Wissenschaften und der Philosophie, besonders die Ausbildung der Jugend zu Rednern betrieben. In der zeitgenössischen Kritik wurde ihnen vorgeworfen, daß sie aus ihrer Tätigkeit ein Gewerbe, aus der Aus-bildung zur Beredsamkeit eine formale Überredungskunst machen. (S. 34)
37. Stoa: Im Unterschied zu Epikur suchen die Stoiker Sinn und Ziel des Daseins nicht in der Freude, sondern im Seelenfrieden, der ‚ataraxia‘, d.h. in der Harmonie des Menschen mit sich, mit der Gesellschaft und der Natur. (S. 35)
38. „Stoizismus ist eine egozentrische Philosophie.“ (S. 60)
39. Skeptizismus: „Der Skeptizismus mündet in einen ethischen Traditionalismus, der sich fremder Autorität verpflichtet weiß, ohne sie objektiv begründen zu können, da er keine objektiven Kriterien für ein glückliches Leben kennt. Und daher übernimmt der Skeptiker denn auch fraglos den staatlich sanktionierten mythischen Götterglauben, weil er über das wahre Wesen der Götter ohnehin keine Aussage treffen kann, sondern diesbezüglich gerade zur Urteilsenthaltung genötigt wird.“ (S. 37)
40. Trotzdem: Descartes‘ methodischer Zweifel und Cogito. (S. 62)
41. Karl Marx: De omnibus dubitandum. An allem ist zu zweifeln. (S. 63)
42. Religiöse Faktoren. In den Religionen werden nicht selten Glauben und Wissen zu mehr oder weniger trüben Mischungen vermengt. (S. 37)
43. Religion bietet eine angeblich verbindliche Ethik, z.B. in Form der 10 Gebote. (ebd.)
44. Darüber hinaus ermöglicht sie Halt und Orientierung auch in metaphysischer und transzendenter Hinsicht – was keine nicht-religiöse Ethik allein leisten kann. (ebd.)
45. Ernst Bloch: „Wo Religion ist, da ist auch Hoffnung.“ Glaube, Liebe und Hoffnung sind Grundpfeiler nicht nur des Christentums. (ebd.))
46. Zu den Stammesreligionen: Eine Ur-Religion gibt es offenbar nicht, wohl aber ein „ Ur-Ethos“ (Küng). (S. 38)
47. Stammesreligionen: Glaube an eine „ewige, ungeschaffene Lebenskraft“,,„tiefe Ehr-furcht vor allem Leben“, ungeschriebene ethische Normen: „Gegenseitigkeit, Gerechtigkeit, Großzügigkeit. (ebd.)
48. Judentum. Der Rabbiner Zwi Braun sieht in den Zehn Geboten drei Grundvermögen des Menschen angesprochen: Denken, Reden und Handeln im Dienste Gottes. (S. 39)
49. Dabei steht das rechte Handeln durchaus im Vordergrund. (ebd.)
50. Zehn Gebote: eine der Grundlagen heutiger Rechtsordnung, da sie z.B. schon im Römischen Recht und in nicht-jüdischen Religionsgemeinschaften (z.B. nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam!) Aufnahme gefunden haben. (ebd.)
51. Hinduismus. Neues Menschenbild, allerdings nicht im Sinne des westlichen Indivi-dualismus, sondern in Bezug auf übergreifende Ordnungssysteme (Familie, Gesell-schaft, Kosmos). (S. 40)
52. Dharma: „Ordnung, Gesetz, Brauch, Sitte, Vorschrift, Regel; Pflicht, Tugend, gute Werke, religiöser Verdienst; Natur, wesentliche Eigenschaft, Charakteristikum“. (S. 40 f.))
53. ‚Tat tvam asi‘ – ‚das bist du‘: die Fähigkeit zum Mitleid und zum Mitleiden (vorwegnehmend die moderne Empathie). (S. 41)
54. Buddhismus. Der „heilige“ achtteilige (bzw. achtfache) Pfad besteht in Wirklichkeit aus folgenden acht Wert-Begriffen: „ rechtes Glauben, rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sich-Versenken“. (S. 43)
55. Daoismus: Dao bedeutet sowohl ‚Weg‘ (bzw. rechter Weg) als auch ‚Vernunft‘. (Stör Es ist der Urgrund, dem alles Sein entspringt und in den auch alles wieder zurück-kehrt. (S. 43)
56. Zentrale Werte des Daoismus sind außerdem „Loyalität und kindliche Liebe“, was bedeutet, „die Höherstehenden zu ehren und die Niedrigerstehenden zu lieben“. (ebd.)
57. Hoch über allen Ge- und Verboten steht jedoch – wie im Christentum – die Nächstenliebe; es sollte „die Liebe, die man zu sich selbst hat, verbunden sein mit der Liebe zu anderen“. (S. 43 f.))
58. Konfuzianismus. Kung-fu-tses Formulierung der Goldenen Regel: „Was du selbst nicht wünschest, das tue auch nicht den anderen“. (S. 44)
59. In der Ethik sind die „fünf einfachen Tugenden“ maßgeblich, nämlich: Weisheit, Güte, Treue, Mut und Ehrfurcht. (ebd.)
60. Jesus und das Christentum. „Die ureigenste Botschaft des Christentums betrifft das ureigenste Sein der Person, ihre Individualität. Vor Gott und durch Christus bekommt jede Einzelperson ihre unendliche Würde und Anerkennung als Person.“ (S. 45)
61. Insgesamt gesehen gehören Bergpredigt und Vaterunser zu den Grundlagen des Neuen Bundes der Freiheit vom Gesetz , den Jesus den Seinen verspricht. Mit ihm will er den Alten Bund ersetzen, den Gott einst mit Moses – Moses mit Gott – geschlossen hatte. (S. 47)
62. Verzerrungen und Fehlentwicklungen im Christentum (S. 63) Auch die Story von Adams „Sündenfall“ liegt den Vorstellungen von der „Erbsünde“ (so bei Augustinus, Paulus, Luther u.a.) zu Grunde. (ebd.)
63. Dies alles erklärt aber nicht die bekannten schwerwiegenden Fehlentwicklungen, zu denen es in der Geschichte des Christentums gekommen ist, darunter Exzesse wie die Kreuzzüge und andere Religionskriege, die Inquisition, die Verfolgung von Juden, „Hexen“ und „Ketzern“, Frauen- und Leibfeindlichkeit, Kindesmissbrauch u.a.m. (ebd.)
64. Exkurs ins Mittelalter: zum Islam. Im Unterschied zum Christentum kennt der Islam keine Menschwerdung Gottes. (S. 48)
65. Islam bedeutet im ursprünglichen Wortsinn so viel wie „völlige Hingabe an Gott und seinen Willen“ und darüber hinaus, ähnlich wie das hebräische ‚Shalom‘: „Frieden im Sinne eines allumfassenden Heilseins“. (ebd.)
66. Da der Mensch nicht völlig selbständig über Gut und Böse befinden kann und darf, braucht er keine spezielle Ethik, sondern nur eine spezielle „Charaktereigenschafts-kunde“, ein Begriff, der allerdings dem Wortursprung SUEDOS (für ‚Ethik‘, erstaun-lich nahe liegt. (S. 49)
67. Die Aleviten verbindet mit den Sufis die humanistische Orientierung, zu der auch die mystische Interpretation des Korans gehört. (S. 50)
68. Renaissance- Humanismus. Umstritten ist, ob es zwischen Mittelalter und Renaissance eine Kontinuität der Entwicklung oder einen Bruch, eine klare Zäsur, gegeben hat. (S. 64)
69. Zuweilen wird übersehen, dass die Renaissance in Italien nicht erst nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453, sondern schon im Mittelalter begann bzw. vorbereitet wurde, und zwar nicht zuletzt von Dichtern wie Dante, Petrarca und Boccaccio und Künstlern wie Giotto. (S. 65)
70. Wodurch aber kam der Humanismus in der Renaissance-Zeit, d.h. nach 1453, zum Durchbruch? Vor allem wohl durch den mächtigen Bildungsschub, den der Zustrom byzantinischer Philosophen und Gelehrter in Oberitalien auslöste. (S. 70)
71. Die humanistische Gelehrtenbewegung will das antike Menschenbild erneuern. Die antike Bildung wird als unübertreffliches Vorbild empfunden und das lebensbejahende und schöpferische Individuum rehabilitiert. (S. 70 f.)
72. „Die Kunst der Renaissance ist ein Abbild der Denkweise des Humanismus. Der Mensch als Individuum steht im Vordergrund.“ (S. 72)
73. „Der vielleicht bedeutendste Beitrag des Humanismus zur Wissenschaft war sein Wissensdurst und die Zuversicht, dass Antworten durch menschliches Bemühen gefunden werden können.“ (S. 74)
74. Erasmus von Rotterdam (1467-1536) ist eine besonders lichtvolle Gestalt des Renaissance-Humanismus, nimmt er doch in mancher Hinsicht die europäische Aufklärung bereits vorweg. (ebd.)
75. Erasmus zur Willensfreiheit: „Wenn der Wille nicht frei gewesen wäre, hätte die Sünde nicht zugerechnet werden können, denn sie hört auf, eine Sünde zu sein, wenn sie nicht eine freiwillige gewesen ist, es sei denn, dass ein Irrtum oder eine Gebundenheit des Willens aus einer Sünde entstanden ist.“ (S. 75)
76. Aus dem freien Willen ergibt sich zudem die Notwendigkeit, alle Menschen – gleich welcher Herkunft, Rasse oder Religion – als Rechtspersonen anzuerkennen. (S. 76)
77. „Erasmus entwickelte ein neues Frauenbild, welches mit der frauenverachtenden Tradition brach.[109] Er setzte sich – entgegen den damaligen Frauenklischees und im Gegensatz zur Doktrin des Aristoteles – schon früh für die Frauenbildung ein. Mädchen sollten die gleiche Erziehung genießen wie Jungen, sie seien „keine Mängel-wesen“ (Aristoteles). Frauen könnten, auch durch Studium, so seine Hoffnung, zu einem an humanistischen Werten orientierten Europa beitragen.“ (S. 77)
78. Darüber hinaus gilt Erasmus als Vorläufer der Friedensbewegung. Sein Denken und Handeln kann als Bollwerk gegen jede Form von Faschismus und Totalitarismus angesehen werden. (S. 77)
79. Zwischen Renaissance und Barock: die Utopisten Morus und Campanella (S. 78)
80. In Morus‘ ‚Utopia‘ habe man die wichtigsten Ursachen für alle sozialen Ungerech-tigkeiten und Missstände beseitigt: Privateigentum, Geld und Geldwirtschaft. Wo das Privateigentum herrscht, könne es keine „Gleichheit des Besitzes“ und kein Glück der Allgemeinheit geben. (ebd.)
81. Philosophisch untermauern die Utopier ihre neue Ordnung durch eine ausgeklügelte Tugendlehre, die allerdings in weiten Teilen an Epikur erinnert, so in der Unterschei-dung zwischen Notwendigem, Nützlichem und Schädlichem. (S. 79)
82. Größtmögliche Toleranz herrscht in Fragen der Religion. Bekehrungsversuche sind erlaubt, aber nur „ohne Anmaßung“, ohne Auftrumpfen und ohne jegliche Gewalt-anwendung. (ebd.)
83. Campanella s „Sonnenstaat“ ist ein letztlich religiös begründeter, totalitärer Über-wachungsstaat. (S. 80)
84. Campanella selbst pries seinen Entwurf zwar als den einer „Reform der christlichen Republik“ an; tatsächlich aber handelt es sich um extrem religiösen (theokratischen) Fundamentalismus, wenn nicht Klerikalfaschismus. (ebd.)
85. Descartes‘ Menschenbild. René Descartes (1596-1650) fundiert das Denken im ‚Cogito ergo sum‘ und damit im eigenen Ich, und zwar auch in der Formel ‚ je suis une chose qui pense‘ („ich bin ein denkendes Etwas“). (ebd.)
86. Nicht akzeptabel sind sämtliche Versuche, den Autor einfach als „Dualisten“ abzu-stempeln. (S. 81)
87. Die Willensfreiheit bedarf keines Beweises, wie Descartes in Nr. 39 seiner Prinzipien der Philosophie (von 1644) betont. Erkennbar ist sie vielmehr daran, dass sie Wahlfreiheit, nämlich Zustimmung oder Ablehnung, ermöglicht (ebd.). (S. 82)
88. Das Cogito wird zur Grundlage einer neuen Anthropologie, in der Descartes den Menschen als denkendes, geistbestimmtes, mit Willensfreiheit begabtes Wesen auffasst. (ebd.)
89. Dabei entwickelt Descartes keine Wahrheitstheorie, setzt vielmehr das Unterschei-dungsvermögen auf Grund des bon sens, des gesunden Menschenverstandes, als bei allen Menschen vorhanden voraus und fragt sich, wie das Ich-Subjekt die Objekte der Innen- und Außenwelt richtig erkennen und analysieren kann. (S. 83)
90. Jean-Jacques Rousseau (1712-78) Die Einzelperson (‚la personne particulière‘) wird zur Gemeinschafts-Person (‚personne publique‘) und damit zur Rechtsperson dadurch, dass sie zunächst alle ihre Rechte an den Souverän, den Gemeinwillen, abtritt, der seinerseits im Gegenzug, d.h. sozusagen als Gegenleistung (‚équivalent‘), jeder Person sämtliche Rechte und damit die größtmögliche Freiheit garantiert. (S. 83)
91. Im Unterschied zu Voltaire zählt Rousseau auch Kultur und Wissenschaft innerhalb einer fehlgeleiteten, im Argen liegenden Gesellschaft zu den Quellen möglicher Schädigung. (S. 84)
92. Es steht fest, dass Rousseau zeitlebens durch und durch naturverbunden war und stets eine auf „vernünftiger Natürlichkeit“ aufbauende Lebensweise empfohlen hat. (ebd.)
93. Von höchst nachhaltiger Wirkung war seine Politische Philosophie in Verbindung mit seiner neuen Wert-Bestimmung der „unveräußerlichen Person“. (ebd.)
94. Kants Menschenbild. Wenn die Menschen frei geboren sind und es auch bleiben sollen, ist zu fragen, warum so viele im Laufe ihres Lebens – innerlich und/oder äußerlich – unfrei werden. Was zumindest nahelegt, über den Begriff Freiheit immer wieder neu nachzudenken, wozu Kant Hilfe bieten kann. (S. 85)
95. Als Person hat der Mensch seinen Zweck in sich selbst, kann sich daher selbst-bestimmt Ziele setzen und Werte verwirklichen. Wobei Kant einen der höchsten Werte darin sieht, moralisch objektiv korrekt zu handeln. (S. 86)
96. Gut wird der gute Wille bei Kant schon durch das Wollen des Guten, nicht erst durch gutes Handeln. Der gute Wille ist Voraussetzung für Moralität, nicht schon selbst die Moralität, die das gute Handeln ermöglicht. (ebd.)
97. Offensichtlich erhebt Kant den Pflicht-Bezug zum Kriterium für jegliche moralische Verbindlichkeit und entwickelt daraus seinen Kategorischen (d.h. unbedingt gültigen) Imperativ. (S. 87)
98. Kurioserweise lässt sich der Kategorische Imperativ nur in seiner "personalistischen" Fassung (der Zweckformel) neu begründen lässt, und zwar dann – und wahrscheinlich nur dann –, wenn man diesen Leitsatz aus seiner Einbettung in das Gesamtsystem der Kantschen Pflicht- und Sollensethik herauslöst. (S. 88)
99. Verbindlichkeit ist dann nicht mehr kantisch "vernünftelnd" zu definieren, sondern – nicht zuletzt im Hinblick auf die Mittlerfunktionen der Gefühle – als Unveräußerlichkeit des Eigenwerts und Selbstzwecks der Person, Unantastbarkeit der Menschenwürde, Menschenfreundlichkeit, Entgegenkommen, Wohlwollen, Konzilianz und Kompromissbereitschaft. (ebd.)
100. Die Toleranz-Idee bei Voltaire, Lessing, Goethe u.a. Wenn Toleranz repressiv, d.h. unduldsam wird, schlägt sie in Intoleranz um und hebt sich auf. (ebd .)
101. Unfreiheit und Toleranz sind jedenfalls nicht miteinander vereinbar, zumal Toleranz als ein Wert gelten kann, ohne den die Grundfreiheiten keinen Bestand haben, und zwar nicht nur die Freiheit des Glaubens und des Gewissens, die Bekenntnis-, Kultus- und Religionsfreiheit, sondern auch, wie ich meine, die Freiheit der Person, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit. (S. 88)
102. Voltaire: „Was ist Toleranz? Toleranz ist die Mitgift der Humanität. Wir alle sind voller Schwächen und Irrtümer: Vergeben wir uns gegenseitig unsere Dumm-heiten! – dies sei das erste Gesetz der Natur.“ (S. 89)
103. Goethe will, dass der Mensch in seinem Person-Sein respektiert und anerkannt wird, was er auch in seinen literarischen Werken immer wieder exemplarisch dar-gestellt und betont hat. (S. 90)
104. La Rochefoucauld (1613-80): „Nous avons tous assez de force pour tolérer les maux d’autrui.” (‘Wir haben alle genügend Kraft, um die Übel der anderen zu ertragen’.) (S. 91)
105. Bloßes Ertragen bedeutet noch keine Anerkennung der Person. Aber ohne Ertragen gibt es keine Anerkennung. Woraus folgt, dass wir den Mitmenschen in seiner Personalität anerkennen sollen, nämlich u.a. als Rechtsperson und als natur- und geistbestimmtes gesellschaftliches Wesen. (S. 91 f.)
106. Zum Humanitäts-Ideal des Deutschen Idealismus Friedrich Schiller (1759-1805) fordert einen ästhetischen Vernunft-Staat und sieht in der Kunst geeignete Mittel zu dessen Verwirklichung. Sein und Schein, Geist und Natur, Pflicht und Neigung soll der Mensch allmählich in Einklang bringen. (S. 92)
107. „ der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“, sagt Schiller. (ebd.)
108. Und in dem „Reich des ästhetischen Scheins“ werde sogar das „ Ideal der Gleichheit “ verwirklicht. (ebd.)
109. Leider konnte diese schöne Utopie bisher nirgendwo verwirklicht werden. Unklar scheint mir die Rolle des Staates. Auch ein ästhetischer Staat der Gleichen ist immer noch ein Staat! Aber braucht man ihn noch, wenn alle Menschen „gleich“ sind? (ebd.)
110. Ältestes Systemprogramms des deutschen Idealismus (1796 oder 1797): „ jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.“ (S. 93)
111. In der Ästhetik geht Schelling ähnlich weit wie Schiller, wobei er allerdings die Kunst höher stellt als alles andere. (S. 94)
112. Hegel: Philosophie entwickele sich dialektisch aus Kunst und Religion, und zwar schon als Kunstphilosophie (Ästhetik) und Religionsphilosophie. In seiner Ästhetik stellt Hegel eine weitere Hierarchie dar, und zwar eine Rangfolge der Künste, in der er der Dichtkunst den obersten Platz zuweist. – Philosophie aber übertrage außerdem Glauben in Wissen – „absolutes Wissen“ und „absoluten Geist“. (S. 94)
113. Der Neuhumanismus von Wilhelm von Humboldt (1767-1835) Für Humboldt war Bildung eine eigengesetzliche und selbstzweckliche Form des Geistes. Sie besteht in der harmonischen Entfaltung der menschlichen Kräfte zu einem Ganzen, zu der universalen, totalen und individuellen Einheit. (S. 96)
114. Zum Menschenbild der Romantik Tätigkeit, Traum, Sehnsucht, Liebe, Unend-lichkeit, Geheimnis, Ewigkeit – sie erweisen sich als Grundbegriffe, Grund- Werte der Hardenbergschen Romantik. (S. 99)
115. Vieles deutet darauf hin, dass die Romantiker/innen sich poetische Luft-schlösser bauen, um ihre eigene politische Resignation und Ohnmacht zu überspielen. (S. 100)
116. Atheistischer und sozialistischer Humanismus: von Marx zu Bloch. Karl Marx (1818-1883) entwickelt seine humanistischen Anschauungen u.a. in einer Auseinan-dersetzung mit der naturalistischen Anthropologie von Ludwig Feuerbach (1804-1872). (S. 101)
117. Marx: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“ Dem entspricht Marxens Humanismus im Ganzen, den er auch als Synthese aus Humanismus und Naturalismus bezeichnet. (S. 102)
118. Marx: „Also die Gesellschaft ist die vollendete Wesenseinheit des Menschen mit der Natur, die wahre Resurrektion der Natur, der durchgeführte Naturalismus des Menschen und der durchgeführte Humanismus der Natur.“ (S. 103)
119. Ernst Bloch (1885-1977) Aufrechter Gang, gelehrte Hoffnung, konkrete Utopie. Wir genießen das Privileg des Aufrecht-Gehens, und dass unsere Hoffnungen gelehrt, unsere Utopien konkret sein können. (ebd.)
120. Bloch: Die Materie – konzipiert als „unvollendete Entelechie“ – liegt allem Mensch-Sein zu Grunde: „Jedenfalls bildet das Leibliche die Unterlage, und kein Tanz geht vor dem Essen. Ein Geist für sich und nichts als Geist, ganz ohne Stoff, ist noch nie gewesen. Das sogenannte Unten wirkt mit, und was sich sozusagen darüber hebt, kommt nie nur aus sich selber.“ (S. 104)
121. Bloch unterscheidet zwischen Tagträumen und Nachtträumen. Tagträume können sogar der Weltverbesserung dienen, werden zuweilen von Nachtträumen ab- und aufgelöst – und haben doch „das bessere Teil erwählt“, zumal als Bausteine des antizipierenden Bewusstseins; dies auf Grund der „Entdeckung des Noch-Nicht-Bewußten oder der Dämmerung nach vorwärts“.(S. 106)
122. „Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglich-keiten.“ (ebd.)
123. Auch und gerade im realistischen Kunstwerk zeigt der/die Künstler/in Meisterschaft im freien Umgang mit den Stoffen, d.h. in einer einzigartigen Freiheit, in der sich so etwas wie die Utopie der Nicht-Entfremdung verwirklicht. (S. 107)
124. Ob es allerdings gelingen kann, die von der Kunst ausgehenden positiven Impulse in gesellschaftliche Realität zu verwandeln, hängt nicht von der Kunst, sondern einzig und allein von der Gesellschaft im Ganzen ab. (S. 109)
125. Die Vermutung „hypothetisches Natursubjekt“ bedeutet nicht, es handele sich um etwas völlig Irreales. (S. 111)
126. Bloch: „Ein nicht ausbeutendes Verhalten zur Natur wurde schon der objektiv-realen Möglichkeit nach bedeutet als befreundete, konkrete Allianztechnik, die sich in Einklang zu bringen versucht mit dem hypothetischen Natursubjekt.“ (ebd.)
127. Naturallianz und soziale Revolution sind Aufgaben, vor die Bloch die gesamte Menschheit gestellt sieht. (S. 112)
128. Das „Haus des Seins“ ist nicht einfach nur die Sprache, sondern das unfertige Haus der ‚humanitas‘, das noch nicht vollendet, noch erst zu vervollständigen und vollständig zu errin-gen ist: das unentfremdete, gänzlich demokratische Reich der Freiheit, die freie Assoziation freier Individuen, die allesamt ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen gemäß leben und arbeiten können. (S. 114)
129. Blochs Humanismus könnte in zwei Punkten in Frage gestellt werden, und zwar 1. in Bezug auf den Leninismus, 2. bezüglich von ‚Atheismus im Christentum‘ (1968) (ebd.).
130. Einen Grund für Blochs Ansinnen sehe ich mittlerweile vor allem in politisch-taktischen Erwägungen. Wie sollte man den schon durch Marx und Lenin atheistisch geprägten Kommunismus in einer Gesellschaft propagieren können, die noch weitgehend christlich geprägt war? (S. 114 f.) Andere Konzepte 132
131. Personalismus. Der Personalist Emmanuel Mounier (1905-1950 ) lehnt – im Unterschied zu den Pragmatisten – den Marxismus nicht rundweg ab, sondern versucht, ihn kritisch aufzuarbeiten und zu beerben. (S. 115)
132. Mouniers Gegenmodell: Im Mittelpunkt steht der Mensch als Person, nicht das Kapital. Statt der Herrschaft des Finanzkapitals (incl. Börsenspekulation): Arbeiter-kontrolle, „industrielle Demokratie“, Partizipation, „Verantwortlichkeit“ jeder Einzel-person. (S. 116)
133. Kritik am Personalismus: Für Personalisten ist die Person ein „von Gott gewolltes Wesen“. Diese Annahme ist jedoch nicht überprüfbar, weil die Existenz Gottes bekanntlich nicht nachweisbar ist. (ebd.)
134. Schon aus diesem Grunde kann es die von Mounier angestrebte Synthese aus Christentum und Kommunismus nicht ohne Weiteres geben, zumal das Christentum zwar eine der Grundlagen des Personalismus ist, nicht jedoch integraler Bestandteil des Kommunismus seit Marx und Engels, die den Atheismus predigten.(ebd.)
135. Personalität beruht auf dem Zusammenwirken von Materie, Psyche und Geist im Menschen. Eine Philosophie der Person müsste daher den Dialektischen Materialismus einbeziehen, zumal dieser auch der „Geistbestimmtheit“ der Person gerecht zu werden vermag. Eine solche Synthese gibt es aber bisher anscheinend nicht. (S. 117)
136. Sartres Humanismus: existenzialistisch? marxistisch? anarchistisch? Wie Heidegger geht Sartre vom „Dasein“ (oder „In-der-Welt-sein“) als der eigentlichen, ursprünglichen Seinsweise des Menschen als Subjekt aus. (S. 118)
137. Sartre umschifft die Gefahr des Solipsismus, der reinen Selbst-Bezüglichkeit, und schafft die Basis für seine Auffassung, wonach der Existenzialismus ein Huma-nismus sei. (ebd.)
138. 1960 in der Critique de la raison dialectique (CRD, der ‚Kritik der dialek-tischen Vernunft‘), in der er zum Marxismus übergeht, ohne den Existenzialismus – und insbesondere dessen Freiheitsbegriff – gänzlich aufzugeben, bezeichnet Sartre den Marxismus nunmehr als „die unüberholbare Philosophie unserer Zeit“. (S. 119)
139. „Seit 1972 bezeichnete sich Sartre als dem antihierarchisch-libertären Lager zugehörig.“ (S. 120)
140. Sartre: „Der Sinn einer anarchistischen Gesellschaft liegt darin, daß in ihr kein Mensch irgendeine Macht über einen anderen Menschen besitzt, jedoch sehr wohl Macht auf die Objekt-Welt, die Dinge ausübt.“ (S. 123)
141. Tatsache ist allerdings, dass Sartre schon die naturbedingten Grenzen der Frei-heit nicht oder zu wenig berücksichtigt. Er versteht den Menschen vor allem als handelndes Kulturwesen, nicht aber auch als teilweise determiniertes Naturwesen. (S. 126)
142. Albert Camus (1913-60). Sartre gilt als „nordisch“, Camus als „mittel-meerisch“. Aber das ist Holzschnitt, Schwarz-Weiß-Malerei. (ebd.)
143. Camus würdigt das Absurde, leugnet den Sinn – und findet doch den Sinn des Lebens: im Leben selbst. (ebd.)
144. » Das rechte Maß, das den Verführungen absoluter Weltanschauungen ent-gegentritt, sieht Camus im mittelmeerischen Denken manifestiert.« (S. 127)
145. »Camus sieht im Denken Marx‘ die Vermischung einer wissenschaftlichen Methode zur Kritik des herrschenden Kapitalismus mit einem auf die Zukunft gerichteten „utopischen Messianismus“«. (ebd.)
146. Vor teutonischem Übermut und Größenwahn will Camus uns schützen durch die mittelmeerischen Tugenden des Maßes, der Naturverbundenheit und Leichtigkeit, durch hellenische Klugheit und Heiterkeit, französischen Esprit und Savoir-vivre, kurzum: durch Lebenskunst. (S. 129)
147. Humanistik mit dem Untertitel „Beiträge zum Humanismus“ lautet die Über-schrift eines 2012 erschienenen Sammelbandes mit Aufsätzen zum Thema. (S. 130)
148. Themenkreise: 1. (antihumanistische) Kritik, 2. Selbstkritik, 3. Humanismus-forschung, 4. gegen Faschismus und NS-Ideologie, 5. „Weltanschauungspflege“. (ebd.)
149. Julian Nida-Rümelin (geb. 1954), im Folgenden abgekürzt als: N.-R., gewinnt seinen erneuerten Humanismusbegriff nicht zuletzt aus einer Kritik am natura-listischen Reduktionismus. (S. 132) Die Grundpfeiler hierfür sind „Humanistische Anthropologie“ und „Humanistische Semantik“. (S. 134)
150. Erotischer Humanismus. Intensiv behandelt N.-R. das Thema, und zwar in Zusammenarbeit mit der Kulturwissenschaftlerin Nathalie Weidenfeld (im Folgenden abkürzt als N.W.). (S. 136)
151. Bedauerlich ist es, dass N.-R. die Möglichkeit ignoriert, Menschenwürde, Freiheit, Ethik und Demokratie wissenschaftlich zu begründen; z.B.an Hand von Konstanten wie den angeborenen Anlagen zu Gut und Böse und der ebenfalls angeborenen Fähigkeit zur Willensfreiheit. (S. 144)
152. Unabdingbar: Digitalisierung und Anthropologie im KI-Zeitalter. N.-R. u. N.W. unterziehen die KI einer umfassenden Kritik, und zwar im Hinblick auf Themen wie Willensfreiheit, Uti-litarismus, Moral, Ethik, Verstehen, Denken und ChatGPT (S. 153)
153. N.-R. u. N.W.: „Der digitale Humanismus plädiert für eine instrumentelle Haltung gegenüber der Digitalisierung: Was kann ökonomisch, sozial und kulturell nutzen, und wo lauern Gefahren?“ (S. 156)
154. Der „Digitale Humanismus“, den N.-R. u. N.W. vortragen, wirkt anthropo-zentrisch, zumal beide Autoren heftig auf menschlicher Subjektivität und Bewusst-seins-Autonomie insistieren. Eher statisch wirkt dabei das Menschenbild, weil die Autoren von einer relativen Unveränderlichkeit der menschlichen Natur ausgehen, ohne jedoch den Umstand zu thematisieren, dass der Mensch nicht nur Natur-, sondern auch Kultur-Wesen ist. (S. 157)
155. Obwohl die Kritik der beiden Autoren umfassend zu sein scheint, fehlen in ihr zwei wesentliche Aspekte: 1. die Tatsache, dass KI in immer mehr Lebensbereichen immer mehr Menschen unbestreitbar gute Dienste leistet, 2. dass die KI global nach wie vor unreguliert, d.h. teilweise unkontrolliert ist. (S. 159)
156. Warum die beiden Autoren diese Aspekte ignoriert haben, ist mir ein Rätsel. Wie kann KI immer mehr Menschen eine echte, willkommene Hilfe sein, wenn sie grundsätzlich „anti-humanistisch“, also inhuman, menschenfeindlich ist? Tatsächlich beruht doch auch die KI auf menschlicher Arbeit. Dies betrifft sowohl die aufbereite-ten Informationen als auch die Programmierung der PC-Software. Was ist dann noch „künstlich“? (S. 158 f.)
Anthropologie für das KI-Zeitalter.
1. Wie schon erwähnt, sind die Fähigkeit zur Willensfreiheit und zur Unterscheidung von Gut und Böse dem Menschen angeboren, ein Erbteil aus dem Tierreich. (S. 159)
2. Anders steht es mit dem Selbst des Menschen. Joachim Bauer weist auf, dass das Selbst – anders als Nietzsche es vermeinte – nicht mit dem Leib identisch, d.h. nicht angeboren ist, sondern erst durch zwischenmenschliche Beziehungen im Säuglings-alter zu entstehen beginnt: (ebd.)
3. Das Selbst ist nicht einfach der Leib, sondern ein Gemisch, ein mixtum compositum, aus dem personalen Individuum – als Einheit aus Leib, Seele und Geist –, seinen Be- zugspersonen, seiner Umwelt und der Gesamtheit seiner Erfahrungen. (S. 160)
4. Zum Tier-Mensch- Vergleich. Der Mensch ist Tier – aber nur im biologischen Sinne, auch wenn der Mensch sich vom Tier durch den aufrechten Gang unterscheidet. Was den Menschen zum Menschen macht, ist zunächst die einzigartige Einheit von Körper, Seele und Geist, die er verwirklicht, zumal in Seele und Geist die deutlichsten Unterscheidungsmerkmale zu finden sind. (S. 161)
5. Als Subjekt ist der Mensch in der Lage, sowohl situationsgemäß als auch situations-unabhängig zu erleben, zu denken und zu handeln. Hierzu ist kein Tier fähig. Dagegen geht im Menschen das Tier zum Menschen über, wird das Tierische in das Mensch-liche integriert – oder zumindest integrierbar. (ebd.)
6. Zum Bewusstseins-Problem. Seit Hegels Phänomenologie ist bekannt, wie sich das Bewusstsein im Menschen konstituiert. (ebd.)
7. Das Selbstbewusstsein impliziert die Anerkennung des (Selbst-)Bewusstseins aller Mitmenschen als Rechtspersonen. (S. 161 f.)
8. Die dialektischen Subjekt-Objekt-Beziehungen ermöglichen es, das bewusste Sein in ge-wusstes Sein zu transformieren und im Gedächtnis zu speichern, so dass Bewusstes und Unbewusstes eine untrennbare, kompakte Einheit in wechselseitiger Assistenz und positiver Affirmation bilden. (S. 162)
9. Eine neue politische Perspektive ergibt sich aus einem von J. Bauer nicht erwähnten Aspekt des Selbst-Systems: Da dieses zur Ich-Findung, Selbst-Fürsorge und Fürsorge für andere Menschen befähigt, hat das Individuum – das personale Selbst – einen Rechtsanspruch auf Selbstbestimmung, und zwar auch deshalb, weil der Mensch das einzige Wesen ist, „das sich an der Konstruktion seiner selbst – und seines Selbst“ beteiligt bzw. beteiligen kann, soll und muss. (S. 162)
10. Politisch besagt dies: Demokratie bedeutet nicht nur „Herrschaft des Volkes für das Volk und durch das Volk“, sondern auch Selbstbestimmung des Volkes. (ebd.)
11. Demgemäß erstrebenswert erscheint eine Mischung aus direkter und repräsentativer Demokratie, weil in beiden Formen – und erst recht in ihrer Kombination und effektiver Kooperation – sowohl das Gemeinwohl als auch die Rechte der Einzel-personen gewahrt werden. (ebd.)
12. Allerdings: Weder mit Liebe noch mit Demokratie allein oder zusammen können sämtliche akuten und latenten Welt-Probleme gelöst werden. Hierzu bedarf es weiterer Anstrengungen – nicht nur ethischer, sondern vor allem auch politischer Natur. (ebd.)
13. Anthropologie und KI: wachsende Bedeutung der KI in Wirtschaft und Gesellschaft. Genetik und Entwicklungspsychologie erweisen sich als Grundpfeiler der Anthropologie. Bis hin zur Entstehung des Bewusstseins – und darüber hinaus – lassen sich die Stadien der ontogenetischen Entwicklung des Menschen wissen-schaftlich analysieren. (ebd.)
14. Nicht zu verkennen ist, dass Microsoft mit dem KI-Chat-Programm ‚Microsoft-Copilot‘ neuerdings ein echter Durchbruch gelungen ist, der nahezu überall von Bedeutung ist. So auch in Philosophie und Wissenschaft, ermöglicht doch dieses Chat-Programm sogar eine neue Lösung des Induktions-Problems. (S. 164)
15. Zu bedenken ist außerdem, dass jegliche KI auf menschlicher, d.h. nicht-künstlicher Arbeit beruht; dies sowohl hinsichtlich der aufbereiteten Informationen als auch der Programmierung der PC-Software und der Herstellung der Hardware. (ebd.)
16. Aber: Der Kapitalismus hat nicht nur die Öko-Krise, sondern auch die – bislang ebenfalls ungelöste – Soziale Frage verursacht. Beide Probleme parallel oder zusammen zu lösen, scheint im Kapitalismus unmöglich zu sein. Hauptgrund: Mehr als umfassende Information – zweifellos eine großartige Errungenschaft! – kann KI nicht anbieten. (S. 165)
17. Um durchgreifende Veränderungen herbeizuführen, bedarf es sowohl einer Veränderungs-Ethik (Ernst Bloch) als auch umfassender Systemkritik und -verän-derung. (S. 165 f.)
18. Sich gegen das kapitalistische System aufzulehnen, ist mit Ethik und Moral allein nicht möglich. Dazu bedarf es vielmehr politischer Gegenwehr mit langem Atem, zumal dann, wenn weder ein „revolutionäres Subjekt“ noch ein entsprechendes Klassen-Bewusstsein vorhanden ist. (S. 166)
19. Dem entspricht jedenfalls mein Modell eines Demokratischen Ökosozialismus, das ich schon mehrfach (insbesondere o.J. (2021), aber auch schon 2015, 2017 und 2020 im GRIN-Verlag München) veröffentlicht habe. Es geht darin vor allem um allgemeine kulturelle und politische Emanzipation, neue, sozialistische Formen einer digital gestützten Wirtschaftsplanung, direkte Demokratie, Marktsozialismus und Wirt-schaftsdemokratie. (S. 167)
20. Kritische Würdigung und Fazit. In dem Wikipedia-Artikel Gesetz über künstliche Intelligenz findet sich eine Diskussion des EU-AI-Acts, die mutatis mutandis teilweise auch auf die USA und China bezogen werden kann. (ebd.)
21. Aber: Weder der US-amerikanische Nietzsche-Kult und -Hype noch R. Kurzweils „Singularitäts“-Phantastereien noch die monströse „Symbiose“ von Mensch und Technik werden analysiert. Die Gefahr einer Selbstauslöschung der Menschheit durch KI wird ignoriert. (S.168)
22. Gravierend kommt hinzu, dass bisher anscheinend in keinem einzigen Gesetzes-Vorhaben die Tatsache erwähnt wird, dass die KI-„Singularität“ das Ende aller Bemühungen um sinnvolle Alternativen zum Bestehenden, d.h. zum globalisierten Neo-Liberalismus, bedeuten würde. An die Stelle eines Reichs der Freiheit würde eine hochexplosive, nicht funktionstüchtige „Symbiose“ von Menschen und Robotern treten. (ebd.)
23. Um die negativen Auswirkungen der schwachen und starken (generativen) KI wirksam zu bekämpfen, werden nationale Gesetze nicht ausreichen. Vielmehr bedarf es verbindlicher, internationaler Vereinbarungen, z.B. auf UN-Ebene. (ebd.)
24. Dies hat auch Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, bereits erkannt. Angesichts der existenziellen Bedrohung der Menschheit durch KI kritisierte er die Macht von Großunternehmen und -Staaten, von denen die Menschenrechte missachtet werden. In einem Positionspapier der UNO stellte er Vorschläge zum weltweiten Umgang mit KI vor und kündigte die Einrichtung entsprechender hochrangiger Beratergremien und die Gründung einer UN - Regulierungsbehörde an. Kaum einen Monat später nahm der UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine Resolution an, in der Schutz- und Kontrollmaßnahmen zur KI beschlossen wurden. Die Transparenz entsprechender Systeme soll gefördert werden, speziell zur Verwendung der für die KI-Technologie benutzten Daten, die „auf menschenrechtskonforme Weise gesam-melt, verwendet, weitergegeben, archiviert und gelöscht werden“ sollen. Die Resolu-tion wurde im Juli 2023 einvernehmlich angenommen. (S. 168 f.)
Literaturhinweise:
Bauer, Joachim 2019: Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, München
Beierlein, Hannes 2014: “Ist künstliche Intelligenz schon im Jahre 2045 möglich?“ www.cancom.info/2014/12/ist-künstliche...
Beuth, Patrick 2013: „Google Glass. Die Anti-Cyborgs“, www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-03/stop-the-cyborgs-google-glass/komplettansicht
Bloch, Ernst 1959: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M.
Bloch, Ernst 1977 (1935): Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt a.M.
Changeux, Jean-Pierre 1984: Der neuronale Mensch, Reinbek
Coseriu, Eugenio 1981: Textlinguistik, Tübingen
Cysarz, Herbert 1948: Das seiende Sein. Geistes- und gesamtwissenschaftliche Letztfragen, Wien
Groschopp, Horst (Hrsg.) 2012: Humanistik. Beiträge zum Humanismus, Aschaffenburg
Habermann, Ernst 1996: Evolution und Ethik. Skeptische Gedanken eines Ethik-Kom-missars, in: www.geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9705/pdf/GU1996_S?9_38...
Hartmann, Nicolai 1965 (1934): Grundlegung der Ontologie, Berlin
Heidegger, Martin 1977 (1956): Zur Seinsfrage, Frankfurt a.M.
Heidegger, Martin 1981 (1947): Über den Humanismus, Frankfurt a.M.
Kiefer, Markus 2015, in: Studie: Unser Wille ist freier als gedacht (2015), https://www.derstandard.at/story/2000011387060/studie-unser-wille
Klatt, Robert 2022: Künstliche Intelligenz wird den Menschen auslöschen, in: https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/kuenstliche-intelligenz-wird-den-mens.
Krobath, Hermann T. 2011: Werte in den Weltreligionen, in: ders. (Hg.): Werte in der Begegnung, Würzburg
Küng, Hans 1999: Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg, München/Zürich
Kurzweil, Ray 2005: The Singularity is Near, London
Kurzweil, Ray 2014: Das Geheimnis des menschlichen Denkens. Einblicke in das Reverse Engineering des Gehirns, Berlin
Kurzweil, Ray 2024: Die nächste Stufe der Evolution. Wenn Mensch und Maschine eins werden, München
Libet, Benjamin 2005: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt a.M.
Mounier, Emmanuel 1961/62: Oeuvres, tomes I et II, Paris 1961, tomes III et IV, Paris 1962
Müsse, Hans G.: Humanismus, in: Platon heute, https://platon-heute.de/index.html
Nida-Rümelin, Julian 2016: Humanistische Reflexionen, Berlin
Nida-Rümelin, Julian / Weidenfeld, Nathalie 2022: Erotischer Humanismus. Zur Philoso-phie der Geschlechterbeziehung, München
Nida-Rümelin, Julian / Weidenfeld, Nathalie 2023: „ Was kann und darf künstliche Intelligenz? “ Ein Plädoyer für Digitalen Humanismus, München
Nietzsche, Friedrich 1973: Werke in zwei Bänden, München
Robra, Klaus 2003: Und weil der Mensch Person ist Person-Begriff und Personalismus im Zeitalter der (Welt-) Krisen, Essen
Robra, Klaus 2015: Wege zum Sinn, Hamburg
Robra, Klaus 2017: Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demokratischen Öko-Sozialismus, München, http://www.grin.com/document/375344
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus 2022: Das „verkommene“ Subjekt. Hypokeimenon, Cogito, Übermensch? Grundlegung einer Subjekt-Objekt-Philosophie, München, https://www.grin.com/document/ 1183185
Robra, Klaus 2024: Christliche Grundlagen der Demokratie. Ist Jesus ein Demokrat? München, https://www.grin.com/document/1466935
Robra, Klaus 2024 a): Über Freiheit, Demokratie und Recht in ihrem wechselseitigen Verhältnis. Zum Freiheitsbegriff von Angela Merkel, München, https://www.grin.com/document/1553785
Robra, Klaus 2024 b): Warum sollte der Staat „absterben“? Staatsphilosophien und historische Wirklichkeiten, München, https://www.grin.com/document/1506909
Robra, Klaus 2024 c): Was ist der Mensch im KI-Zeitalter? Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert, München, https://www.grin.com/document/1525673
Schulz, Walter 1992: Subjektivität im nachmetaphysischen Zeitalter. Aufsätze, Pfullingen
Störig, Hans-Joachim 1961: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart
Sturma, Dieter (Hrsg.) 2012: Vernunft und Freiheit. Zur praktischen Philosophie von Julian Nida-Rümelin, Berlin/Boston
Transhumanismus, https://www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-diemenschheit
[...]
1 Dazu passt die Tatsache, dass Nietzsche gelegentlich Sympathie für Jesus und seine Lehre erkennen lässt, so in Der Antichrist, Nr. 32, 34 und 35. Einige Kritiker sehen in Nietzsche nicht nur einen Gottesleugner, sondern auch einen (verzweifelnden) Gottsucher.
2 In: Nietzsche 1973, Bd. II, S. 511
3 Nietzsche, in: Gerhardt, Gerd: Grundkurs Philosophie Band 2, Ethik, Politik, München 1992, S. 81
4 Vgl. K. Robra: Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München o.J., https://www.grin.com/document/923015, S. 134 f. Darin auch Näheres zu Nietzsches Begriff „Redlichkeit“ und seiner „Ethik der Stärke“ (S. 135 f.)
5 Vgl. N. Hartmann 1965, S. 40 f., s. auch Robra 2022, S. 143 f.
6 H. G. Müsse, in: Humanismus, in: Platon heute, https://platon-heute.de/index.html, S. 27
7 Vgl. Heidegger 1977, S. 19, 31; s. auch K. Robra: ‚Martin Heidegger und die Technik‘, München 2021, https://www.grin.com/document/1038195
8 H. G. Müsse, in: Humanismus, in: Platon heute, https://platon-heute.de/index.html
9 U. J. Schneider, in: https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A12750/attachment/ATT-0/
10 Vgl. Changeux 1984, S. 163 ff.
11 Vgl. Robra 2015, S. 482 ff.
12 Näheres hierzu bei K. Robra: Ist das Christentum am Ende? https://www.grin.com/document/1246983, S. 84 ff.
13 aus: Langenscheidts Taschenwörterbuch Lateinisch-Deutsch , Berlin 1956
14 Heidegger 1981, S. 12
15 Nida-Rümelin 2016, S. 214
16 In: https://www.gutefrage.net/frage/zitat-von-heraklit-erklaert
17 https://wiki.yoga-vidya.de/Heraklit#Gott
18 https://www.helpster.de/das-menschenbild-bei-platon-wissenswertes_137546
19 https://www.helpster.de/aristoteles-menschenbild-einfach-erklaert-so-verstehen-sie-die-philosophische-sicht_130905
20 Aristoteles: Nikomachische Ethik, Hamburg 1995, S. 247
21 Vgl. Robra 2015, S. 27 ff.
22 Schmidt/ Schischkoff a.a.O.
23 Vgl. Epikur: Schriften, München o.J., S. 66
24 Ebd., S. 68
25 Lukrez: Von der Natur der Dinge (‚De natura rerum‘), Frankfurt a.M. 1960, I, S. 71
26 A.a.O. IV, S. 1153 f. Zu Epikur und Lukrez: vgl. K. Robra: Philosophie und Gesellschaftskritik bei Molière, Tübingen 1969, S. 43-45
27 Vgl. hierzu und zu dem Folgenden: Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkhard, Franz Wiedmann: dtv-Atlas Philosophie, München 2007, S. 57
28 Vgl. Robra 2015, S. 35-37
29 Vgl. hierzu dtv-Atlas Philosophie a.a.O. S. 61 und Jan Rohls: Geschichte der Ethik, Tübingen 1999
30 Zitiert in: dtv-Atlas Philosophie a.a.O.
31 Vgl. Robra 2015, S. 37-39
32 Küng 1999, S. 7
33 Vgl. Zwi Braun: Die Zehn Gebote, http://www.hagalil.com/judentum/torah/parasha/jitro-2.htm, S. 1-3
34 Vgl. Hermann T. Krobath: Werte in den Weltreligionen, in: ders. (Hg.): Werte in der Begegnung, Würzburg 2011, S. 557-559
35 Vgl. Robra 2015, S. 148 ff.
36 Vgl. Hans Joachim Störig: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart 1961, S. 45
37Dharma – Yogawiki, in: http://wiki.yoga-vidya.de/index.php?title=Dharma&printable=yes, S. 1
38 Vgl. Robra 215, S. 155 ff.
39 Klaus Robra: Und weil der Mensch Person ist, Essen 2003, S. 31
40 Vgl. Robra 2015, S. 42 ff.
41 Vgl. Bernhard Priesmeier: Der Islam – Eine Einführung, http://www.haus-der-weltreligionen.de/html/islam.html, S. 3
42 Priesmeier a.a.O. S. 4
43 Vgl. Aleviten – Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Aleviten, S. 4, 6
44 Frieder Otto Wolf: Ohne islamische Philosophie: weder Scholastik noch Aufklärung, http://sammelpunkt.philo.at:8080/739/1/wolf_islam.pdf Vgl. Robra 2015, S. 151 ff.
45 Vgl. Robra 2017, S. 111 f.
46 In: https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/geschichte-der-antike-demokrit
47 Reinhard Neck, in: www.researchgate.net › publication › 332981187_Karl_Poppers
48 Kant: Kritik der praktischen Vernunft (1787), Hamburg 1967, S. 149 f.
49 Otfried Höffe: Praktische Philosophie. Das Modell des Aristoteles, München 1971, S. 41 f.
50 In: https://www.deutschlandfunk.de/epikur-auf-dem-weg-in-die-sanatoriumsgesellschaft-100.html
51 In: https://www.philosophie-wissenschaft-kontroversen.de/suche.php?volltext=VsEpikur
52 In: https://philosophie-indebate.de/pro-und-contra-irrte-platon-mit-seiner-kritik-an-der-sophisten/
53 In: https://ichi.pro/de/24-haufige-kritik-am-stoizismus-und-einige-antworten-37974158586458
54 In: https://www.philomag.de/lexikon/skeptizismus
55 Näheres und Ausführlicheres hierzu in: Robra 2024
56 Augustinus: De civitate dei, zitiert in: dtv-Atlas Philsosophie, S. 71
57 Ernst Bloch: Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, Frankfurt a.M., S. 175
58 Vgl. Robra 2015, S. 175 f.
59 In: https://renaissance-sciodoo.de/italien/
60 In: Manfred Hardt: Geschichte der italienischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Darmstadt 1996, S. 47 bzw. S. 50
61 Vgl . Warum ist Giotto so wichtig? (Artikel aus ‚P. M.‘), www.pm.magazin.de/r/gute-frage/warum-ist-giotto-so-wichtig, S. 1
62 August Buck: Die Kultur Italiens, Frankfurt a.M. 1964, S. 57
63 Vgl. Robra 2015, S. 175 f.
64 Johannes Haller: Dante. Dichter und Mensch, Basel 1954, S. 216 f., 223, 232
65 Vgl. Natalino Sapegno: Compendio di storia della letteratura italiana, vol. I, Firenze 1963, S. 155
66 In: https://renaissance-sciodoo.de/italien/
67 In: https://www.evangelium21.net/media/790/erasmus-vs.-luther-vom-unfreien-willen
68 Vgl. Dominik Perler: René Descartes, München 1998, S. 213
69 Descartes: Les Principes de la Philosophie, in: Oeuvres et lettres (ed. par André Bridoux), Paris 1953, S. 601
70 Vgl. Fritjof Capra: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, Bern 1983, S. 55-62, 232
71 Vgl. Ferdinand Alquié: La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris 1950, S. 346
72 Vgl. ders. a.a.O. S. 299
73 Vgl. Robra 2015, S. 178 ff.
74 Vgl. Robra 2015, S. 250-252, 258 f.
75 Vgl. Robra 2015, S. 261 ff.
76 M. Lausberg in: http://www.michaellausberg.de/index.php?menue=exclusiv&inhalt=humboldt_neuhumanismus
77 In: Nationalökonomie und Philosophie (1844), in: Karl Marx: Frühe Schriften, I. Band, Hrsg. Hans-Joachim Lieber und Peter Furth, Darmstadt 1962, S. 639
78 Vgl. Robra 2015, S. 273 f., dort auch Näheres und Weiteres auf den S. 270-279. Ausführlich auch in: K. Robra: Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München o.J. (2021), https://www.grin.com/document/ 1032082
79 Marx, in: Bloch 1959, S. 1604
80 E. Bloch: Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, Frankfurt a.M. 1972/1985, S. 377
81 Bloch, in: Geist der Utopie, 2. Fassung (1923), Frankfurt a.M. 1977, S. 346 bzw. 266
82 Z.B. Libet 2005, Kiefer 2015
83Das Prinzip Hoffnung, S. 248
84 Ebd. S. 249
85 In: Ernst Bloch: Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, Frankfurt a.M. 1977, S. 200
86 Ebd. S. 201
87 Zitiert in: Das Prinzip Hoffnung a.a.O. S. 806
88 F.W.J. Schelling: Einleitung zu einem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, in: Ausgewählte Schriften Bd.I, hrsg. v. Manfred Frank, Frankfurt a.M., S. 352
89Das Prinzip Hoffnung, a.a.O. S. 810
90Das Prinzip Hoffnung, a.a.O. S. 802
91 Ebd. S. 813
92 Vgl. Ernst Bloch: Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, Frankfurt a.M. 1977, S. 562
93 Vgl. Robra 2015, S. 441 ff.
94 Vgl. Mounier 1961/62, Bd. III, S. 614
95 Robra 2003, S. 107
96 Vgl. ders. ebd.
97 Näheres hierzu bei Robra a.a.O. S. 109 ff.
98 Oder gar als „Person der Personen“ (Scheler).
99 Robra 2003, S. 169
100 Sartre in: https://de.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99existentialisme_est_un_humanisme#8._Cogito_ergo_sum, S. 1
101 Vgl. Robra 2015, S. 308 ff.; dort auch Näheres zur CRD und zu Sartres politischem Engagement
102 In: http://docs.sartre.ch/Anarchist.pdf
103 In: https://sartre.ch/anarchie-und-moral
104 In: http://docs.sartre.ch/Anarchist.pdf
105 Dem entspricht Sartres Vorliebe für alles Künstliche, ähnlich wie bei Charles Baudelaire, der für aus Metall gefertigte künstliche Pflanzen und Bäume schwärmte.
106 D. Mares: Der Bruch zwischen Sartre und Camus, in: http://www.holtmann-mares.de/Bruch.htm (Erstveröffentlichung in: ‚französisch heute‘ 26, 1995, S. 38-51.)
107 Nida-Rümelin 2016, S. 160
108 Näheres hierzu in: J. Nida-Rümelin: Philosophie einer humanen Bildung, Aschaffenburg 2012
109 Vgl. Julian Nida-Rümelin / Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus, München 2018, S. 188-197
110 Julian Nida-Rümelin / Nathalie Weidenfeld 2022
111 In: Sturma 2012, S. 219
112 Gerhardt, in: Sturma 2012, S. 202 f.
113 Vgl. Habermann 1996, Libet 2005, Kiefer 2015, Robra 2024 a)
114 Beierlein 2014, S. 1
115Transhumanismus S. 8 (s. Literaturverzeichnis!)
116 Beuth 2013, S. 1
117 Vgl. Wikipedia 2016, S. 1-2, sowie Kurzweil 2014, S. 35-74
118 Kurzweil 2005, S. 487
119 vgl. Weisbuch 1989, S. 193
120 Vgl. Robra 2017, S. 129 ff.
121 In: https://www.tagesspiegel.de/kultur/vom-aufstieg-der-superintelligenz-ray-kurzweils-ki-prophezeiungen-12745448.html
122 Vgl. file:///C:/Users/klaus/Downloads/Nida-R%C3%BCmelin,%20Karl%20Marx.pdf
123 Klatt 2022, S. 2
124 Näheres hierzu in: Robra o.J. (2020), S. 304 f.
125 In: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_k%C3%BCnstl...
126 UNO-Generalsekretär Guterres für Regulierungsbehörde zu KI (2023) , https://www.deutschlandfunk.de/generalsekretaer-guterres-fuer-regu...
127 UNO-Menschenrechtsrat-Resolution zu Kontrolle von KI angenommen (2023),https://www.deutsch-landfunk.de/resolution-zu-kontrolle-von-ki-an.. Vgl. Robra 2024 c)
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2024, Vom Humanismus zum Trans- und Posthumanismus im KI-Zeitalter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1570033