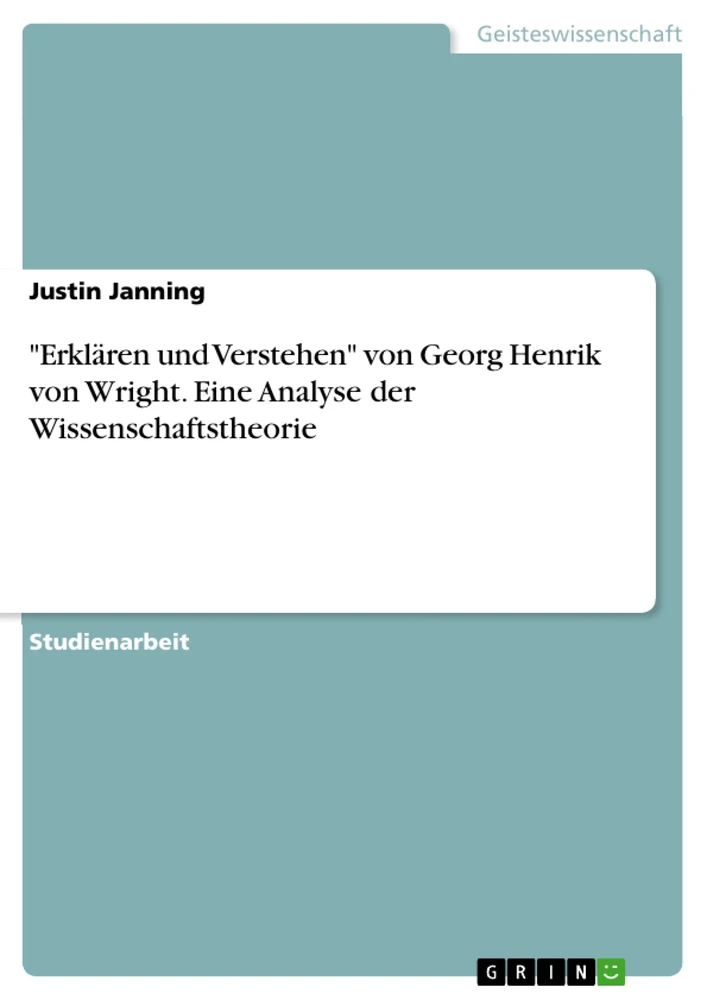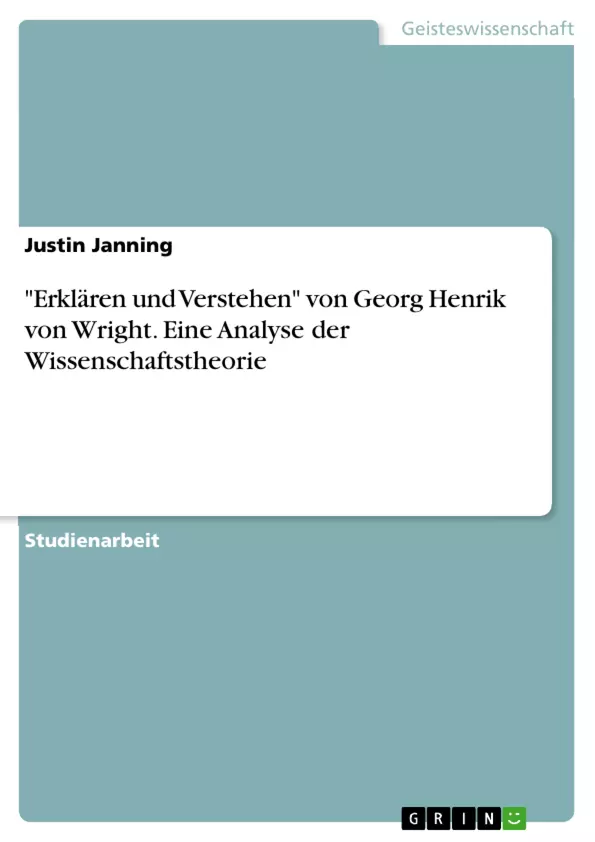Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, das Buch "Erklären und Verstehen" von Georg Henrik von Wright einer genaueren Begutachtung zu unterziehen. Speziell soll es dabei um das erste von vier Kapiteln, mit dem Titel "Zwei Traditionen" gehen.
Der Gedankengang Wrights soll nachvollziehbar skizziert und seine Ausführungen, soweit es notwendig erscheint, referiert werden.
Welche Grundannahmen trifft der Autor? Wie werden diese gefestigt und zu welchem Ergebnis wird er gelangen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Zwei Traditionen
- 3. Der Positivismus
- 4. Die Hermeneutik
- 5. Die Analytische Philosophie
- 6. Das covering-law Modell
- 6.1 Das deduktiv-nomologische Schema
- 6.2 Das induktiv-probabilistische Schema
- 7. Die Fragen nach der Kausalität
- 7.1 Kausalerklärungen
- 7.2 Kausalgesetze
- 8. Das Verhältnis zu Handlungen
- 9. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Georg Henrik von Wrights Buch "Erklären und Verstehen", insbesondere den Abschnitt "Zwei Traditionen". Ziel ist es, Wrights Gedankengang nachzuvollziehen, seine Grundannahmen zu identifizieren und sein Ergebnis zu präsentieren.
- Die Unterscheidung zwischen deskriptiver und theoretischer Wissenschaft
- Der Vergleich der wissenschaftlichen Methoden in Natur- und Humanwissenschaften
- Die aristotelische (teleologisch-finalistische) und die galileische (kausal-mechanistische) Tradition
- Der Positivismus als Ansatz zur Klärung des Verhältnisses zwischen Natur- und Humanwissenschaften
- Die Hermeneutik als alternativer Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung skizziert das Ziel der Arbeit: eine detaillierte Analyse des Buches "Erklären und Verstehen" von Georg Henrik von Wright, wobei der Schwerpunkt auf dem Kapitel "Zwei Traditionen" liegt. Es wird angekündigt, Wrights Argumentationslinie nachzuzeichnen und seine Ausführungen zu referieren, seine Grundannahmen zu untersuchen und sein Ergebnis zu ermitteln.
2. Die Zwei Traditionen: Wright gliedert die wissenschaftliche Forschung in deskriptive (Feststellung von Tatsachen) und theoretische Wissenschaft (Konstruktion von Hypothesen und Theorien). Er erkennt jedoch Überschneidungen und oberflächliche Unterscheidungen in diesen Definitionen, insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Perspektive. Im Anschluss untersucht er die Unterschiede in der Theoriebildung zwischen Naturwissenschaften und Human- und Sozialwissenschaften. Die zentrale These des Kapitels ist die Unterscheidung zwischen der aristotelischen (teleologisch-finalistisch) und der galileischen (kausal-mechanistisch) Tradition wissenschaftlicher Forschung. Wright konzentriert sich im Folgenden auf die galileische Tradition.
3. Der Positivismus: Dieses Kapitel behandelt den Positivismus als einen Ansatz zur Klärung des Verhältnisses zwischen Natur- und Humanwissenschaften. Drei Grundannahmen des Positivismus werden vorgestellt: methodologischer Monismus (Einheit der wissenschaftlichen Methodik), ein methodologisches Ideal (Maßstab für Natur- und Humanwissenschaften), und die Kausalität wissenschaftlicher Erklärungen (im Gegensatz zum Finalismus). Der Positivismus wird als ein möglicher, aber nicht der einzige, Weg zur Vereinbarkeit der Methoden beider Wissenschaftszweige präsentiert.
4. Die Hermeneutik: Als Gegenpol zum Positivismus wird die Hermeneutik vorgestellt. Auch hier werden drei Grundannahmen erläutert: Verwerfung des methodologischen Monismus, methodologische Dichotomie von "Erklären" und "Verstehen" mit der Zuordnung zu Natur- bzw. Humanwissenschaften, und die Einführung des Verstehens mit seinen Attributen des psychologischen Verstehens und der Intentionalität (Verstehen von Zielen und Absichten). Die Diskussion über die unterschiedlichen Methoden führt zur Berücksichtigung der Sozial- und Verhaltenswissenschaften.
5. Die Analytische Philosophie: Dieses Kapitel behandelt den Aufstieg und Fall des Positivismus und seinen erneuten Aufstieg im Kontext der Popularität der Logik. Der genaue Inhalt dieses Kapitels ist aufgrund der beschränkten Textauszüge nicht vollständig rekonstruierbar. Es wird lediglich erwähnt, dass dieses Kapitel die Entwicklung und den Einfluss der Analytischen Philosophie auf die Debatte um die Methoden in den Natur- und Humanwissenschaften behandelt.
Schlüsselwörter
Erklären, Verstehen, Georg Henrik von Wright, Positivismus, Hermeneutik, methodologischer Monismus, methodologische Dichotomie, Kausalität, Finalismus, Naturwissenschaften, Humanwissenschaften, wissenschaftliche Methode, Teleologie, Mechanismus, Analytische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Georg Henrik von Wrights "Erklären und Verstehen" (Kapitel "Zwei Traditionen")?
Die Arbeit analysiert Georg Henrik von Wrights Buch "Erklären und Verstehen", insbesondere das Kapitel "Zwei Traditionen". Es geht um Wrights Unterscheidung zwischen der aristotelischen (teleologisch-finalistisch) und der galileischen (kausal-mechanistisch) Tradition wissenschaftlicher Forschung, sowie um den Vergleich von Methoden in Natur- und Humanwissenschaften.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Themenschwerpunkte umfassen die Unterscheidung zwischen deskriptiver und theoretischer Wissenschaft, den Vergleich wissenschaftlicher Methoden in Natur- und Humanwissenschaften, die aristotelische und galileische Tradition, den Positivismus als Ansatz zur Klärung des Verhältnisses zwischen den Wissenschaften, und die Hermeneutik als alternative Herangehensweise.
Welche Grundannahmen des Positivismus werden vorgestellt?
Drei Grundannahmen des Positivismus werden erläutert: methodologischer Monismus (Einheit der wissenschaftlichen Methodik), ein methodologisches Ideal (Maßstab für Natur- und Humanwissenschaften), und die Kausalität wissenschaftlicher Erklärungen (im Gegensatz zum Finalismus).
Wie wird die Hermeneutik als Gegenpol zum Positivismus charakterisiert?
Die Hermeneutik wird durch drei Grundannahmen beschrieben: Verwerfung des methodologischen Monismus, methodologische Dichotomie von "Erklären" und "Verstehen" (Zuordnung zu Natur- bzw. Humanwissenschaften), und die Einführung des Verstehens mit Attributen des psychologischen Verstehens und der Intentionalität.
Was behandelt das Kapitel über die Analytische Philosophie?
Das Kapitel behandelt den Aufstieg und Fall des Positivismus und seinen erneuten Aufstieg im Kontext der Popularität der Logik, sowie die Entwicklung und den Einfluss der Analytischen Philosophie auf die Debatte um die Methoden in den Natur- und Humanwissenschaften.
Was sind die Schlüsselwörter im Zusammenhang mit der Thematik?
Schlüsselwörter sind unter anderem: Erklären, Verstehen, Georg Henrik von Wright, Positivismus, Hermeneutik, methodologischer Monismus, methodologische Dichotomie, Kausalität, Finalismus, Naturwissenschaften, Humanwissenschaften, wissenschaftliche Methode, Teleologie, Mechanismus, Analytische Philosophie.
Was ist der Unterschied zwischen der aristotelischen und der galileischen Tradition?
Die aristotelische Tradition ist teleologisch-finalistisch, d.h. sie erklärt Phänomene durch ihren Zweck oder ihr Ziel. Die galileische Tradition ist kausal-mechanistisch, d.h. sie erklärt Phänomene durch ihre Ursachen und Mechanismen.
Was ist das Ziel der Analyse des Buches "Erklären und Verstehen"?
Ziel ist es, Georg Henrik von Wrights Gedankengang nachzuvollziehen, seine Grundannahmen zu identifizieren und sein Ergebnis zu präsentieren.
Was ist das covering-law Modell?
Das covering-law Modell wird im Buch "Erklären und Verstehen" behandelt und besteht aus zwei Schemata: dem deduktiv-nomologischen Schema und dem induktiv-probabilistischen Schema. Die genaue Erklärung dieser Schemata ist in den gegebenen Textauszügen nicht detailliert beschrieben.
Was sind Kausalerklärungen und Kausalgesetze?
Die Fragen nach der Kausalität in "Erklären und Verstehen" beziehen sich auf Kausalerklärungen und Kausalgesetze. Kausalerklärungen geben die Ursachen für ein bestimmtes Ereignis an, während Kausalgesetze allgemeine Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung beschreiben.
- Arbeit zitieren
- Justin Janning (Autor:in), 2017, "Erklären und Verstehen" von Georg Henrik von Wright. Eine Analyse der Wissenschaftstheorie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1566355