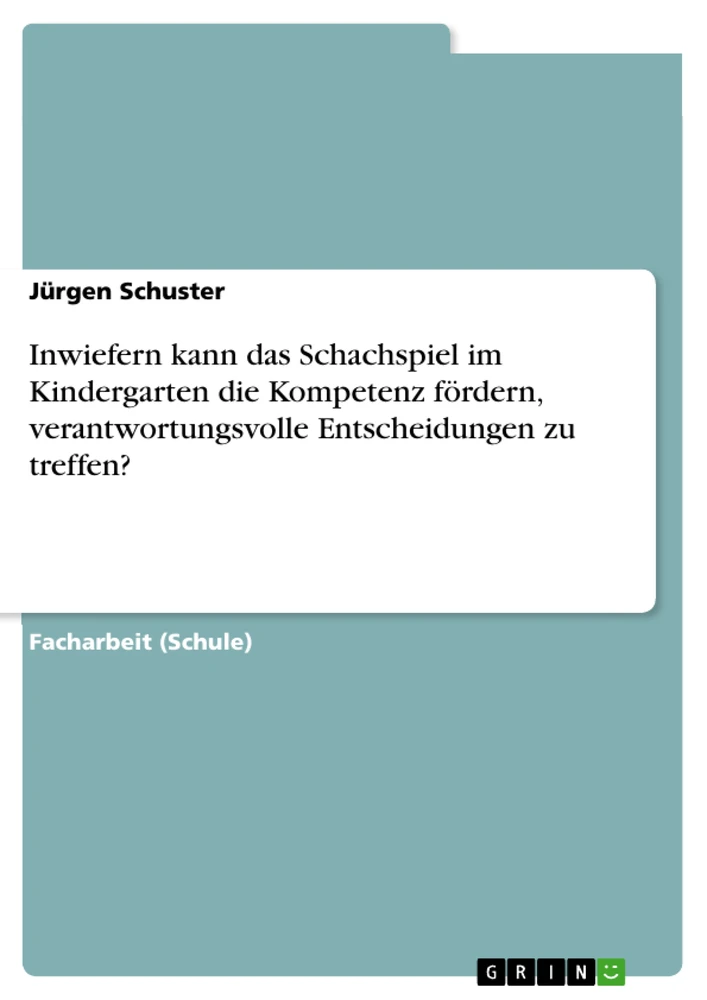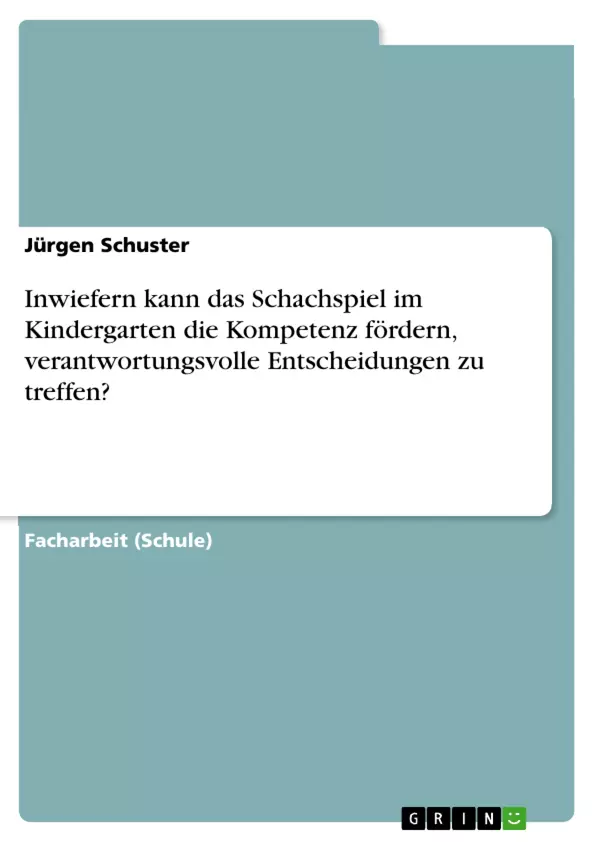Diese Hausarbeit wurde im Fach "Wissenschaftliches Arbeiten" im Rahmen der schulischen Erzieher-Ausbildung angefertigt. Sie diente als Vorbereitung auf die Facharbeit.
Als ehemaliger Schachspieler arbeitete ich im ersten Ausbildungsjahr schachpädagogisch mit Kindern von 4 - 6 Jahren.
Diese Praxiserfahrungen sind Grundlage der vorliegenden Arbeit. Diese soll der Einführung des Schachspiels in sozialpädagogische Zusammenhänge dienen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Schachspiel im Kindergarten
3. Sozial-emotionale Kompetenzen
4. Verantwortungsvolle Entscheidungen treffen
4.1. Die Fähigkeit zu konstruktiven Entscheidungen im persönlichen Verhalten
4.2. Die Fähigkeit zu respektvollen Entscheidungen im persönlichen Verhalten
4.3. Die Fähigkeit zu konstruktiven Entscheidungen in sozialen Interaktionen
4.4. Die Fähigkeit zu respektvollen Entscheidungen in sozialen Interaktionen
5. Fazit
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Vom 01.05.2008 bis 31.10.2009 wurde in Nordrhein-Westfalen die wissenschaftliche Studie „Schach für Kids“ durchgeführt. Das Pilotprojekt bezog rund 500 Kindergartenkinder mit ein und befasste sich unter anderem mit der Frage, ob Schach die Entwicklung von Kindergartenkindern fördere (vgl. Bönsch-Kauke/Schreiber, 2013, S.17 und 38).
Im ersten Schulhalbjahr 2020/21 führte der Autor 3-6-Jährige im evangelischen Kindergarten Karlsruhe-Kirchfeld („KiGa Kirchfeld“)[1] an das Schachspiel heran.
Die praxisbezogenen Ausführungen dieser Arbeit fußen daher auf der genannten Primärliteratur und persönliche Erfahrungen.
Gegenstand dieser Arbeit ist allgemein die soziale Entwicklung von Kindergartenkindern, aus dem sich unter Auswahl einer speziellen Kompetenz das Thema ableitet.
Denn in einschlägigen Fachbüchern finden sich viele verschiedene Kompetenzen, die die soziale Entwicklung positiv beeinflussen.
Um den Rahmen bezüglich des Seitenumfangs nicht zu sprengen, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Kompetenz „Verantwortungsvolle Entscheidungen treffen“.
Die Bedeutung des Themas dieser Arbeit liegt darin, dass das Schachspiel als Mittel zur Förderung der genannten Kompetenz vorgestellt wird, obwohl es noch eine Randerscheinung in der Kindergartenpraxis ist.
Im Hauptteil werden kurz einige Aspekte des Schachspiels und dann dessen Auswirkung auf die genannte Kompetenz abgehandelt.
Bei den verwendeten personenbezogenen Substantiven sind stets alle Geschlechter gemeint.
2. Das Schachspiel im Kindergarten
Schach ist ein Brettspiel für zwei Personen, die abwechselnd mit den weißen beziehungsweise schwarzen Steinen ziehen. Der Angriff auf den König mittels eines Schachgebots muss abgewehrt werden. Ist dies nicht mehr möglich, ist der König „matt“ gesetzt und die andere Person hat gewonnen.
Normalerweise werden Schachzüge kommentarlos ausgeführt. Daher kommen die Aussprüche „Schach“ und „Matt“ bei einem Schachgebot oder der Mattsetzung dem Bedürfnis von Kindergartenkindern entgegen, sich auch verbal auszudrücken.
1 Abkürzung: „KiGa Kirchfeld“ = „evangelischer Kindergarten Karlsruhe-Kirchfeld“
Ähnliches gilt für die Bauernverwandlung bei Erreichen der letzten Reihe:
Da sich der Bauer in Springer, Läufer, Turm oder Dame verwandeln darf, eignet sich die Formulierung „Ich wünsche mir…“ dazu, Kindern Freude zu bereiten und dem Schachspiel höhere Akzeptanz im Kindergartenalltag zu verleihen.
Eine weitere Möglichkeit, kindgemäß an das Schach heranzuführen, besteht in der separaten Betrachtung der Gangarten einzelner Figuren. So kann den Kindergartenkindern mit Verweis auf die Tierwelt das Pferd vorgestellt werden, das „springt“; daher die Bezeichnung „Springer“.
Da das Schachspiel sehr wenig vom Zufall und sehr viel vom Können der Spielenden abhängt, lassen sich Unterschiede in der Spielstärke schnell ausmachen. Daher wird in dieser Arbeit mitunter von „schwächeren“ und „stärkeren“ Schachspielern die Rede sein.
Neben Sieg und Niederlage besteht bezüglich des Spielergebnisses die Möglichkeit einer Punkteteilung („Remis“ – beide Spieler bekommen einen halben Punkt). Dies ist ein wichtiges pädagogisches Moment! Denn so kann ein Spiel regelkonform zu Ende gehen, ohne dass es einen Gewinner oder Verlierer gibt. So führt beispielsweise neben der Pattstellung (ein Spieler hat keine regelgerechten Züge mehr zur Verfügung, ohne im Schach zu stehen) und der dreimaligen Stellungswiederholung eine entsprechende Vereinbarung der Spieler zum unentschiedenen Ausgang einer Schachpartie.
Die folgenden Anregungen und Beispiele wurzeln auch in der dem Schachspiel innewohnenden Dynamik, die sich nicht auf sportliche Aspekte beschränkt, sondern auch soziale Implikationen birgt:
Die Tatsache, dass pro Schachbrett zunächst nur zwei Spieler vorgesehen sind, eröffnet nicht nur Raum für individuelles, persönliches Verhalten, sondern auch für soziale Interaktionen:
Interessierte Kinder können sich beispielsweise auf die zur Verfügung stehenden Schachbretter verteilen, zuschauen, aber auch Beratungsgruppen bilden.
3. Sozial-emotionale Kompetenzen
„Gegenstand der Entwicklungspsychologie sind längerfristige, gerichtete Veränderungen des Erlebens und Verhaltens, die intraindividuell im Verlauf der Lebensspanne auftreten" (Jungbauer, 2012, S.10).
Betrachtet man diese Veränderungen vor dem Hintergrund des Zusammenlebens von Menschen, ergibt sich der Begriff der „sozialen Entwicklung“:
„Unter sozialer Entwicklung versteht man in der Psychologie die Veränderungen eines Individuums im Hinblick auf andere Menschen oder Gruppen von Menschen im Lauf des Lebens“ (Stangl, 2021).
Damit diese Entwicklung positiv verläuft, sind bestimmte Kompetenzen notwendig:
Emotionale Kompetenz ist „die Fähigkeit, mit Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen – für sich allein und im Zusammensein mit anderen“ (Pfeffer, 2019, S. 9). Für Prof. Simone Pfeffer setzt auf dieser Grundlage die soziale Kompetenz auf. Diese ist bezüglich der Wahrnehmung von und dem Umgang mit gegenseitigen Befindlichkeiten und Bedürfnissen im Zusammensein mit anderen von Achtsamkeit geprägt (vgl. Pfeffer, 2019, S.11/12).
Daraus leitet sie den Überbegriff „sozial-emotionale Kompetenzen“ ab (vgl. Pfeffer, 2019, S.15) und weitet ihn mit Verweis auf mehrere Autoren und Modelle inhaltlich aus.
Eine explizite Verknüpfung von sozial-emotionale Kompetenzen mit sozial-emotionalem Lernen stellt die „Collaborative für Acdamic, Social and Emotional Learning“ her:
“Social and emotional learning involves the processes of developing social and emotional competencies in children“ (CASEL, 2013, S. 9).
Eine sozial-emotionale Kompetenz aus dem „2013 CASEL Guide“ soll nun als Beispiel für die durch das Schachspiel induzierten Lernprozesse durchdekliniert werden:
4. Verantwortungsvolle Entscheidungen treffen
“Responsible decision making: The ability to make constructive and respectful choices about personal behavior and social interactions based on consideration of ethical standards, safety concerns, social norms, the realistic evaluation of consequences of various actions, and the well-being of self and others” (CASEL, 2013, S. 9).
Folgende englische Begriffe dieser Definition sollen vor allem in den unten skizzierten Bedeutungen betrachtet werden:
„constructive“ := aufbauend, schaffend
„choices“ := Wahlen, Entscheidungen
„personal behaviour“ := individuelles Verhalten
„social interactions“ := soziale Wechselwirkungen inklusive Kommunikation
„evaluation“ := Bewertung
4.1. Die Fähigkeit zu konstruktiven Entscheidungen im persönlichen Verhalten
Eine konstruktive Wahl persönlichen Verhaltens unter Berücksichtigung ethischer Standards ist zunächst die Befolgung der Regeln.
Damit die Schachpartie konstruktiv und fair verlaufen kann, sind die Gangart der Figuren sowie die Möglichkeiten, einem Schachgebot oder dem Matt zu entgehen, reglementiert.
Im KiGa Kirchfeld war eine Spannung zu spüren zwischen dem ernsthaften Bemühen, regelgerechte Züge auszuführen und dem Wunsch, einfach einmal eine Figur des Gegners zu schlagen.
Soziale Normen können bei der konstruktiven Wahl persönlichen Verhaltens beispielsweise folgendermaßen bedacht werden:
Da Schach Ruhe und Konzentration erfordert, darf der Spielpartner nicht gestört werden.
Insofern sind Schachspieler zu diszipliniertem, ruhigem Verhalten angehalten. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass im Kindergarten nicht mehr so wild gespielt wird (vgl. Bönsch-Kauke/Schreiber, 2013, S. 148). Dies wiederum fördert das Wohlbefinden alter Beteiligten.
Eine konstruktive Wahl persönlichen Verhaltens bei realistischer Bewertung der Konsequenzen verschiedener Aktionen kann sowohl die Schachpartie selbst, als auch das gesamte Setting betreffen:
Wie in Kapitel 2 erläutert, kann der unentschiedene Ausgang einer Schachpartie frei vereinbart werden. Dies ist eine verantwortungsvolle Entscheidung mit verschiedenen Konsequenzen.
So können Kindergartenkinder mit Rücksicht auf ihre begrenzte Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit in etwa ausgeglichener Stellung ein Remis vereinbaren, um ihres Wohlbefindens willen.
Der schwächere Spieler kann die Überlegenheit des Gegners anerkennen, indem er frühzeitig ein Remis anbietet. Damit schätzt er die möglichen Folgen des Verzichts auf ein Remisangebot realistisch ein, nämlich die Gefahr des Partieverlusts.
Im KiGa Kirchfeld nahmen die Kinder eine entsprechende Stellungsbeurteilung anhand der Anzahl der auf dem Brett verbliebenen Figuren vor.
Berücksichtigt man das Setting, ergibt sich für die Kindergartenkinder Entwicklungspotential bezüglich der realistischen Bewertung der Konsequenzen der aktiven Gestaltung der Spielatmosphäre:
Die Kinder des Kindergartens Kirchfeld lernen ihrem Empfinden Ausdruck zu verleihen, dass es ihnen im Gruppenraum zu laut ist. Diese Fähigkeit kann beim Schach ausgebaut werden, indem andere Kinder gebeten werden, um der Konzentration der Spieler willen leise zu sein (vgl. Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.148).
Die Fähigkeit zur konstruktiven Wahl persönlichen Verhaltens zum eigenen Wohl und dem anderer kann bedeuten, dass der stärkere Spieler nach mehreren Siegen davon absieht, verbissen immer auf Sieg zu spielen.
So kann er etwa frühzeitig in ein Remis einwilligen, seinen Spielpartner auf einen Fehler hinweisen oder ihm im Gegensatz zu Wettkampfbedingungen erlauben, den letzten Zug zurückzunehmen.
Dadurch kann er zum Wohlbefinden des Spielpartners beitragen, indem er die Frustration über dessen ständige Niederlagen abmildert.
Andererseits können starke Schachspieler ihr eigenes Wohlbefinden steigern, indem sie ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Dies ist beispielsweise möglich, wenn eine Erzieherin besiegt wird (vgl. Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.190).
Konstruktiv ist es auch, wenn stärkere Spieler sich entscheiden, Außenseitern der Kindergruppe das Schachspiel beizubringen und so zu deren Integration und Wohlbefinden beizutragen.
Schwächere Spieler können anhand des Schachspiels ebenfalls die Fähigkeit entwickeln, konstruktive Entscheidungen das persönliche Verhalten betreffend zu ihrem eigenen Wohlbefinden zu fällen: Sie können sich dafür entscheiden, andere Kindergartenkinder oder Erzieherinnen um Hilfe zu bitten. Diese Hilfestellung kann das Verständnis der Schachregeln, einen guten Zug oder ganz einfach einen passenden Stuhl am Schachbrett betreffen.
Umgekehrt können sich schwächere Schachspieler gegen unerwünschte Ratschläge verwahren, um sich nicht bevormundet zu fühlen.
4.2. Die Fähigkeit zu respektvollen Entscheidungen im persönlichen Verhalten
Bezüglich ethischer Standards ist die Würde des Spielpartners zu beachten.
Der überlegene Spieler kann für diesen Empathie entwickeln, indem er ihm seine Schwächen nicht übermäßig vorhält. Ähnliches gilt für Zuschauer mit guten Schachkenntnissen. Einen schwachen Spieler überheblich auf einen Fehler hinzuweisen kann zu Spannungen führen, wenn sich dieser angegriffen fühlt.
Respektvoll wäre es hier, Verbesserungsvorschläge mit Rücksicht auf die Befindlichkeit eines Kindes vorsichtig vorzutragen – „nie in lautem Ton, sondern immer ruhig und sachlich“ (Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.183).
Respektvolle Entscheidungen persönlichen Verhaltens unter Berücksichtigung sozialer Normen können bei der Auswahl des Spielers reifen: Ein Spielpartner bemerkt etwa, dass ein zuschauendes Kind schon seit längerer Zeit einmal selbst spielen möchte. Aus Respekt vor dem Ausharren des Kindes kann ein Spieler nach Beendigung seiner Partie dieses an seiner Statt die nächste Partie spielen lassen.
Bei einer länger dauernden Partie ist es auch denkbar, dass ein Spieler einem Zuschauer anbietet, für ihn weiterzuspielen.
Umgekehrt kann die Fähigkeit zu respektvollen Entscheidungen auch in Zuschauern reifen, indem sie abwarten, nicht hineinrufen und sich auch nicht als nächsten Spielpartner aufdrängen.
Bezüglich der Wahl respektvollen persönlichen Verhaltens unter realistischer Einschätzung der Konsequenzen verschiedener Aktionen gibt es bei allen Beteiligten Entwicklungspotential:
Der schwächere Spieler kann lernen, eine Partie aufgeben, da er ohnehin am Verlieren ist, und seinen Platz am Schachbrett für ein anderes Kind räumen.
Der stärkere Spieler kann darauf verzichten lernen, eine Siegesserie fortzusetzen, und ein anderes Kind an seiner Statt spielen lassen, damit etwa die nächste Partie ausgeglichener verläuft.
Ein weiterer Aspekt ist das Einhalten eines minimalen Sicherheitsabstandes. Zusehende Kindergartenkinder können die Fähigkeit entwickeln, den Abstand zu den Spielpartnern so einzuschätzen, dass sie diese realistischerweise nicht stoßen und indirekt die Schachfiguren umwerfen können.
Wie kann Schach nun die Fähigkeit fördern, respektvolle Entscheidungen im persönlichen Verhalten bezüglich des eigenen Wohlbefindens und das der anderen zu treffen?
Zunächst ist hier an die Spielregeln zu denken:
Es ist nicht nur konstruktiv, sondern auch respektvoll, sich an die Spielregeln zu halten.
Denn so zollt man dem stärkeren Spieler Respekt für seine Leistung.
Dies gilt auch für die Aufgabe der Partie bei hoffnungsloser eigener Stellung.
Eine weitere mögliche respektvolle Entscheidung betrifft die eigenen Grenzen: Es dient dem Wohlbefinden, wenn das Kindergartenkind aufhört, wenn es erschöpft ist, und nicht auf Biegen und Brechen weiterspielt.
Zwar besteht für Erwachsene eine ethische Verpflichtung, eine begonnene Partie zu Ende zu spielen.
Doch ist das Schachspiel für diese Altersstufe so anstrengend, dass eine respektvolle Entscheidung darin bestehen kann, den Spielpartner aus einer laufenden Partie zu entlassen.
Dies dient dem Wohlbefinden des anderen.
4.3. Die Fähigkeit zu konstruktiven Entscheidungen in sozialen Interaktionen
Soziale Interaktionen im Schach ergeben sich zunächst aus dem abwechselnden Zugrecht beziehungsweise der abwechselnden Zugpflicht: Es ist ein Wechselspiel zwischen den beiden Spielpartnern.
Eine konstruktive Entscheidung in sozialen Interaktionen bezüglich ethischer Standards ist es, sich mit seinem Zug nicht zu viel Zeit zu lassen, um den Spielfluss nicht zu hemmen.
Denn ein gelingendes Spiel ist bereits ein Wert an sich.
Die Fähigkeit hierzu befördern die Dynamik des Schachspiels und das Interesse der Zuschauer.
Die Fähigkeit, in sozialen Interaktionen konstruktive Entscheidungen unter Berücksichtigung sozialer Normen zu treffen, kann beim Schach vielfältig entwickelt werden:
Die Zuschauer interagieren etwa unter Beachtung sozialer Normen, wenn sie den Spielpartnern keine voreiligen Ratschläge erteilen oder gar selbst einen Zug auf dem Brett ausführen.
Da die Selbstwirksamkeit der Kinder im KiGa Kirchfeld stark gefördert wird, pendelt sich das sozialverträgliche Maß an Einmischung durch die Zuschauer rasch ein.
Denn die Kinder sind es dort gewöhnt, Grenzen gegenüber anderen Kindern zu ziehen, die sich an einer laufenden Aktivität beteiligen möchten.
Die beiden Spieler können bei einer begrenzen Anzahl verfügbarer Bretter lernen, die Grenzen der Geduld der Zuschauer zu berücksichtigen: Auch diese wollen einmal spielen, und so können die Spieler lernen, ihre Partie nicht übermäßig auszudehnen, beziehungsweise nicht ständig eine neue zu beginnen, während andere warten.
Eine konstruktive Lösung bestünde hier in der Konstituierung von Beratergruppen: Alle sozialen Akteure verständigen sich auf die Aufteilung in zwei Gruppen, die sich bei jedem Zug beraten.
Eine weitere soziale Norm ist die Rücksichtnahme auf Schwache. Spieler und Zuschauer können es beispielweise lernen, am Schach interessierte, aber ängstliche Kinder zu ermutigen, es auch einmal zu probieren. Entsprechende konstruktive Entscheidungen in sozialen Interaktionen atmen den Gedanken der Inklusion.
Dies gilt auch für die Rücksichtnahme auf schwache Spieler. Alle anderen können an einer Atmosphäre des Wohlwollens und der Geduld arbeiten, die es einem Kindergartenkind ermöglicht, seine Fähigkeiten bezüglich des Schachspiels zu erproben und auszubauen.
Die realistische Bewertung der Konsequenzen verschiedener Aktionen in sozialen Interaktionen kann in folgenden möglichen konstruktiven Entscheidungen berücksichtigt werden:
Realistischerweise ist eine Schachpartie besonders spannend, wenn die Spielpartner etwa gleich stark spielen. Daher ist die entsprechende Auswahl eines Spielpartners eine konstruktive Entscheidung. So können auch Beziehungen zu Kindern geknüpft werden, mit denen die Kindergartenkinder sonst nicht spielen (vgl. Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.189 – 190).
Konstruktiv ist auch die Schaffung einer ruhigen Spielatmosphäre. Die Fähigkeit, unter Berücksichtigung des Wohlbefindens aller Beteiligten konstruktive Entscheidungen zu treffen, entfaltet sich durch vielfältige soziale Interaktionen:
Mögliche Spielpartner und Zuschauer lernen beispielsweise, gemeinsam einen geeigneten, ruhigen Ort zu suchen. Dabei können sich nicht nur Abstimmungsprozesse untereinander, sondern auch mit unbeteiligten Kindern entfalten.
Der gewählte Spielort tangiert auch den in der Definition der Kompetenz „Verantwortliche Entscheidungen treffen“ genannten Sicherheitsaspekt: ist der gewählte Tisch etwa zu klein, können Kinder auf heruntergefallenen Figuren ausrutschen.
Stehen im Fokus sozialer Interaktionen das Helfen, gegenseitige Unterstützen, Rollenwechsel und Partnertausch, werden diese prosozial und fördern eine Wohlfühlatmosphäre (vgl. Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.211).
Dann brennen die Kinder darauf, einander zu helfen (vgl. Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.212), dann besprechen sich spielerisch überlegene Kinder „sehr sozial und liebenswert mit den anderen…“ (Bönsch-Kauke/Schneider, 2013, S.213).
4.4. Die Fähigkeit zu respektvollen Entscheidungen in sozialen Interaktionen
Respektvolle Entscheidungen in sozialen Interaktionen unter Berücksichtigung ethischer Standards können sich auf die Gleichberechtigung der Menschen beziehen.
Kindergartenkinder können beispielsweise lernen, vom Alter und der Körpergröße anderen Kinder abzusehen, und ihnen gleiche Chancen eröffnen, je nach Bedarf aktiv Schach zu spielen oder zuzusehen. Soziale Interaktionen sind dann darauf ausgerichtet, jedem Kindergartenkind Raum für seine Präferenzen zu eröffnen.
Soziale Normen in sozialen Interaktionen mittels respektvoller Entscheidungen zu berücksichtigen bedeutet auch, kleineren Zuschauern nicht die Sicht zu versperren. So können größere Kinder lernen, kleineren den Vortritt zu lassen.
Die Spielpartner können lernen, eine verantwortliche Entscheidung bezüglich der Position des Schachspiels auf dem Tisch zu treffen, indem sie zum Beispiel die kleine Körpergröße anderer Kinder berücksichtigen.
Eine realistische Einschätzung der Konsequenzen verschiedener Aktionen in sozialen Interaktionen bei einer respektvollen Entscheidung zu berücksichtigen kann bedeuten, die zu Verfügung stehende Zeit der Freispielphase zu berücksichtigen: Ältere Kindergartenkinder können in sozialer Interaktion mit den Erzieherinnen klären, ob sich der Beginn einer Schachpartie noch lohnt. Denn in einer diesbezüglich getroffenen Entscheidung müsste Verantwortung für die Gefahr eines jähen Spielabbruchs durch die Erzieherinnen getragen werden.
In sozialen Interaktionen können die Spielpartner darin wachsen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, indem sie den Zuschauern kommunizieren, inwieweit sie mit diesen in Austausch treten möchten.
Oder sie ziehen eine Partie nicht unnötig in die Länge, wenn zu wenig Schachbretter verfügbar sind und bieten etwa zwei interessierten Zuschauern an, die nächste Partie auf dem Schachbrett spielen zu dürfen.
5. Fazit
Führt man Kindergartenkinder behutsam an das Schachspiel heran, kann dieses im Kindergarten etabliert werden.
Trotz kognitiver Herausforderungen werden dann soziale Entwicklungsprozesse ausgelöst.
Insbesondere kann das Schachspiel im Kindergarten die Kompetenz, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, fördern.
Dies wurde anhand der Kategorien „konstruktive / respektvolle Entscheidungen“ und „im individuellen Verhalten / in sozialen Interaktionen“ unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren und anhand von Praxisbeispielen ausgeführt.
Eine spannende Frage für weitere Betrachtungen wäre, inwiefern das Schachspiel auch andere sozial-emotionale Kompetenzen von Kindergartenkindern fördert. Dabei könnten die vier anderen im „2013 Casel Guide“ vorgestellten Kernkompetenzen in den Blick kommen, nämlich „Selbsterkenntnis“, „Selbstmanagement“, „Soziales Bewusstsein“ und „Beziehungsfertigkeiten“.
Sicherlich hat das Schachspiel bezüglich dieser Kompetenzen ebenfalls ein hohes Potential.
Bezüglich künftiger Studien zum Schachspiel im Kindergarten sollte die Auswahl geeigneter Beobachtungsformen reflektiert werden.
Soll die Untersuchung der möglichen positiven Effekte des Schachspiels auf die Kindergartenpraxis breiter angelegt werden, eignet sich dazu das Buch „Schach im Kindergarten“ von Bönsch-Kauke/Schreiber sehr gut.
6. Quellen und Literaturverzeichnis
Bönsch-Kauke M. / Schreiber R. (2013): Schach im Kindergarten. Ein pädagogisches Hilfsmittel zur Förderung der kindlichen Entwicklung. St. Goar.
CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) (2013): 2013 CASEL Guide. Effective Social and Emotional Learning Programs. Preschool and Elementary School Edition. Chicago.
Jungbauer, J. (2017): Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis sozialer Berufe. Weinheim.
Pfeffer, S. (2019): Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden. Freiburg im Breisgau.
Stangl, W. (2021): Soziale Entwicklung. Verfügbar unter http://lexikon.stangl.eu/5748/soziale-entwicklung. [abgerufen am: 18.02.2025].
[...]
- Quote paper
- Jürgen Schuster (Author), 2021, Inwiefern kann das Schachspiel im Kindergarten die Kompetenz fördern, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1561943