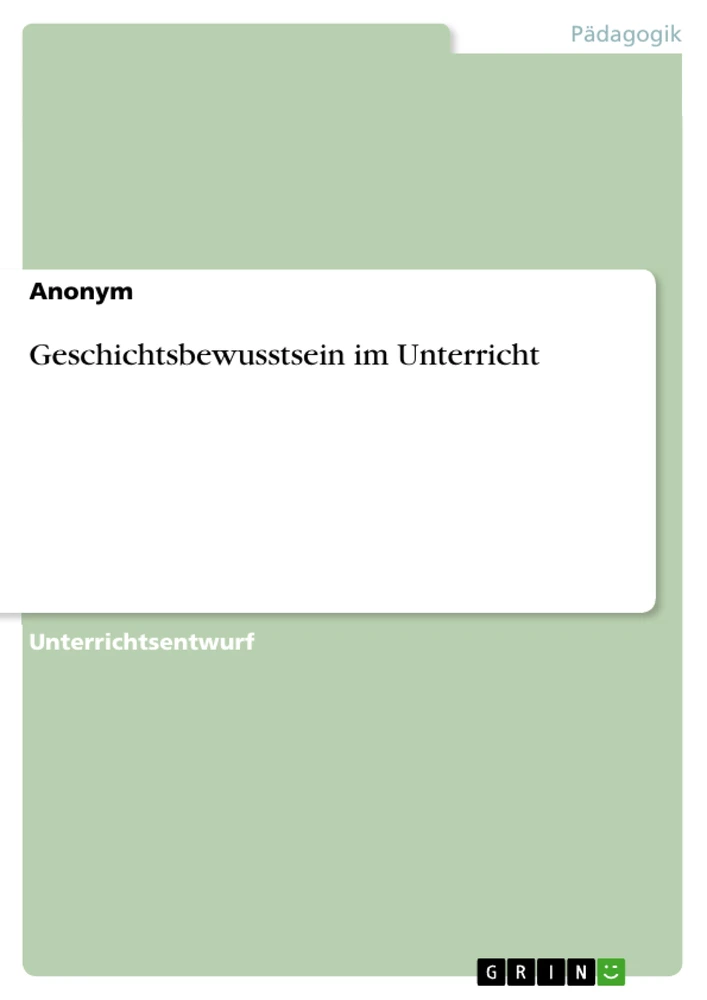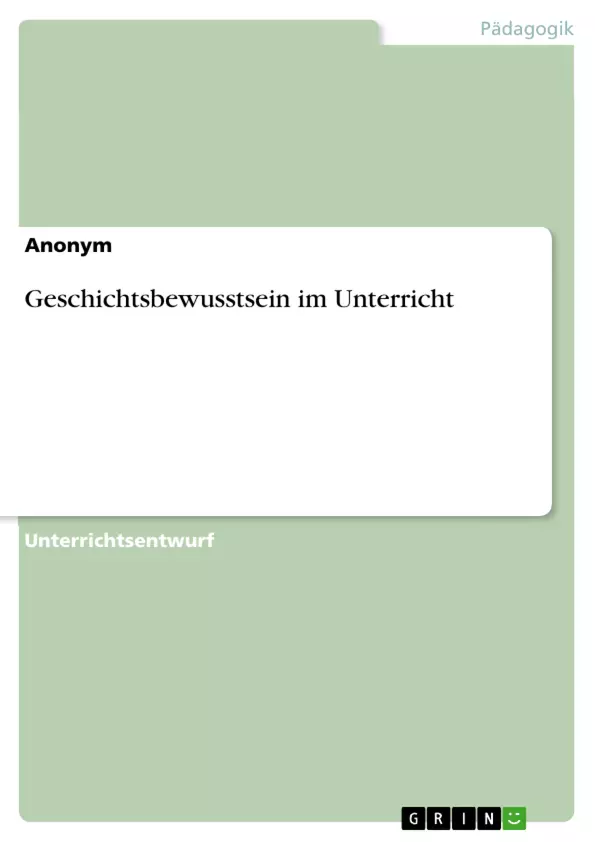Der Unterrichtsentwurf enthält eine Diskussion über Geschichtsbewusstsein im Unterricht und berücksichtigt dabei u.a. die Position Pendels. Anschließend liegt der Fokus insbesondere auf der Erarbeitung der Nürnberger Rassegesetze im Unterricht, wobei der gängige didaktische Dreischritt als Grundlage dient.
Bei dem Begriff des „Geschichtsbewusstseins“ handelt es sich seit Ende der 1960er Jahre um eine zentrale Begrifflichkeit der Geschichtsdidaktik. Seitdem bemüht sich die Geschichtsdidaktik darum, dass sowohl außerhalb des Geschichtsunterrichts, z.B. bei außerschulischen Lernorten, als auch in diesem selbst ein vollständiges, multiperspektivisches Geschichtsbewusstsein vermittelt wird.
Je nach Theoretiker kann das Konzept hinter dem Begriff des Geschichtsbewusstseins etwas variieren. Sehr populär ist beispielsweise die Position Pandels. Er geht davon aus, dass das Geschichtsbewusstsein sieben Doppelkategorien beinhaltet. Diese kann man unterteilen in die, welche durch die soziale Gesellschaft vermittelt werden; Identitäts-/Politisches-/Ökonomisch-soziales-/ und Moralbewusstsein. Letztere erfordert, dass die Ereignisse vor dem Kontext der Zeit betrachtet werden müssen und nicht lediglich nach heutigem Ermessen als akzeptabel oder verwerflich markiert werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtsbewusstsein im Unterricht
- Beispielhafte Unterrichtsstunde
- Sachanalyse
- Curriculare Legitimierung
- Didaktisch-methodischer Kommentar zur Grundlage der Stunde
- Verlaufsplan der Stunde
- Anhang
- Material
- Beispiele für antizipierte Schülerbeiträge zum Material
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Geschichtsbewusstseins im Geschichtsunterricht und analysiert dessen Bedeutung für die Vermittlung historischen Wissens. Ziel ist es, Jeismanns dreistufiges Modell des Geschichtsbewusstseins (Sachanalyse, Sachurteil, Werturteil) als praxistaugliches Konzept vorzustellen und dessen Bedeutung für die Entwicklung eines differenzierten Geschichtsverständnisses bei Schülern zu belegen. Die Arbeit berücksichtigt auch die Herausforderungen, die durch die mediale Verbreitung historischer Inhalte entstehen.
- Der Begriff des Geschichtsbewusstseins und dessen unterschiedliche theoretische Konzepte
- Jeismanns dreistufiges Modell zur Entwicklung des Geschichtsbewusstseins
- Die Bedeutung der Sachanalyse, des Sachurteils und des Werturteils im Geschichtsunterricht
- Herausforderungen durch die mediale Verbreitung historischer Inhalte
- Methodische Ansätze zur Förderung eines differenzierten Geschichtsverständnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Geschichtsbewusstsein im Unterricht: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff des Geschichtsbewusstseins, diskutiert verschiedene theoretische Ansätze, insbesondere die von Pandel und Jeismann, und hebt die Bedeutung eines multiperspektivischen und kritischen Umgangs mit historischen Deutungen hervor. Es betont die Notwendigkeit, Schüler*innen zu befähigen, verschiedene historische Interpretationen zu analysieren und zu bewerten, ohne dabei nach absoluten Wahrheiten zu suchen. Die Bedeutung von Kontextualisierung und der Reflexion eigener Werte und Vorurteile im Umgang mit Geschichte wird ebenfalls hervorgehoben. Die Kapitel unterstreicht die Herausforderungen der medialen Verbreitung historischer Informationen und deren Einfluss auf die Entwicklung eines differenzierten Geschichtsbewusstseins.
Schlüsselwörter
Geschichtsbewusstsein, Geschichtsdidaktik, Jeismann, Pandel, Sachanalyse, Sachurteil, Werturteil, historische Deutung, Medien, Multiperspektivität, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Geschichtsbewusstseins im Geschichtsunterricht und analysiert dessen Bedeutung für die Vermittlung historischen Wissens. Sie konzentriert sich auf Jeismanns dreistufiges Modell (Sachanalyse, Sachurteil, Werturteil) als Konzept für die Entwicklung eines differenzierten Geschichtsverständnisses bei Schülern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff des Geschichtsbewusstseins, verschiedene theoretische Konzepte, Jeismanns dreistufiges Modell, die Bedeutung von Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil im Geschichtsunterricht, Herausforderungen durch die mediale Verbreitung historischer Inhalte und methodische Ansätze zur Förderung eines differenzierten Geschichtsverständnisses.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Ziel ist es, Jeismanns dreistufiges Modell des Geschichtsbewusstseins als praxistaugliches Konzept vorzustellen und dessen Bedeutung für die Entwicklung eines differenzierten Geschichtsverständnisses bei Schülern zu belegen. Die Arbeit berücksichtigt auch die Herausforderungen, die durch die mediale Verbreitung historischer Inhalte entstehen.
Was beinhaltet das Kapitel "Geschichtsbewusstsein im Unterricht"?
Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff des Geschichtsbewusstseins, diskutiert verschiedene theoretische Ansätze, insbesondere die von Pandel und Jeismann, und hebt die Bedeutung eines multiperspektivischen und kritischen Umgangs mit historischen Deutungen hervor. Es betont die Notwendigkeit, Schüler*innen zu befähigen, verschiedene historische Interpretationen zu analysieren und zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter werden in dieser Arbeit verwendet?
Die Schlüsselwörter sind Geschichtsbewusstsein, Geschichtsdidaktik, Jeismann, Pandel, Sachanalyse, Sachurteil, Werturteil, historische Deutung, Medien, Multiperspektivität und Quellenkritik.
Was wird im Inhaltsverzeichnis aufgelistet?
Das Inhaltsverzeichnis listet auf: Geschichtsbewusstsein im Unterricht, Beispielhafte Unterrichtsstunde, Sachanalyse, Curriculare Legitimierung, Didaktisch-methodischer Kommentar zur Grundlage der Stunde, Verlaufsplan der Stunde, Anhang, Material und Beispiele für antizipierte Schülerbeiträge zum Material.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2024, Geschichtsbewusstsein im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1561323