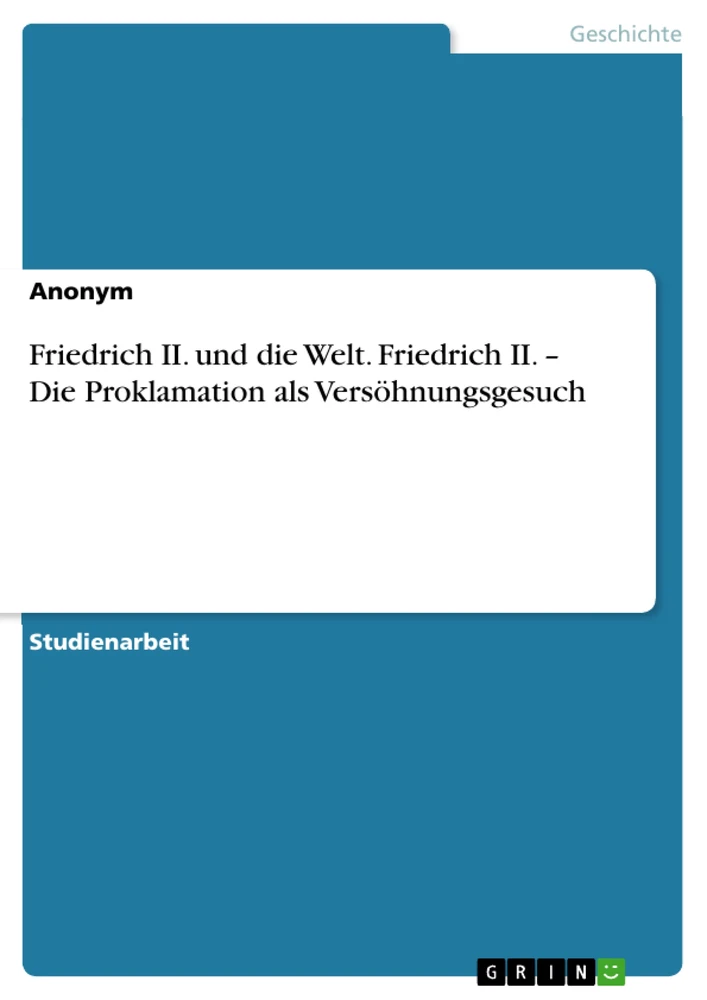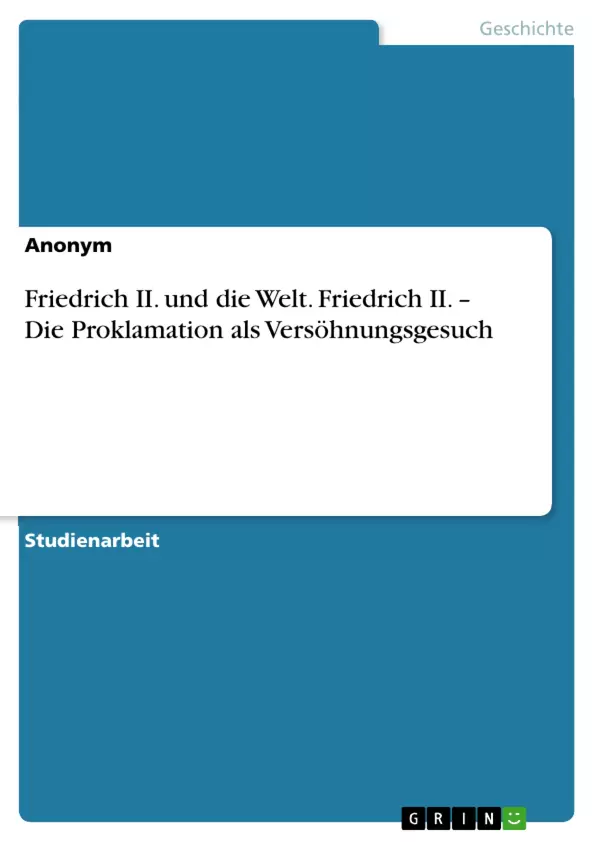Es ist der Anfang einer langen Geschichte. Ein Kaiser mit schwieriger Kindheit, der zwischen zwei Päpsten, zwei Exkommunikationen und dem Traum seiner Vorfahren das Heilige Land zu befreien, versucht seinen Anspruch auf die Kaiserwürde zu verteidigen. Die Kreuzzüge sind ein wichtiges und sehr gut erforschtes Themengebiet der europäischen bzw. christlichen Geschichte. Doch keiner der Kreuzzüge gleicht dem Friedrichs II. Ein gesalbter heiliger-römischer Kaiser, der im Streit mit dem Papst als Exkommunizierter das Heilige Land zurückfordert. Zu erwähnen bleibt dabei, Friedrich II. habe sein Ziel auf politischem Wege erreicht. Eine Seltenheit in der blutigen Geschichte der Kreuzzüge. Am 17. März 1229 erreicht Friedrichs Vorhaben, mit dem Einzug in die Stadt, sein ersehntes Ende. Am nächsten Tag präsentiert er sich in der Grabeskirche mit der Krone Jerusalems. Folgend verbreitet er den Verlauf und Triumph seiner Bestrebung in einem Rundschreiben. In der Forschung nennt man es auch das Manifest oder das Schreiben Letentur in Domine . In dieser Arbeit soll betrachtet werden, ob jenes Rundschreiben Friedrichs II. als Versöhnungsgesuch betrachtet werden sollte oder als Provokation gegenüber dem Papst. Um eine Basis zu schaffen, beginne ich meine Ausführung mit einer kurzen Erläuterung der Vorgeschichte um den Kreuzzug Friedrichs II. Das Hauptaugenmerk der Arbeit konzentriert sich jedoch auf die Analyse und die Interpretation des Manifests. Abschließend gehe ich genauer auf die Fragestellung ein und fasse die Ergebnisse kurz zusammen. Quellengrundlage ist das Rundschreiben aus Historia diplomatica Friderici secundi von Huillard-Bréholles. Für die Analyse der Quelle wird aus der Übersetzung von Eickels zitiert.
In den Biografien Friedrichs II. spielt die Kreuzzugsthematik eine signifikante Rolle. Dabei herrscht Übereinstimmung bei den Überlieferungen. Nur die Deutung unterscheidet sich von Autor zu Autor und von Zeit zu Zeit. Das beste Beispiel dafür ist die Interpretation der Krönungsszene vom 18. März.1229, auf die ich mich im Laufe der Arbeit noch einmal beziehen werde. An der Zählung der Kreuzzüge, so Hechelhammer, kann man ebenfalls erkennen, „[w]ie disparat der Stellenwert des Kreuzzugs Friedrichs II. an sich in der Kreuzzugsforschung angesehen wird“. Manche Historiker sehen die Unternehmung nach Damiette und den Feldzug Friedrichs II. als den fünften Kreuzzug an. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kreuzzug Friedrichs II.
- Das Rundschreiben Friedrichs II.
- Datierung und Überlieferung
- Inhaltsanalyse
- Bezugnahme
- Eine Verlautbarung zur Versöhnung?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Rundschreiben Friedrichs II. nach dem sechsten Kreuzzug, auch bekannt als das „Manifest“ oder „Letentur in Domine“, um zu klären, ob es als Versöhnungsversuch oder als Provokation gegenüber Papst Gregor IX. interpretiert werden sollte. Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretation des Dokuments im Kontext der politischen und religiösen Spannungen zwischen Kaiser und Papst. Die Vorgeschichte des Kreuzzugs Friedrichs II. dient als Hintergrundinformation.
- Der Kreuzzug Friedrichs II. und seine ungewöhnliche Durchführung
- Die politischen und religiösen Konflikte zwischen Friedrich II. und dem Papsttum
- Die Analyse des Rundschreibens „Letentur in Domine“
- Die Frage nach der Intention des Rundschreibens: Versöhnung oder Provokation?
- Die Rezeption des Rundschreibens in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Kreuzzugs Friedrichs II. ein und beschreibt den ungewöhnlichen Verlauf des Kreuzzugs, der durch diplomatische Verhandlungen und nicht durch militärische Eroberung zum Erfolg führte. Sie betont die zentrale Rolle des kaiserlichen Rundschreibens als Gegenstand der Analyse und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Der Kreuzzug Friedrichs II.: Dieses Kapitel beschreibt den langen und komplexen Prozess des sechsten Kreuzzugs unter Friedrich II. Es beleuchtet die politischen und religiösen Hintergründe, die Verzögerungen und Konflikte mit dem Papsttum, sowie die letztendlich erfolgreiche, aber ungewöhnliche Rückeroberung Jerusalems durch Diplomatie anstatt militärischer Gewalt. Der Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen des Konflikts, von der Kreuznahme Friedrichs bis zur friedlichen Einigung mit dem Ayyubiden-Sultan.
Das Rundschreiben Friedrichs II.: Dieses Kapitel analysiert das Rundschreiben Friedrichs II., bekannt als "Letentur in Domine" oder "Manifest". Es untersucht die Datierung und Überlieferung des Dokuments, analysiert den Inhalt auf seine Argumentationslinien und die verwendeten rhetorischen Mittel, und untersucht die Bezugnahmen auf die Ereignisse des Kreuzzugs und auf den Konflikt mit dem Papst. Das Kapitel bewertet die Rezeption des Dokuments in der Forschung und legt den Grundstein für die abschließende Bewertung der Intention des Schreibens.
Schlüsselwörter
Friedrich II., Sechster Kreuzzug, Papst Gregor IX., Rundschreiben, Letentur in Domine, Manifest, Jerusalem, Ayyubiden, Diplomatie, Politik, Religion, Mittelalter, Kaiserreich, Versöhnung, Provokation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Dokuments "Inhaltsverzeichnis"?
Das Dokument ist eine Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzungen und Themenschwerpunkte, die Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter einer wissenschaftlichen Arbeit enthält. Es dient dazu, einen Überblick über die geplante Analyse des Rundschreibens Friedrichs II. nach dem sechsten Kreuzzug zu geben.
Was ist der Inhalt des Rundschreibens Friedrichs II., das in der Arbeit untersucht wird?
Das Rundschreiben, bekannt als "Letentur in Domine" oder "Manifest", wird auf seine Datierung, Überlieferung, Argumentationslinien, rhetorischen Mittel und Bezugnahmen auf den Kreuzzug und den Konflikt mit dem Papst analysiert. Ziel ist es, die Intention des Schreibens zu bewerten: War es ein Versöhnungsversuch oder eine Provokation?
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse des Rundschreibens?
Die Analyse zielt darauf ab, zu klären, ob das Rundschreiben Friedrichs II. nach dem sechsten Kreuzzug als Versöhnungsversuch oder als Provokation gegenüber Papst Gregor IX. interpretiert werden sollte. Die Interpretation des Dokuments wird im Kontext der politischen und religiösen Spannungen zwischen Kaiser und Papst untersucht.
Was sind die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Themenschwerpunkte sind: der Kreuzzug Friedrichs II. und seine ungewöhnliche Durchführung, die politischen und religiösen Konflikte zwischen Friedrich II. und dem Papsttum, die Analyse des Rundschreibens "Letentur in Domine", die Frage nach der Intention des Rundschreibens und die Rezeption des Rundschreibens in der Forschung.
Was ist der Inhalt des Kapitels über den Kreuzzug Friedrichs II.?
Dieses Kapitel beschreibt den langen und komplexen Prozess des sechsten Kreuzzugs unter Friedrich II. Es beleuchtet die politischen und religiösen Hintergründe, die Verzögerungen und Konflikte mit dem Papsttum sowie die letztendlich erfolgreiche, aber ungewöhnliche Rückeroberung Jerusalems durch Diplomatie anstatt militärischer Gewalt. Es werden die verschiedenen Phasen des Konflikts beschrieben, von der Kreuznahme Friedrichs bis zur friedlichen Einigung mit dem Ayyubiden-Sultan.
Welche Schlüsselwörter sind für die Analyse relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Friedrich II., Sechster Kreuzzug, Papst Gregor IX., Rundschreiben, Letentur in Domine, Manifest, Jerusalem, Ayyubiden, Diplomatie, Politik, Religion, Mittelalter, Kaiserreich, Versöhnung, Provokation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Friedrich II. und die Welt. Friedrich II. – Die Proklamation als Versöhnungsgesuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1561264