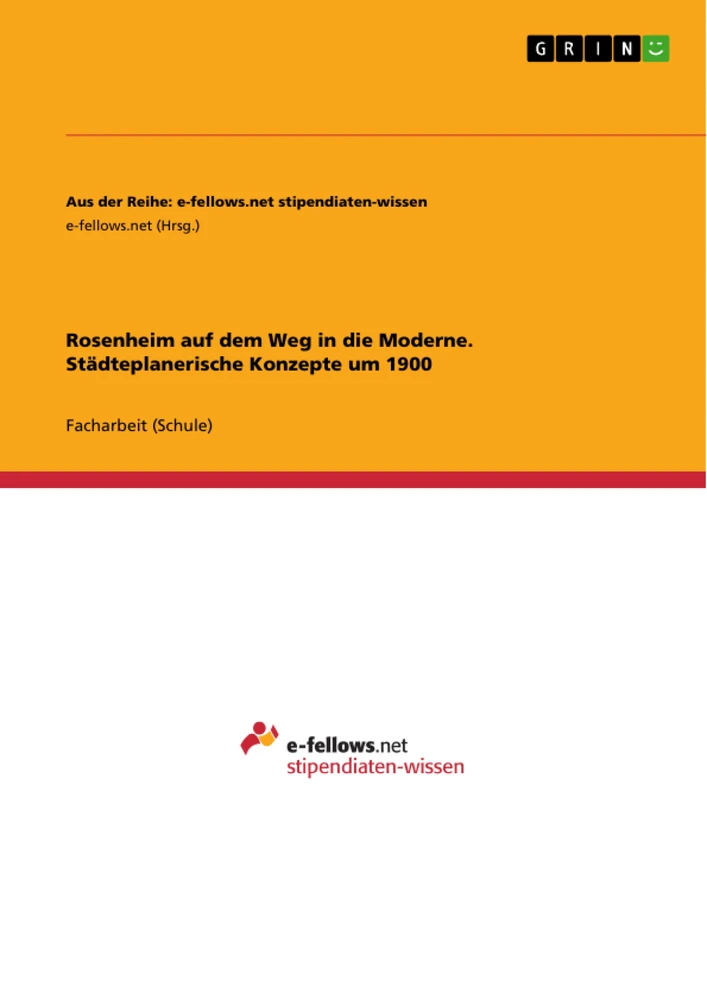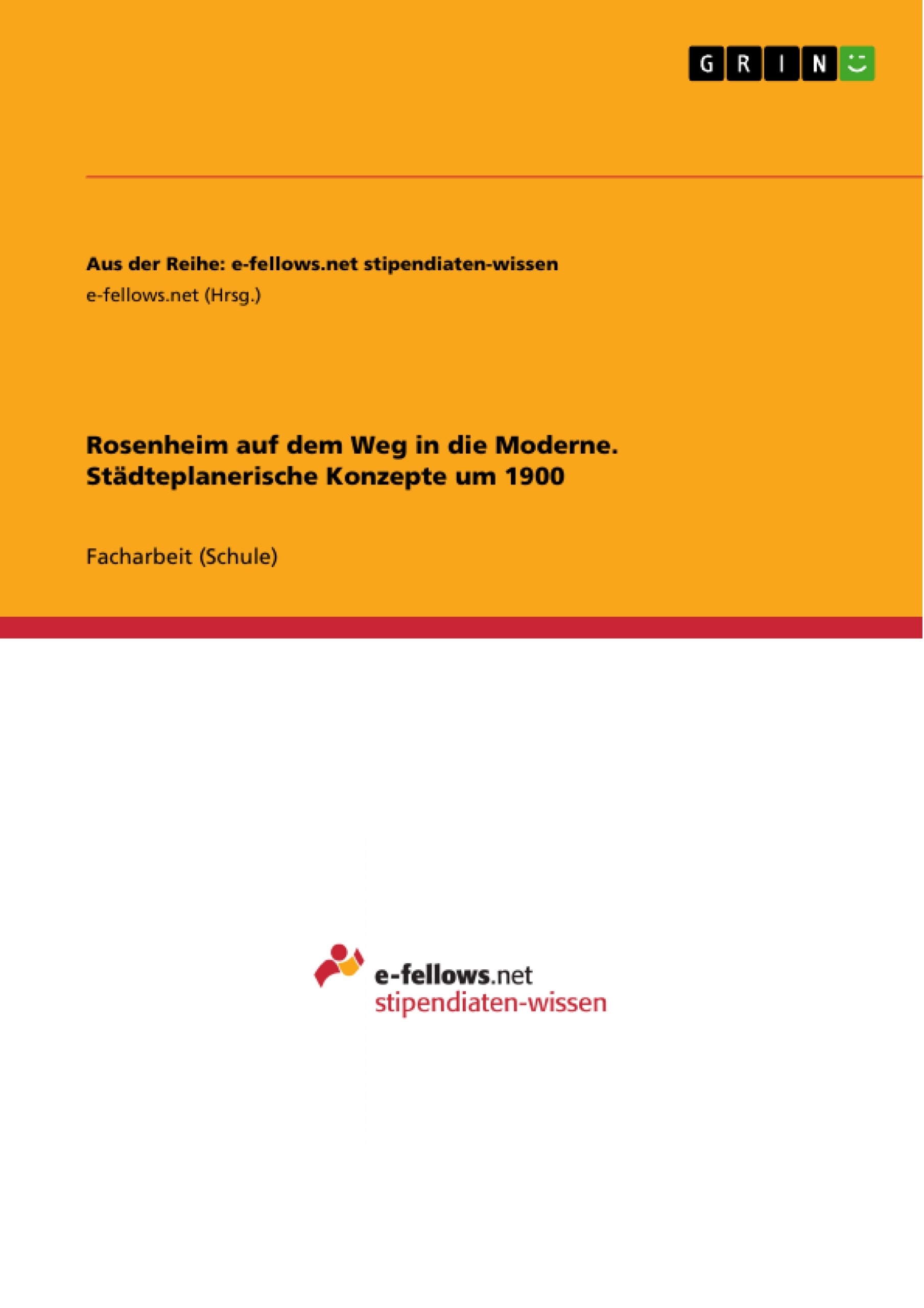Neue Häuser, neue Straßen, mehr Menschen: So lässt sich die Entwicklung der Stadt Rosenheim ab der Stadterhebung im Jahr 1864 bis zum Jahr 1914 zusammenfassen. Denn in dieser Zeitspanne, welche im Nachhinein als „Gründerzeit“ bezeichnet wird, erlebt Rosenheim einen wirtschaftlichen sowie kulturellen Aufschwung.
So verdreifacht sich die Bevölkerung Rosenheims in dem Zeitraum von 50 Jahren von 4.600 im Jahr 1864 auf 17.000 im Jahr 1914.
Die Folgen eines solch immensen Bevölkerungswachstums sind vielseitig. Unter anderem zieht ein solcher Zuwachs an Einwohnern auch unweigerlich eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum nach sich.
Dieser steigenden Nachfrage und der damit einhergehenden Planungsnotwenigkeit wird die Stadt Rosenheim mit (General)Baulinienplänen gerecht. Jene regeln durch festgelegte Baulinien den Verlauf von Häuserfronten, wodurch außerdem die Entwicklung von Straßenzügen im Stadtgebiet gelenkt wird. Mit ebendiesen Plänen und anderen Arten der Stadtplanung in Rosenheim um 1900 beschäftigt sich diese Seminararbeit und nimmt dabei auch auf die Umsetzung der historischen Konzepte Bezug.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Historischer Hintergrund der Stadtplanung und ihre Entwicklung bis zum Jahr 1900
3 Rosenheims historische städteplanerische Konzepte
3.1 Ausgangslage und Pläne vor 1875
3.2 1875: Der erste flächendeckende Baulinienplan
3.2.1 Intentionen und Entstehungsgeschichte
3.2.2 Erläuterung des Plans und seine Umsetzung
3.2.3 Baugeschehen bis zum nächsten Baulinienplan
3.3 1898: Der maßgebende Baulinienplan
3.3.1 Intentionen und Entstehungsgeschichte
3.3.2 Erläuterung des Plans und seine Umsetzung
4 Schluss: Zukunft der Rosenheimer Stadtplanung
5 Glossar
6 Abbildungs- und Quellenverzeichnis
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Neue Häuser, neue Straßen, mehr Menschen: So lässt sich die Entwicklung der Stadt Rosenheim ab der Stadterhebung im Jahr 1864 bis zum Jahr 1914 zusammenfassen. Denn in dieser Zeitspanne, welche im Nachhinein als „Gründerzeit“ bezeichnet wird, erlebt Rosenheim einen wirtschaftlichen sowie kulturellen Aufschwung. Nachdem bereits im Jahr 1810 die Saline Rosenheim in Betrieb genommen und die Stadt 1857 zudem ans Schienennetz angebunden worden ist, bildet sich Rosenheim als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region heraus. Durch die Ansiedlung vieler Ämter werden außerdem neue Arbeitsplätze geschaffen.1
Diese Faktoren führen zu einem starken Bevölkerungsanstieg, welcher zeitweise den Münchens übertrifft.2 So verdreifacht sich die Bevölkerung Rosenheims in dem Zeitraum von 50 Jahren von 4.600 im Jahr 1864 auf 17.000 im Jahr 1914.3 Die Folgen eines solch immensen Bevölkerungswachstums sind vielseitig. Unter anderem zieht ein solcher Zuwachs an Einwohnern auch unweigerlich eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum nach sich. Dieser steigenden Nachfrage und der damit einhergehenden Planungsnotwenigkeit wird die Stadt Rosenheim mit (General)- Baulinienplänen4 gerecht. Jene regeln durch festgelegte Baulinien den Verlauf von Häuserfronten, wodurch außerdem die Entwicklung von Straßenzügen im Stadtgebiet gelenkt wird. Mit ebendiesen Plänen und anderen Arten der Stadtplanung5 in Rosenheim um 1900 wird sich diese Seminararbeit beschäftigen und dabei auch auf die Umsetzung der historischen Konzepte Bezug nehmen.
2 Historischer Hintergrund der Stadtplanung und ihre Entwicklung bis zum Jahr 1900
Für ein besseres Verständnis der Stadtplanung in Rosenheim ist es essenziell, die Umstände zur Zeit der Planung sowie die Gründe und Vorläufer ebendieser zu kennen.
Die Idee der Stadtplanung besteht schon seit mindestens 2.500 Jahren und mit ihr der Anspruch, eine ästhetisch ansprechende und funktionale Stadt zu schaffen. So lässt sich beispielsweise bereits an den rechtwinklig zueinander verlaufenden Straßen in Städten der Antike sowie in denen der Römer der geplante Charakter erkennen.6 Später werden in der Zeit der Renaissance ganze Planstädte realisiert, wie das Beispiel der Stadt Palmanova (IT) zeigt. Dort lässt sich an der symmetrischen Anordnung der Straßen der Idealstadt-Entwurf der Renaissance erkennen. Trotzdem unterscheidet sich diese Art und Weise der Stadtplanung und - entwicklung maßgeblich von der, die seit dem 19. Jahrhundert vorherrscht.
Vor dem 19. Jahrhundert existiert in Bayern noch das politische System der Feudalherrschaft, welches den regierenden Stadtherren die Vollmacht über die Stadtplanung und Bebauung zusichert. Aufgrund der noch nicht etablierten Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie weitreichenden Enteignungsrechten haben die Regierenden nahezu freie Hand ihre Stadt zu gestalten und zu planen.
Dies ändert sich mit der Französischen Revolution und dem damit angestoßenen Wandel der deutschen bzw. bayerischen Verwaltung vom Absolutismus hin zum Liberalismus. Das Recht auf und der Schutz von Eigentum bekommen einen höheren Stellenwert und werden aus den Schranken befreit, welche durch die fürstliche Oberhoheit über Grund und Boden zuvor bestanden. Zusammen mit der Privatisierung des Bodens und der daraus resultierenden eingeschränkten Verfügung über die Grundstücke führt dies zu erschwerten Planungsbedingungen für die Verwaltung. Diese ist nun zudem an die, willkürliches Handeln vorbeugende, Gesetzmäßigkeit gebunden.7
Durch die veränderte rechtliche Lage entwickelt sich auch das Instrumentarium weiter, mit welchem Stadtplanung betrieben und durchgesetzt wird. Dabei bildet sich der Baulinienplan sowie die Bauordnung8 als politisch präferierter Weg heraus, eine Stadt zu planen und die Bebauung zu lenken. Dazu wird der Baulinienplan autonom von der Stadt bzw. Gemeinde erstellt, was die Handlungsfreiheit der Städte verdeutlicht und von entscheidendem Vorteil ist, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung zu reagieren.9
Diese Einschränkungen und Eigenheiten zu kennen und zu bewerten ist von essenzieller Bedeutung bei der folgenden Auseinandersetzung mit den städteplanerischen Konzepten der Stadt Rosenheim. Dabei spielt die Abwägung unterschiedlicher Interessen, welche es nun im Zuge der Gesetzmäßigkeit zu beachten gilt, eine entscheidende Rolle.
3 Rosenheims historische städteplanerische Konzepte
Im Weiteren werden Konzepte zur Stadtplanung in Rosenheim erläutert, deren Umsetzung diskutiert und die langfristigen Auswirkungen aufgezeigt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Zeitraum der Gründerzeit. Die Analyse startet hierfür mit dem ersten Baulinienplan der Stadt aus dem Jahr 1859 und endet mit dem Generalbaulinienplan von 1898. Dabei stützt sich die Untersuchung auf Katasterblätter, welche in regelmäßigen Zeiträumen neu aufgestellt worden sind und den Baufortschritt dokumentieren, auf Protokolle des Stadtrates, aus denen u.a. die Intentionen der Pläne hervorgehen, als auch auf die städteplanerischen Konzepte selbst. Diese sind für den betrachteten Zeitraum in Form von (General-) Baulinienplänen formuliert.
Aufgrund des bereits in der Einleitung erwähnten enormen Bevölkerungswachstums sowie der sich ändernden Anforderungen von Seiten der Stadt als auch von Seiten der Bezirksregierung werden die Baulinienpläne in der Gründerzeit häufig überarbeitet bzw. neu aufgelegt. Insgesamt entstehen dadurch drei verschiedene Baulinienpläne in einem Zeitabschnitt von knapp 40 Jahren (1859-1898).10
Im Folgenden sollen diese Pläne einzeln erläutert, analysiert und deren Umsetzung bewertet werden. Dabei ist zu bemerken, dass es sich bei genannten Straßen- und Ortsbezeichnung um die heutigen Namen handelt, damit Beschreibungen und Erläuterungen besser nachvollzogen werden können. Ausnahmen von dieser Regel werden erwähnt und bestmöglich vermieden. Stattdessen wird es vorgezogen, Örtlichkeiten mithilfe charakteristischer Punkte in der Stadt zu beschreiben.
3.1 Ausgangslage und Pläne vor 1875
Bis zum Jahre 1800 besteht Rosenheim einzig aus einer mit Gräben umgebenen Altstadt sowie wenigen umliegenden Höfen und Häusern. Ab 1810 kommt die Saline hinzu, was jedoch zu keiner großen Expansion Rosenheims führt, wie ein Vergleich der Uraufnahme aus dem Jahr 1812 mit dem Bebauungsstand 1859 (Abbildung 1) zeigt.11 Die Stadtplanung beschränkt sich in diesem Zeitraum auf die Standortwahl der Saline und die Planungen für die erste Bahnlinie.12
Im Jahr 1859 wird dann aufgrund der sich abzeichnenden wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung und deren Folgen für das Baugeschehen der erste Baulinienplan für die Stadt Rosenheim verabschiedet (Abbildung 1). Die in Rot eingezeichneten „neuen“ Baulinien werden hauptsächlich über bestehende Alleen und Wege gezeichnet, so beispielsweise für die heutige Münchener Straße ab dem Beginn am Max-Josefs-Platz bis hin zur Kreuzung mit der heutigen Aventinstraße oder für die Kaiserstraße im Bereich der Loretowiese. Gleiches gilt für die gesamten Verläufe der heutigen Samerstraße, der Innstraße westlich des Inns, der Heilig-Geist-Straße zwischen Frühlings- und Herbststraße sowie des Klosterweges, die anhand bestehender Wege als Baulinien festgelegt werden. Vermutlich als Nachtrag werden außerdem noch die heutige Ellmaier-, Hofmann- und Bayerstraße sowie die Färberstraße zwischen Hofmann- und Schönfeldstraße durch Baulinien in den Farben Blau und Orange in den Plan eingezeichnet.
Als eines der besten Beispiele für die Entwicklung und Anpassung von Baulinien in Rosenheim im Laufe der Zeit kann die Schönfeldstraße angesehen werden, welche in diesem Plan erstmalig auftaucht. Zuerst ist sie nur zwischen Inn- und Färberstraße eingezeichnet. Doch bereits im Zeitraum von 1859 bis 1872 werden „auf [dem] Grundstück von Alexander A[.. .]“13neue Baulinien angelegt, was zur Verlängerung der Schönfeldstraße Richtung Norden bis zum heutigen Fußgängerüberweg zum Innspitz führt.13 14
Der Plan enthält jedoch auch Baulinien, die nur teilweise, gar nicht oder in einem anderen Zusammenhang als ursprünglich vorgesehen umgesetzt werden. Darunter zählen Pläne für den Bereich der heutigen Herbststraße, der Loretowiese sowie des Binderweges. Auch der heutige Hammerweg ist ursprünglich anders geplant. So sah der erste Baulinienplan Rosenheims den Hammerweg als gerade Baulinie entlang des heutigen Verlaufes, verlängert in Richtung Süden bis zur Kreuzung der Kufsteiner- und Brianconstraße, vor.
Dass der Baulinienplan zu Recht bereits 1859 festgesetzt worden ist, zeigt das in den nächsten 13 Jahren folgende Baugeschehen. So entsteht laut Anmerkung in einem Stadtratsprotokoll zur Aufstellung des nächsten Baulinienplanes 1875 „gerade in der Zeit von 1854 bis 1872 der größte Theil[sic] der Neubauten, nahezu der 4 Theile sämtlicher Gebäude“.15 Diese Erkenntnis zusammen mit der Auswertung der Katasterpläne der Stadt Rosenheim aus dem Jahr 1872 zeigt eine größtenteils direkte Umsetzung und Bebauung der Baulinien. Der Grund dafür liegt vor allem in der 1859 bereits größtenteils bestehenden Wegführung und Bebauung entlang der Baulinien, was einen verstärkenden Effekt auf die weitere Bebauung dieser hat. Außerdem sind die Grundstücke aufgrund seit Jahrzehnten bestehenden Wegen so aufgeteilt, dass für den Hausbau meist nur mit einem Grundstücksbesitzer verhandelt werden muss, was ein weiterer begünstigender Faktor für die Umsetzung des Baulinienplanes ist.16
Konkret werden innerhalb von 13 Jahren bis 1872 über 40 neue Gebäude entlang der neuen Baulinien errichtet. Besonders hervorzuheben ist dabei die damals neue Hofmannstraße, an welcher neun Gebäude entstehen, wodurch bis auf ein verbleibendes Grundstück alle verfügbaren bebaut werden. Außerdem wird nach Verabschiedung des Baulinienplanes die Münchener Straße gegenüber des Salingartens, welche heute als Stadtkern gilt, um sechs Gebäude erweitert.17 Diese Aufzählung ist so wie die meisten folgenden nicht erschöpfend, sondern konzentriert sich auf die für die Stadt wichtigsten Entwicklungen. Schlussfolgernd kann der Baulinienplan von 1859 somit als erfolgreiches städteplanerisches Konzept gewertet werden, da nahezu alle von ihm etablierten Baulinien in seiner Geltungszeit bebaut worden und auch bis heute im Stadtbild Rosenheims verankert sind.
3.2 1875: Der erste flächendeckende Baulinienplan
3.2.1 Intentionen und Entstehungsgeschichte
Der Baulinienplan von 1875 (Abbildung 2) ist, nach seinem Umfang und seinen Auswirkungen gemessen, weitaus komplexer als der vorige, weil er das erste flächendeckende Planungskonzept für Rosenheim darstellt. Zum Vorteil der Analyse liegen zu diesem und den folgenden städteplanerischen Konzepten neben Katasterplänen nun auch Akten des Stadtmagistrates vor, welche das Aufstellungsverfahren und die Intentionen des Plans dokumentieren. Die Akten bestehen größtenteils aus Beschlüssen und Protokollen des Stadtmagistrates, aber auch aus dessen Briefverkehr mit dem planverfassenden Bezirksgeometer sowie mit der Bezirksregierung. Als hinderlich für die Auswertung erweist sich hingegen der Baulinienplan selbst, da sich der Stand der Bauentwicklung auf diesem nicht mit dem der Katasterpläne von 1872 und 1879 deckt und somit nicht dem Stand bei der Aufstellung des Planes entspricht. Das ist unter anderem an den Häusern Münchener Straße 31 und 33 sowie Riederstraße 8 ersichtlich, die nur im Baulinien- nicht aber im Katasterplan verzeichnet sind.18 Dank vorliegender Akten des Stadtmagistrats sowie einer weiteren Kopie des Plans lässt sich die fragliche Aufzeichnung jedoch als Stand der Baulinienplanung im Jahr 1875 identifizieren. Die ungleichen Entwicklungsstände können durch das Fortschreiben der Neubauten in das Dokument erklärt werden.
Damit hier gezogene Schlussfolgerungen nachvollziehbar sind, muss beachtet werden, dass für den Ausgangsstand der Bebauung 1875 der Stand der Katasterpläne 1872 bzw. 1879 und nicht der des Baulinienplanes angenommen wird.19 Als Betrachtungszeitraum wird hierbei die Zeitspanne bis zum nächsten Baulinienplan 1898 gewählt. Somit können die in diesem Jahr neu aufgelegten Katasterpläne als Endstand der Bebauung angesehen werden.20
Anlass, den Baulinienplan neu aufzulegen, ist bei seiner ersten Erwähnung aber nicht etwa ein Bürgerbegehren oder ein Beschluss des Stadtmagistrats. Vielmehr geht der Baulinienplan von 1875 auf eine Forderung der Regierung von Oberbayern zurück. Diese erlässt im Kreis-Amtsblatt von Oberbayern am 25.10.1872 den Auftrag „die [...] Generalpläne nach den nachstehenden Direktiven sofort revidiren[sic], [...] beziehungsweise neuherstellen[sic] zu lassen, und dieselben [.] bis zum 1. Januar 1873 [.] in Vorlage zu bringen.“21. Die erwähnten Direktiven umfassen dabei unter anderem eine möglichste „geradeleitung“22 der Straßen und Baulinien, was zum entscheidenden Erkennungsmerkmal dieses Konzepts wird. Aufgrund noch ausstehender Planungen bezüglich der Bahnhofsverlegung genehmigt die Bezirksregierung, das Aufstellen der Baulinien zu verschieben, bis der neue Standort des Bahnhofs und der neue Schienenverlauf beschlossen sind. Schlussendlich wird das Areal nördlich der Kunstmühle als neuer Bahnhofsstandort festgelegt, was die weitere Entwicklung der Stadt maßgebend beeinflusst. Diese Raumentwicklung städtebaulich zu lenken und die freigewordenen Flächen sinnvoll in die Stadt zu integrieren, wird damit zur Hauptaufgabe dieses städteplanerischen Konzepts. Hierfür wird im Verlauf der Planung zunächst der Bezirksgeometer mit einer Neuaufnahme des Katasterplans beauftragt, um eine klare Ausgangslage für den folgenden Entwurf zu haben. Diesen entwirft derselbe entsprechend der Richtlinien der damaligen Bauordnung sowie der erwähnten Amtsblatt-Direktiven als „Generalplan“. Um die Bedürfnisse der Stadt bestmöglich zu erfüllen, formuliert eine nur zu diesem Anlass ernannte Kommission anschließend Änderungsvorschläge, die nach Genehmigung durch den Stadtmagistrat im Plan ausgebessert werden. Nach anschließender Einspruchsmöglichkeit für Bürger und Grundbesitzer wird nur ein kleiner Teil der Baulinien durch die Regierung genehmigt.23 Im Januar 1875 werden diese beschlossenen Linien mit roter Farbe im „Generalplan“ markiert, wodurch dieser zum rechtskräftigen „Baulinienplan“ wird.24
3.2.2 Erläuterung des Plans und seine Umsetzung
Das Konzept lässt sich unterteilen in die Entwürfe des Obergeometers als auch in die Baulinien, die auf konkreten Forderungen der Kommission basieren. Da letztere den nachhaltigsten Einfluss auf die weitere Entwicklung Rosenheims haben, sollen einige Forderungen und die daraus entstehenden Straßen im Folgenden erwähnt werden. Als bestes Beispiel hierfür gilt der bis heute wirkende Kommissionsbeschluss, den ehemaligen Bahnkörper als Hauptbaulinie einzuzeichnen. Konkret entspricht das der Prinzregenten-, Rathaus und Wittelsbacherstraße, wobei die Prinzregenten- und Rathausstraße noch heute die Hauptverkehrsachse Rosenheims bilden. Eine weitere Forderung der Kommission ist eine verbesserte Anbindung der Altstadt, wie es am Salzstadel durch die Stoll- und Steinbökstraße geschieht. Im Bereich des Salzstadels wird zudem die heutige Nikolaistraße als zukünftige Straße beschlossen. Außerdem werden einst angedachte Baulinien an den Loreto-Alleen entfernt, um den Rosenheimern ein unbebautes Gebiet zum Spazieren zu erhalten, welches noch heute u.a. für Volksfeste oder Messen genutzt wird. Im Bereich des neuen Bahnhofs beschließt die Kommission die heutige Anton-Kathrein-Straße als Baulinie um die Anbindung des neuen Verkehrsknotenpunktes zu verbessern. Auch das von der Kufsteiner- Bnancon- und Rathausstraße sowie der Mangfall umgebene Gebiet wird ausdrücklich zur Beplanung mit Baulinien und demzufolge auch zur Bebauung vorgesehen. Von den dort eingezeichneten Straßenverläufen werden jedoch nur die heutige Neubeurer- und Nußdorferstraße umgesetzt.25
Abseits von den konkreten Forderungen der Kommission kommen in diesem Konzept viele Baulinien(-gebiete) hinzu, welche entsprechend der zuvor erwähnten Regierungsanordnung vom Bezirksgeometer entworfen worden sind. Die Anordnung, dass Baulinien gerade zu verlaufen und sich möglichst senkrecht zu treffen haben, führt zu einem geometrischen Planungsschema, bei dem Straßenzüge meist parallel zueinander verlaufen und in rechtem Winkel aufeinandertreffen.26
Dieser Planungsstil lässt sich bei dem Konzept von 1875 an dem Gebiet südlich der Inn- und östlich der Königsstraße als auch rund um die Wittelsbacher Straße am besten erkennen, weil dort im Planungszeitraum noch keine Bebauung existiert.
Doch obwohl die geometrischen Stadtviertel den Anforderungen der Regierung entsprechen, werden diese nicht beschlossen. Den Status einer rechtskräftigen Baulinie erhalten nur die Hauptverkehrsachsen bzw. die als am wichtigsten angesehenen Straßenzügen, wobei die meisten hiervon auch zuvor bereits entweder als Straße oder Eisenbahntrasse existierten. Darunter fallen die 1875 bereits als Straße oder Weg bestehenden Baulinien der Kaiser- und Ebersbergerstraße verlängert über den Max-Josefs-Platz sowie die Küpferlingstraße.27 Entlang der alten Bahnstrecke werden zudem die zuvor erwähnten Linien der Rathaus-, Prinzregenten- und Wittelsbacherstraße beschlossen. Einzig die Münchener Straße folgt in diesem Plan einem neuen Verlauf, da der ursprüngliche durch den neuen Bahnhof durchbrochen worden ist. Das Beispiel der Küpferling- aber auch der Münchener Straße zeigt dabei erneut die enge Verknüpfung dieses städteplanerischen Konzepts mit der Bahnhofsverlegung auf und seinen Einfluss auf die grundsätzliche Raumordnung Rosenheims.
3.2.3 Baugeschehen bis zum nächsten Baulinienplan
Die Umsetzung in Form von Straßen als auch deren Bebauung fällt bei diesem städteplanerischen Konzept weniger ausgeprägt aus. Erkennen lässt sich dies am Verhältnis von geplanten zu umgesetzten Baulinien zum Zeitpunkt der nächsten Baulinienaufstellung 1898.28 Das liegt zum einen daran, dass der Großteil der Baulinien nicht verabschiedet und somit aus rechtlicher Sicht nicht verbindlich ist. Hinzu kommt ein den Verhältnissen nicht angepasster Straßenverlauf, der viele Grundstücke kreuzt und somit eine aufwendige Flurbereinigung erfordert hätte. So kommt keines der zuvor beschriebenen strikt geometrischen Plangebiete zur Umsetzung.
Trotz genannter Umstände hat dieses Konzept signifikante Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Stadt, vor allem im Bereich des neuen Bahnhofs. So entstehen in der Zeit bis zur Verabschiedung des nächsten Baulinienplanes 1898 einige neue Gebäude entlang der Baulinien. Die größten sind dabei der Gillitzerblock entlang der Gillitzerstraße sowie der am neuen Verlauf der Münchener Straße angesiedelte Industriekomplex „Auerbräu“. Weitere Gebiete mit erhöhter Bautätigkeit sind auch die Münchener Straße im Bereich des Bahnhofs und die abzweigenden Sand- und Papinstraße. Auch die sich im rechten Winkel treffenden Bahnhof- und Luitpoldstraße werden als Begrüßungstor für Bahnreisende noch vor dem nächsten Baulinienplan bebaut. Manch andere erstmals in diesem Plan angelegte Straßen werden zwar bis zum nächsten Baulinienplan nicht bebaut, wirken aber durch Abänderung in späteren Konzepten bis heute auf deren Verlauf, wie es bei der heutigen Sonnen-, Eid- und Stemplingerstraße, als auch bei der Schönfeldstraße der Fall ist.
Schlussendlich kann dieser Baulinienplan trotz der vergleichsweise geringen Umsetzungsquote als wichtiges Element in der Entwicklung der Stadt Rosenheim angesehen werden, da durch ihn die heutigen Hauptverkehrsachsen etabliert worden sind.29
3.3 1898: Der maßgebende Baulinienplan
3.3.1 Intentionen und Entstehungsgeschichte
1896 wird infolge des „raschen Aufblühen[s]“30 der Stadt die Herstellung eines neuen Baulinienplanes veranlasst, der zum maßgebenden Stadtplanungskonzept für die weitere Entwicklung Rosenheims wird. Laut Stadtmagistrat ist der Plan von 1875 zu diesem Zeitpunkt bereits „vollständig veraltet“.31 Weil das Stadtbauamt infolge der Arbeiten für das neue Elektrizitätswerk in Oberwöhr und der Erweiterung des heutigen Ignaz-Günther-Gymnasiums unter „Geschäftsüberhäufung“32 leidet, muss die Stadt für eine zeitnahe Neuauflage des Baulinienplans einen externen Stadtplaner engagieren. Hierfür wird ihr der Architekt und Leiter des Münchner Stadterweiterungsbüros Theodor Fischer empfohlen, der es „vorzüglich versteht, sich den gegebenen Verhältnissen anzupassen und in seinen Plänen Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit gut zu verbinden weiß“.33
Nachdem die Stadt die Erstellung eines Baulinienplanes bei Fischer anfragt und am 27.03.1987 eine Zusage erhält, formuliert dieser in den folgenden eineinhalb Jahren ein neues städteplanerisches Konzept. Dieses entwirft er auf Basis zuvor angefertigter Katasterpläne bei mehreren Ortsbesuchen in Form eines Generalbaulinienplans. Ein solcher ist rechtlich nicht verbindlich, sondern hat eine vorbereitende Funktion für spätere detaillierte Pläne. Rechtswirksam werden Fischers Konzepte nur durch spätere gebietsspezifische Baulinienpläne und 1925 durch die Staffelbauordnung.34
Der neue Generalbaulinienplan (Abbildung 3) folgt, anders als die vorigen, nicht mehr dem rechtwinklig geometrischen Planschema, sondern hat vielmehr das Ideal einer Gartenstadt-Idylle bzw. des „malerischen Städtebaus“.35 Dieses ist gekennzeichnet durch gewundene, nicht lineare Straßenverläufe, die sich den natürlichen Gegebenheiten anpassen. Außerdem enthält der Plan „markante Kreuzungspunkte, eine Gliederung in bestimmte Baublöcke und mögliche Standorte für öffentliche Gebäude“36, was ein weiterer Hinweis auf die Raffinesse des Planers ist. Gesamtheitlich betrachtet kann man daran den Versuch erkennen, die Stadt weniger konstruiert, sondern vielmehr natürlich gewachsen erscheinen zu lassen.37
Weil während der Planaufstellung „die Bautätigkeit[sic] lahm gelegt und der Handel mit Grundstücken fast zur Unmöglichkeit [geworden ist]“38, steigt der Druck aus der Bevölkerung den Plan schnellstmöglich fertigzustellen. Tatsächlich ist der Baudruck bei Vorstellung des Planes am 11.11.1898 so groß, dass in den folgenden drei Jahren mehr als 13 neue Gebäude entstehen.39
3.3.2 Erläuterung des Plans und seine Umsetzung
Für das Verständnis dieses Planes sind die Akten des Stadtmagistrates zweitrangig, da Absprachen meist bei persönlichen Terminen getroffen oder nicht verschriftlicht worden sind. Dafür ist der mit verschiedenen Farben gezeichnete und mit Beschriftungen versehene Generalbaulinienplan (Abbildung 3) selbst umso aufschlussreicher. Laut Legende der Planzeichen stehen orange Linien für bereits bestehende und rote Linien für neu eingezeichnete Baulinien. Als Neuerung kommen in diesem Plan außerdem grün gefärbte Vorgartenlinien hinzu, hinter denen die Garten- oder Grünflächen beginnen.40 Außerdem ist für jede Straße der Abstand bzw. die Breite der jeweiligen Baulinien eingezeichnet, was Aufschluss über die verkehrstechnische Priorisierung der Straßen gibt. Das Fehlen von Vorgartenlinien in Gebieten nahe dem Stadtkern lässt auf das Vorsehen von dichterer Bebauung schließen. Das ist für den Bereich der Altstadt, das Gebiet am Roßacker sowie der Münchener Straße zwischen der Kufsteiner- und Luitpoldstraße sowohl im Plan als auch im heutigen Stadtbild erkennbar.41
Der größte Bestandteil dieses Konzepts sind die zur Erweiterung der Stadt neu vorgesehenen Straßen. Diese folgen dem zuvor erwähnten Prinzip der ästhetischen, sich den natürlichen Gegebenheiten anpassenden Stadt- bzw. Baulinienplanung, die besonders am Gebiet zwischen Haustätter Höhe und Gabelsbergerstraße erkennbar ist. Dort verlaufen vollkommen neu angelegte Baulinien in großen Bögen und treffen sich an 2 Kreuzungspunkten im Norden. Dabei wird auch auf die natürlichen Gegebenheiten wie die Geländeerhebung westlich der Hohenzollernstraße Rücksicht genommen wird. Wegen der nahezu unveränderten Umsetzung der Planungen gilt dieses Gebiet noch heute als Paradebeispiel für den malerischen Städtebau und die Gartenstadt-Idylle nach dem Vorbild Theodor Fischers.42
Auch abseits dieses Idealbeispiels werden viele Teile des Plans in die Tat umgesetzt. Darunter zählen vor allem Gebiete in der Nähe des neuen Bahnhofs. Südlich von diesem werden zwischen Mangfallkanal und Enzenspergerstraße mehrere Straßen nach Fischers Vorgaben angelegt, von denen die Hochfellnstraße aufgrund des markanten Bogens besonders hervorzuheben ist. Nordwestlich des Bahnhofes werden außerdem die Pichlmayer-, Wrede- und Schützenstraße entsprechend Fischers Konzept umgesetzt. Ebenfalls auf diesen Plan zurückführen lässt sich die heutige Nord-Süd-Achse Hubertusstraße. Die Auswirkungen dieses Plans beschränken sich jedoch nicht ausschließlich auf den Süden der Stadt, sondern zeigen sich ebenso in nördlichen Gemeindeteilen wie der Erlenau. Die dortige Austraße oder die typische gebogen verlaufende Pettenkofer- und Erlenaustraße sind ein Beispiel für die Umsetzung des Planes im gesamten damaligen Stadtgebiet. Zu den damals vorgesehenen prägnanten Kreuzungsgebieten gehört unter anderem die Abzweigung der Küpferling- von der Prinzregentenstraße. Des weiterem werden mit diesem Konzept erstmalig explizite Park- und Erholungsanlagen vorgesehen, wie sie in abgeänderter Form mit dem Luitpoldpark umgesetzt werden.43
Trotz aller Expertise des Baulinienexperten aus München werden mehrere Gebiete nicht entsprechend des Planes oder sehr stark abgeändert bebaut. Dazu gehört neben dem Bereich zwischen Inn- und Ellmaierstraße auch der zwischen Wittelsbacher-und Münchner Straße.
Vor allem aufgrund seiner charakteristischen Stadtplanung wie im Bereich der Haustätter Höhe und den daran Orientierten folgenden Konzepten kann der Generalbaulinienplan von Theodor Fischer als prägendes städteplanerisches Konzept mit langfristiger und nachhaltiger Wirkung auf die Entwicklung und Erweiterung der Stadt Rosenheim angesehen werden.44
4 Schluss: Zukunft der Rosenheimer Stadtplanung
Unter anderem dank weitsichtiger Stadtplanung, wie die des Architekten Theodor Fischer, kann sich Rosenheim innerhalb von 150 Jahren vom Markt zum Oberzentrum und seit neuestem sogar zum Bezirksregierungssitz mit 64.90945 Einwohnern entwickeln, während gleichzeitig der historische Ortskern bewahrt und ein qualitätsvolles Wachstum sichergestellt wird. Dass der Trend des Bevölkerungswachstums sich fortsetzen wird, zeigt eine neu in Auftrag gegebene Bevölkerungsprognose, welche bis zum Jahr 2040 mit einem Zuwachs um 8.000 auf 72.000 Einwohner rechnet.46 Dies führt unweigerlich zu einer stetig steigenden Nachfrage nach Wohnraum auf dem sowieso schon angespannten Wohnungs- und Häusermarkt. Zusammen mit den neu aufkommenden Erfordernissen des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Nachhaltigkeit sorgt dies für einen großen Handlungsbedarf im Bereich der Stadtplanung beziehungsweise Stadtentwicklung. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig allgemein gültige Leitlinien zu verfassen, erarbeitete die Stadt Rosenheim mit Bürgerbeteiligung das „Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2025 - Stadt in Zukunft“, welches neben der Entwicklung der Wirtschaft und Bildung auch Aspekte des Wohnens, der Erholung und des Umweltschutzes abdeckt. Dabei wird der Fokus unter anderem auf das Problem des Bauflächenmangels gelegt. Dieses wird dadurch verstärkt, dass das Stadtgebiet Rosenheims zur Hälfte aus forst- und landwirtschaftlich genutzten Flächen besteht, die als Naherholungsgebiete und als Grünzäsuren zwischen den Stadtteilen erhalten bleiben und nicht als Bauflächen freigegeben werden sollen.47
Gleichzeitig wird in eben diesem Konzept jedoch ein Mehrbedarf von 400 Wohnungen pro Jahr festgestellt, was neue, alternative Herangehensweisen im Bereich der Stadtentwicklung erforderlich macht. So wird beispielsweise in Zukunft mehr Wert auf Nachverdichtung in Form von Aufstockungen oder Schließen von Baulücken im Bestand gelegt, anstatt neue Wohngebiete zu erschließen und dabei viel zuvor unbebaute Fläche zu versiegeln. Um den Kriterien entsprechende Flächen, welche im Stadtgebiet für neue Gewerbe oder Wohngebäude zur Verfügung stehen, zu identifizieren, ließ die Stadt Rosenheim einen Flächenpotenzialplan erstellen, welcher 500 Standorte mit insgesamt 80 ha umfasst, auf denen in Zukunft neue Gebäude entstehen können.48
Einer dieser Standorte, welcher Abhilfe für den allgemeinen Mangel an Wohnraum in Rosenheim schaffen soll, ist das Wohngebiet „Krainstraße Nordwest“, welches auf 2,7 ha 165 neue Wohneinheiten für 500 Personen schaffen soll.49 Das Stadtentwicklungskonzept zeigt die Bemühungen der Stadt Rosenheim, auch in der Zukunft ein menschenwürdiges und naturverträgliches Leben und Arbeiten zu ermöglichen, ist jedoch rechtlich nicht verbindlich. Um die Entwicklung der Stadt so maßgeblich zu lenken, wie es einst der Generalbaulinienplan Fischers tat, ist deshalb eine Fortschreibung des Flächennutzungsplans, das heutige Pendant des Generalbaulinienplans, unerlässlich.50 Ob es Rosenheim ohne einen solchen Plan tatsächlich gelingt, pro Jahr 400 neue Wohnungen bereitzustellen und die Wohnungsnot zu beenden, bleibt offen.
5 Glossar
Stadtplanung
„Die Stadtplanung ist eine querschnittsorientierte Disziplin zur Ordnung, Lenkung und Entwicklung der städtischen aber auch ländlichen Räume.“51
Bauordnung:
Hier im Kontext der Bayerischen Bauordnung. Eine Bauordnung ist ein Gesetz, welches Vorschriften im Zusammenhang mit dem Bauwesen enthält.
Baulinienplan
Der Baulinienplan ist ein historisches Instrument der Stadtplanung. Dabei bezieht sich der Wortteil „Baulinie-“ auf die parallel zur Straße verlaufende Seitenmauer eines Gebäudes (=Baufluchtlinie). Somit ist Sinn und Zweck von Baulinienplänen den Verlauf der Häuserfronten eines Gebiets festzulegen. Häufig wurden diese Pläne auch zum Festlegen von Straßenverläufen verwendet.
Generalbaulinienplan
Der Generalbaulinienplan ist ein, dem Baulinienplan vorangehender, vorbereitender Plan. Dabei hat der Generalbaulinienplan einen weniger rechtskräftigen und verbindlichen Charakter.
Staffelbauordnung
Die Staffelbauordnung ist der Vorläufer des heutigen Bebauungsplans und regelt die Bebaubarkeit von Grundstücken innerhalb des Planungsgebiets. Dabei wird die Bebaubarkeit in Baustaffeln unterschieden. So dürfen bspw. in Bereichen der Staffel eins Häuser bis zu einer Giebelhöhe von 15m errichtet werden und bei Staffel zwei nur bis 10m Giebelhöhe. Je Baustaffel kann unter anderem die Nutzung der Grundstücke, ob gewerblich oder privat, die Bauweise, die maximale Höhe eines Gebäudes sowie die Anlegung von Rückgebäuden geregelt werden.52
6 Abbildungs- und Quellenverzeichnis
Abbildung 1: Stadtarchiv Rosenheim, Baulinien der Stadt Rosenheim 1859, KPL 775 (zugeschnitten)
Abbildung 2: Stadtarchiv Rosenheim, Baulinienplan der Stadt Rosenheim 1875, KPL 242 (zugeschnitten)
Abbildung 3: Stadtarchiv Rosenheim, Generalbaulinienplan 1898, KPL 241 (zugeschnitten)
Quelle 1: Archiv des Staatlichen Vermessungsamts Rosenheim, Katasterpläne Rosenheims 1872- 1982, S.O 13-18; S.O. 14-17; S.O. 14-18
Quelle 2: Bayerische Staatsbibliothek, Königlich-bayerisches Kreis-Amtsblatt von Oberbayern 187, BV002569505
Quelle 3: Stadtarchiv Rosenheim, Copie des Baulinienplanes 1875, KPL 773
Quelle 4: Stadtarchiv Rosenheim, Magistratsakt zur Herstellung eines Baulinienplanes 1875, MAG VI D 1 52
Quelle 5: Stadtarchiv Rosenheim, Magistratsakt zur Herstellung eines Generalbaulinienplanes 1898, MAG VI D 1 267
Quelle 6: Stadtarchiv Rosenheim, Uraufnahme des Marktes Rosenheim 1812, DB_517
Quelle 7: Stadtplanungsamt Rosenheim, Staffelbauordnung 1925, Bestandsplan-Sammlung
Quelle 8: Stadtplanungsamt Rosenheim, Baulinien in Rosenheim 1910, Bestandsplan-Sammlung
7 Literaturverzeichnis
Frankenberger, Josef: "Endlich volljährig!", Rosenheim gewinnt Statur und Struktur 1864-1914, in: Leicht, Walter (Hrsg.): Rosenheim wird Stadt, Die goldenen Jahre 1864-1914, Rosenheim 2014, S. 16-27.
Hartl, Johann (2016): Der Baulinienplan in Bayern, 1864 - 1960 - heute. https://www.stadtgrenze.de/t/baulinienplan/baulinienplan.htm (Stand 26.06.2023).
Hartl, Johann (2020): Planzeichen zum Baulinienplan. https://www.stadtgrenze.de/t/baulinienplan/planzeichen.htm (Stand 28.10.2023).
Hartl, Johann (2021): Münchner Staffelbauordnung 1904-1979 / Einführung. https://www.stadtgrenze.de/s/bbo/muestabo/muestabo.htm (Stand 26.09.2023).
Heidenreich, Bärbel (2021): Das Antike Rom, Stadtentwicklung bis zur Antike. https://www.planet-wissen.de/geschichte/antike/das_antike_rom/pwiestadtentwicklungbiszurantike100.html (Stand 02.11.2023)
Kirschner, Jens (2021): Mehr Wachstum als in Bayern, Rosenheims Einwohnerzahl stiegt stärker an als im Freistaat - 8000 Neubürger bis 2040. https://www.ovb-heimatzeitungen.de/rosenheim-stadt/2021/11/09/mehr-wachstum-als-in-bayern.ovb (Stand 23.06.2023).
Leicht, Walter: Rosenheim wird Stadt, Die goldenen Jahre 1864-1914, in: ders. (Hrsg.), Rosenheim wird Stadt, Die goldenen Jahre 1864 - 1914, Rosenheim 2014, S. 11 - 15.
Leicht, Walter (o.J.): Zeittafel von Rosenheim. https://www.stadtarchiv.de/stadtgeschichte/zeittafel-von-rosenheim/?L=0 (Stand 25.06.2023).
Mair, Karl: Rosenheims Stadtentwicklung und Architektur im 19. Jahrhundert, in: Pilz, Michael (Hrsg.): Rosenheim, Geschichte und Kultur, Rosenheim 2010, S. 235-257.
Pahl-Weber, Elke / Schwartze, Frank: Stadtplanung, in: ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 2509-2520.
Schrötler-von Brandt, Hildegard: Geschichte der Stadtplanung, in: ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 805-821.
Stadt Rosenheim (o.J.): Stadtentwicklung. https://www.rosenheim.de/buergerservice/planen-bauen/stadtentwicklung (Stand 24.06.2023).
Stadt Rosenheim (2014): Stadtentwicklungskonzept Rosenheim 2025, Stadt in Zukunft. https://www.rosenheim.de/fileadmin/Buergerservice/Stadtentwicklung/Gesamttext_Egebnisbroschuere_RO25b.pdf (Stand 24.06.2023).
Stadt Rosenheim (2023): Zahlen und Fakten Rosenheim, Ausgabe 2023. https://www.rosenheim.de/fileadmin/Politik-und-Verwaltung/Daten-und-Fakten/Zahlenspiegel_2023_deutsch.pdf (Stand 24.06.2023).
Stangl, Andreas: Entwicklung des Bauplanungsrechts in Bayern 1863-1933, mit Beispielen aus München, Nürnberg und Regensburg, Regensburg 2001.
Weinfurtner, Ilsabe (2020): Rosenheim: Neues Wohngebiet entsteht in ehemaliger Hochwasserschutzzone. https://www.ovb-online.de/rosenheim/rosenheim-stadt/rosenheim-neues-wohngebiet-ensteht-ehemaliger-hochwasserschutzzone-13788462.html (Stand 24.06.2023).
[...]
1 Leicht, Zeittafel von Rosenheim.
2 Hinweis von Walter Leicht, ehem. Leiter des städt. Museums Rosenheim.
3 Leicht, 2014, S.12.
4 Siehe Glossar.
5 Siehe Glossar.
6 Heidenreich, 2021; Vgl. Altstadt von Rom (IT) und Piräus (GRC).
7 Schröteler-von Brandt, 2018, S.805-811.
8 Siehe Glossar.
9 Stangl, 2001, S. 25-30; Pahl-Weber/Elke, 2018 S. 2513f.; Hartl, 2016.
10 Vgl. Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3.
11 Quelle 6.
12 Hinweis von Helmut Cybulska, ehem. Leiter Stadtplanungsamt.
13 Anm. auf Abb. 1, Nachname in Quelle nicht lesbar.
14 Vgl. Abbildung 1.
15 Quelle 4, Brief an die Regierung von Oberbayern vom 12.11.1872.
16 Vgl. Wegeführung in der Uraufnahme 1812 (Quelle 6) mit Baulinienplan 1859 (Abbildung 1).
17 Quelle 1, Katasterpläne 1872.
18 Abbildung 2; Quelle 1.
19 Quelle 3; Quelle 1.
20 Quelle 1.
21 Quelle 2, S. 2082ff.
22 ebd.
23 Quelle 4.
24 Quelle 4, Magistratsbeschluss vom 08.01 1875.
25 Quelle 4, Anregungen der Kommission vom 25.09.1874.
26 Frankenberger, 2014 S. 23.
27 Vergleich von Wegen in Abbildung 1 mit Baulinien in Abbildung 2.
28 Quelle 1, Katasterpläne 1897.
29 Frankenberger, 2014 S. 24f.
30 Quelle 5, Brief an Theodor Fischer vom 20.02.1897.
31 ebd.
32 Quelle 5, Nachricht des Stadtbauamts vom 20.03.1897.
33 Quelle 5, Nachricht des Stadtmagistrats vom 03.04.1897.
34 Quelle 7; Quelle 8; Frankenberger, 2014 S.24; Definition Staffelbauordnung siehe Glossar.
35 Frankenberger, 2014 S.24.
36 ebd.
37 Mair, 2010 S.26f.
38 Quelle 5, Brief an T. Fischer vom 05.03.1898.
39 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2023.
40 Hartl, 2020 S.1ff.
41 Für das heutige Stadtbild werden die Katasterpläne 1982 (Quelle 1) angenommen.
42 Mair, 2010 S.26f.
43 Vergleich der Baulinien in Abbildung 3 mit den Katasterplänen 1982 (Quelle 1).
44 Folgende Konzepte siehe 3.3.1; Frankenberger, 2014 S.24.
45 Stadt Rosenheim, 2023, S.5.
46 Kirschner, 2021, S.1.
47 Stadt Rosenheim, 2014 S.34ff.
48 Stadt Rosenheim, 2014, S 29ff.
49 Weinfurtner, 2020, S.1.
50 Hinweis von Helmut Cybulska, ehem. Leiter Stadtplanungsamt.
51 Pahl-Weber/ Schwartze 2018 S. 2509.
52 Hartl, 2021 S.1.
- Quote paper
- Anonymous,, 2023, Rosenheim auf dem Weg in die Moderne. Städteplanerische Konzepte um 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1559540