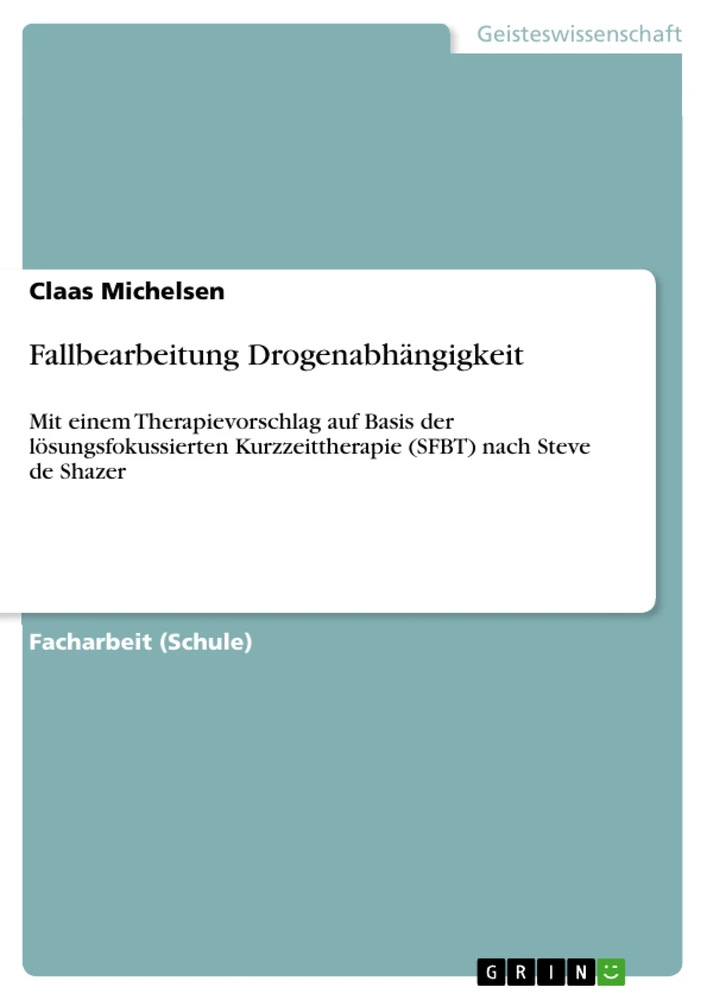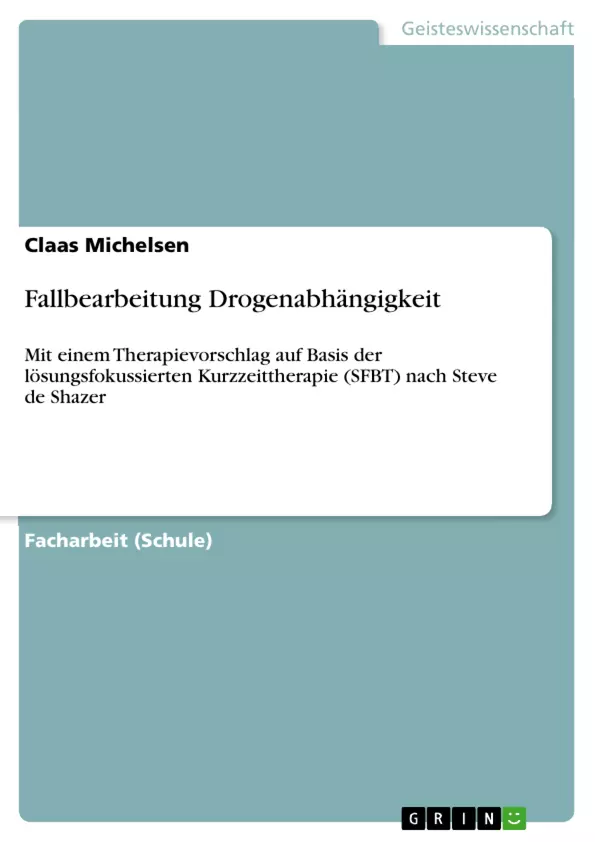Diese Arbeit widmet sich der Fallbearbeitung eines heroinabhängigen Jugendlichen und analysiert dessen familiäre Situation. Basierend auf der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie nach Steve de Shazer wird ein therapeutischer Ansatz vorgestellt, der Ressourcen und vorhandene Lösungsansätze in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus werden Verhaltenstherapie und Hypnosetherapie als ergänzende Methoden im Kontext der Heroinabhängigkeit diskutiert. Die Arbeit wurde im Rahmen der Ausbildung an der Paracelsus Schule Hamburg verfasst und bietet Einblicke in therapeutische Interventionsmöglichkeiten bei substanzbezogenen Störungen.
Inhalt
1 Leitgedanken
2 Analyse der Falldaten
3 Problemanalyse
4 Vorläufig vermutete Diagnose
5 Klärung des Therapieziels
6 Übersicht über mögliche Therapieverfahren
6.1 Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie (SFBT)
6.1.1 Wirkmechanismen bei Sucht
6.1.2 Empirische Studien und Anwendung
6.1.3 Bewertung
6.2 Verhaltenstherapie
6.2.1 Wirkmechanismen bei Sucht
6.2.2 Empirische Studien und Anwendung
6.2.3 Bewertung
6.3 Hypnosetherapie
6.3.1 Wirkmechanismen bei Sucht
6.3.2 Empirische Studien und Anwendung
6.3.3 Bewertung
7 Therapievorschlag auf Basis der Lösungsfokussierten Kurzzeittherapie
7.1 Familientherapie
7.2 Einzelsitzungen und lösungsfokussierte Therapie
7.3 Achtsamkeit und Coping-Strategien
7.4 Einbindung von sozialen Ressourcen
7.5 Rückfallprophylaxe und Krisenintervention
7.6 Differenzierung zwischen Wünschen und Ressourcen
8 Erfolgskontrolle
Literatur- und Quellenverzeichnis
1 Leitgedanken
Der Verfasser sieht in Psychotherapie und psychologischer Beratung eine Chance, aktiv zum Wohler-gehen von Einzelpersonen und der Gesellschaft beizutragen. Ein effektiver Ansatz, um Menschen zu helfen, die ihr seelisches Gleichgewicht verloren haben und ihre vorhandenen Ressourcen zu erkennen und gezielt einzusetzen, ist die Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie (SFBT). Die lösungsorientierte Ar-beit zielt darauf ab, neue Wege aufzuzeigen und kleine, realistische Schritte zur Verbesserung zu ent-wickeln, anstatt sich vor allem auf Probleme und deren Ursachen zu konzentrieren. Dies trägt dazu bei, zu erkennen, dass nahezu jeder Mensch in der Lage ist, seine Herausforderungen im gegenwärtigen Moment anzunehmen und zu meistern (De Shazer, 1992).
Der Verfasser hat durch die Teilnahme an einer 20-stündigen Lehranalyse und eine Einführung in die systemisch-lösungsorientierte Psychotherapie die Erkenntnis gewonnen, dass therapeutische Wirksam-keit nicht darin liegt, mit allen Mitteln helfen zu wollen. Es geht vielmehr darum, dem Klienten Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten - was ein zentrales Prinzip der Lösungsfokussierten Kurzzeittherapie ist. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Klienten, eigene Stärken und Ressourcen zu erkennen und spezifische Lö-sungsstrategien für seine individuellen Herausforderungen zu erarbeiten. Der Therapeut soll nicht Lö-sungen vorgeben, sondern zielgerichtete Fragen stellen, um dem Klienten zu helfen, seine eigenen Fähigkeiten zur Problembewältigung zu aktivieren.
Ein Therapeut sollte seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und die individuelle Problemstruktur des Klienten erfassen, analysieren und den Weg zu einer geeigneten Therapie vorbereiten, damit dieser Ansatz funktionieren kann. Es ist wichtig, ein hohes Maß an Sensibilität zu zeigen, um nicht die eigenen Überzeugungen oder Ideen zur Veränderung über die des Klienten zu stellen. Der Therapeut sollte stattdessen eine respektvolle, offene und fragende Haltung einnehmen, um die Selbstwirksamkeit des Klienten zu unterstützen. Nur so kann die Therapie nachhaltig wirksam sein und dem Klienten helfen, eigene Lösungen zu entwickeln und langfristig zu verankern.
In der Suchttherapie, die häufig Klienten aus verschiedenen sozialen Kontexten umfasst, spielen zahl-reiche komplexe Faktoren eine Rolle. Daher ist die regelmäßige Teilnahme an Supervisionen unabding-bar. Außerdem sollte ein Therapeut die Bereitschaft haben, einen Fall abzulehnen, wenn er erkennt, dass seine eigenen Probleme zu eng mit denen des Klienten verbunden sind (Müller, 1995).
In der heutigen Gesellschaft nimmt die Bedeutung grundlegender menschlicher Werte wie Liebe, Freundschaft, Ganzheit und Geborgenheit zunehmend ab. Diese Entwicklung kann oft zu einer emotio-nalen Leere führen, die Depressionen, Ängste und Verzweiflung nach sich ziehen kann. Eine wach-sende Zahl von Menschen ist nicht mehr in der Lage, innere Stabilität zu finden und ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit zu entwickeln.
In einem Versuch, Halt und Stabilität zu finden, greifen Menschen auf Drogen, Alkohol oder Medika-mente zurück. Oftmals eskaliert die Problematik, nimmt der Konsum zu und es kommt schließlich zur Abhängigkeit, wenn der Betroffene bitter erkennen muss, dass Substanzgebrauch nur eine vorüberge-hende Flucht ist und keine echte Lösung darstellt.
Der Verfasser legt in der Drogen- und Suchttherapie den Schwerpunkt darauf, mit dem Klienten zusam-men bereits vorhandene Ressourcen und positive Erfahrungen zu erkennen und zu fördern. Das Ziel besteht darin, dem Klienten zu helfen, Augenblicke von Zufriedenheit und innerer Ausgeglichenheit auf natürliche Weise zu erleben und dauerhaft in seinem Alltag zu verankern. Eine erfolgreiche Therapie zeigt sich darin, dass der Klient immer mehr in der Lage ist, eigene Lösungen für Herausforderungen zu finden und sein Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Der Autor sieht Sucht und Abhängigkeit als eine der gegenwärtig drängendsten gesellschaftlichen Her-ausforderungen an. Daher wurde das Thema Suchttherapie gewählt. Materieller Wohlstand hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs an Bedeutung gewonnen, was nicht selten zu einem Verlust von innerer Zufriedenheit und dem Wert zwischenmenschlicher Beziehungen führt.
Zunächst erfolgt für die Bearbeitung des Falls eine gründliche Analyse der Falldaten und eine Problem-analyse, bevor eine vorläufige Diagnose gestellt wird. Darauf aufbauend werden drei potenzielle thera-peutische Verfahren präsentiert: die Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie, die Verhaltenstherapie sowie die Hypnosetherapie. Zum Abschluss wird ein Vorschlag für das therapeutische Vorgehen unter Be-rücksichtigung der Lösungsfokussierten Kurzzeittherapie vorgestellt, da der Verfasser diese Therapie-form als Schwerpunkt seiner Ausbildung gewählt hat. Am Ende der Arbeit steht ein Konzept zur Erfolgs-kontrolle.
Vor der Veröffentlichung wurde die Arbeit an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst und der Zitierstil auf den aktuellen Stand der APA gebracht.
2 Analyse der Falldaten
In dieser Arbeit wurde das Fallbeispiel 3 Drogenabhängigkeit ausgewählt. Es geht um den 16-jährigen Thorsten, der eine Schwester hat, die sieben Jahre älter ist. Die Mutter beschreibt diese als eine Person, die ihren Weg schon gefunden hat und ausgezogen ist. Thorsten wird von seiner Mutter als ein Junge beschrieben, der schon immer sehr in die Extreme gegangen sei: Er habe sich bei Greenpeace enga-giert, bei einer Gruppe von Tierschützern und Tierbefreiern und seit zwei Jahren bei einer Gruppe von Punkern und Abhängigen. Auch seine Kleidung und seine Frisur habe er laut Darstellung ganz den Punkern angepasst und ist durch nichts von diesem Stil abzubringen. Über dieses Verhalten habe sich anfangs nur der Vater aufgeregt, was jetzt allerdings überflüssig sei, da ihr Sohn gelegentlich Heroin rauche und auf seinem Computer Rezepte für Rohypnol gefälscht habe, wobei er jetzt erwischt worden sei.
Thorstens Mutter, eine 46-jährige Krankenschwester, charakterisiert ihren Mann, einen Studienrat, als jemanden, der hohe Erwartungen an ihren Sohn in Bezug auf schulische Leistungen habe. Als ihr größ-tes Problem beschreibt die Mutter, dass ihr Sohn genau wisse, was er sich mit dem Rauschgift antue, aber gleichzeitig völlig uneinsichtig sei und dass man mit ihm nicht reden könne. Auch seiner Schwester gegenüber habe er sich verschlossen.
Diese Darstellung des Falls bietet jedoch nur eine Perspektive. Eine Perspektive von Thorsten selbst fehlt, was es schwierig macht, die Gründe und Hintergründe seines Verhaltens besser nachvollziehen zu können. Zu klärende wesentliche Fragen sind: Was ist der Grund für die Besorgnis der Eltern über die Anpassung ihres Sohnes an verschiedene subkulturelle Gruppen? Ist dieses Verhalten nicht mit den Normen und Wertvorstellungen der Familie vereinbar? Welche Assoziationen haben die Eltern zur Punk-Szene, und wie realistisch ist ihre Beurteilung von Thorstens Verhalten?
Drogenkonsum stellt im vorliegenden Fall das schwerwiegendste Problem dar. Die genauen Umstände des Konsums müssen geklärt werden: Wann hat Thorsten begonnen, in welchem Umfang und mit wel-chen zeitlichen Abständen konsumiert er? Vor allem die Bedingungen beim ersten Konsum - hinsichtlich des sozialen Umfelds, des emotionalen Zustands und möglicher familiärer Probleme - sollten weiter untersucht werden.
Alexander J. Müller (1989) beschreibt die Entwicklung einer Drogenabhängigkeit in mehreren Stadien:
- Phase 1: Bereitschaft zum Probieren. In dieser Phase ist der Neuling noch nicht aktiv am Kon-sum beteiligt, sondern beobachtet das Verhalten anderer. Gruppenzwang und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit spielen hier eine zentrale Rolle.
- Phase 2: Das erste Probieren. Dies geschieht häufig unter dem Einfluss von Neugier, Lange-weile oder dem Verlangen, das soziale Ansehen zu heben. Freunde oder Bekannte bieten die Droge meist an, und die Gruppe vermittelt auch das notwendige Wissen über ihren Umgang.
- Phase 3: Häufigerer Konsum. Der Konsum wird regelmäßiger und gewinnt an Bedeutung.
Drogen dienen zunehmend als Bewältigungsstrategie für emotionale oder soziale Probleme.
- Phase 4: Seelische Störungen. Zu diesem Zeitpunkt zeigen sich erste psychische Probleme, wie etwa Konzentrationsschwierigkeiten, eine reduzierte Leistungsfähigkeit und ein wachsen-des Fehlen des Realitätsbewusstseins. Die Substanz findet nun vermehrt Anwendung, um mit persönlichen Belastungen zurechtzukommen.
- Phase 5: Intensiverer Konsum. Der Konsum wird häufiger und geht zu härteren Drogen über, während die ursprünglich genutzten Substanzen an Wirksamkeit verlieren.
- Phase 6: Das Junkie -Stadium. Der Konsum von Drogen wird zur wichtigsten Lebenspriorität. Der Abhängige ist auf die Beschaffung der Droge und den täglichen Konsum angewiesen, was oft zu kriminellen Handlungen führt.
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen lässt sich eine Einordnung in eine der genannten Phasen nur schwer vornehmen. Thorsten hat zwar schon Heroin konsumiert, jedoch gibt es keine Anzeichen für eine intravenöse Anwendung oder auf Beschaffungskriminalität - es sei denn, man betrachtet das Fäl-schen von Rezepten als klassische Beschaffungskriminalität. Auch die Informationen über den Rohyp-nol -Konsum sind ungenau: Angaben zur Konsumhäufigkeit, Dosierung und Anwendungsweise fehlen.
Rohypnol, ein Medikament aus der Gruppe der Benzodiazepine, hat eine beruhigende, angstlösende und schlafanstoßende Wirkung. In der Regel wird es verschrieben, um schwere Schlafstörungen zu behandeln, die auf Angst oder innere Unruhe zurückzuführen sind. Es ist jedoch auch bekannt, dass Rohypnol wegen seiner sedierenden Wirkung von Abhängigen als Ersatzdroge verwendet werden kann, insbesondere in Kombination mit anderen Substanzen wie Heroin. Thorsten könnte Rohypnol als kos-tengünstige und praktische Lösung zur Linderung seiner Entzugserscheinungen genutzt haben, was aufgrund der gefälschten Rezepte naheliegt (Langbein et al., 1983).
Für die weitere Untersuchung des Falls ist auch relevant, welche Bemühungen die Eltern bereits unter-nommen haben, um Thorsten über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären und ihn davon abzu-halten. Es sollte dabei untersucht werden, ob der Klient diese Maßnahmen als hilfreich oder eher als restriktiv wahrgenommen hat, da dies Auswirkungen auf seine Veränderungsbereitschaft haben kann.
3 Problemanalyse
Augenscheinlich ist in diesem Fall die Anpassung des Betroffenen an bestimmte subkulturelle Gruppen und der damit verbundene Drogenkonsum. Wie bereits erwähnt, ist es bislang unklar, warum es die Eltern stört, dass sich ihr Sohn solchen Gruppen zuwendet, da dieses Verhalten offenbar schon vor dem Drogenkonsum als problematisch wahrgenommen wurde.
Thorstens Vater arbeitet als Studienrat und seine Mutter als Krankenschwester - Berufe, die in gewisser Weise ein traditionelles Lebensmodell widerspiegeln. Es scheint, als lebe die Familie in einem sozialen Umfeld, das weitgehend mit den Normen und Erwartungen der Allgemeinheit übereinstimmt. Thorsten fällt aus dem familiären Rahmen, sobald er sich alternativen Gruppen anschließt und ihnen auch äußer-lich durch seine Frisur und Kleidung ein bewusstes Zeichen gibt. Thorstens Schwester, die laut der Mutter „ihren Weg bereits gemacht hat“, scheint ein Leben zu führen, das den Erwartungen der Eltern entspricht. Thorsten entspricht in dieser Situation nicht den Erwartungen seiner Eltern, was Spannungen zur Folge haben kann.
Es kann angenommen werden, dass die Eltern sehr präzise Vorstellungen davon haben, wie sich ihr Sohn entwickeln sollte und welchen schulischen sowie beruflichen Weg er einschlagen müsste. Thors-ten erfüllt diese Erwartungen offensichtlich nicht, was zu einem Konflikt innerhalb der Familie führt. Thorsten zeigt seine Ablehnung dieser Normen, indem er sich in seinem Verhalten und bei der Wahl seiner sozialen Kontakte anders entscheidet, als es die Eltern von ihm erwarten. Diese hoffen auf eine bestimmte Lebensweise und soziale Integration ihres Sohnes. Der bevorstehende Konflikt entsteht im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und Lebenskonzepte.
Wenn die Eltern versuchen, Thorsten von seinem Verhalten und seinem Freundeskreis abzubringen, indem sie ihm erklären, dass diese Gruppenzugehörigkeit nachteilig für ihn sei und er sich besser den Vorstellungen der Eltern anpassen sollte, kann dies bei Thorsten eine Abwehrreaktion hervorrufen. Diese Reaktion könnte die Auseinandersetzung mit den Eltern weiter verschärfen und auch sein Ver-halten verstärken. Thorstens äußeres Verhalten - die Anpassung an die Punker- und Drogenszene - könnte einen Protest gegen die Lebensweise und Erwartungen seiner Eltern darstellen. In diesem Fall könnte sich der Konflikt zwischen den Eltern und ihrem Sohn in einem sich immer weiter zuspitzenden Kreislauf gegenseitiger Reaktionen ausdrücken, wobei jede weitere Intervention der Eltern dazu bei-trägt, die bestehende Distanz zu vertiefen und Thorstens Widerstand zu verstärken.
4 Vorläufig vermutete Diagnose
Im Vordergrund steht die Drogenproblematik, die vermutlich aus der schwierigen Beziehung zu den Eltern entstanden ist. Weitere psychosoziale Aspekte, die möglicherweise zum Drogenkonsum beige-tragen haben, sowie potenzielle psychische Begleitstörungen wie Ängste, Depressionen oder Schlaf-probleme, die ebenfalls als Ursachen in Frage kommen, sind bisher nicht ausreichend erforscht. Um begründete Aussagen machen zu können, wäre eine tiefere Analyse nötig; spekulative Annahmen soll-ten an dieser Stelle hingegen unterlassen werden.
Die Rauschgift- und Medikamentensucht wurde 1957 von der Weltgesundheitsorganisation als ein Zu-stand periodischer oder chronischer Intoxikation beschrieben, der durch wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge hervorgerufen wird. Die Drogenabhängigkeit wird als ein Zustand psychischer oder psychischer und physischer Abhängigkeit von einer Substanz mit zentralnervöser Wir-kung, die zeitweise oder fortgesetzt eingenommen wird, definiert (Vetter, 1995).
Im Fall von Thorsten lassen sich zwei wesentliche Faktoren herauskristallisieren, die ihn zum Drogen-konsum bewegt haben könnten und dessen Fortführung begünstigten. Zum einen spielt das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle, da es als einer der zentralen Risikofaktoren für die Entwicklung einer Drogenabhängigkeit gilt. Thorsten sucht anscheinend, vielleicht als Ausdruck einer bewussten oder un-bewussten Ablehnung der Werte und Erwartungen seiner Eltern, nach sozialen Gruppen, die außerhalb der gesellschaftlichen Normen stehen. Zunächst schließt er sich Tierschützer- und Umweltgruppen an, in denen er eine Möglichkeit findet, sich durch Anpassung in Kleidung, Frisur und Verhalten Anerken-nung zu verschaffen. Thorsten fühlt sich in diesen Gruppen getragen, da er durch sein Engagement eine eigene Identität entwickeln kann, die ihn von den Erwartungen seiner Eltern und der Gesellschaft abhebt. Mit diesem Rückzug kann er seine Ablehnung der Lebensweise der Eltern und den gesellschaft-lichen Normen ausleben.
Als den Eltern klar wird, dass ihre Versuche, Thorsten von seinem Verhalten abzuhalten, nicht fruchten, intensivieren sie ihre Reaktionen. Dies bewirkt bei Thorsten eine Intensivierung seines Widerstandes sowie eine Verlagerung in noch extremere soziale Gruppen. Er findet sich schließlich in einer Subkultur wieder, in der der Konsum psychotroper Substanzen nicht nur akzeptiert, sondern als wesentlicher Be-standteil des Gemeinschaftslebens angesehen wird. Der Gebrauch von Drogen wird zum entscheiden-den Ritual, das den Gruppenzusammenhalt stärkt und Rauschdiskussionen sowie -erfahrungen in den Vordergrund rückt. Thorsten steht in diesem Zusammenhang vor der Wahl, entweder auszusteigen oder weiterzumachen. Ein Ausstieg würde ihn sowohl aus der Gruppe als auch aus dem Konflikt mit seinen Eltern befreien, aber dadurch würde ihm seine Identität und Zugehörigkeit zur Gruppe entzogen werden. Schließlich scheint er sich für die Anpassung an die Gruppe zu entscheiden, was den Konsum von Drogen zur Stärkung seiner Gruppenzugehörigkeit mit sich bringt. Tatsächlich stellt das soziokulturelle Milieu einen wesentlichen Faktor in der Entwicklung einer Drogenabhängigkeit dar (Vetter, 1996).
Zum anderen entwickelt sich die Sucht im Fall von Thorsten zu einem eigenständigen Krankheitsfaktor. Weil er den Rausch und die positiven Gefühle wiederholen will, setzt er den Konsum fort und entwickelt eine körperliche sowie psychische Abhängigkeit.
In Gesprächen mit weiteren Betroffenen stellte der Verfasser fest, dass viele Drogenabhängige anfangs aus Neugier konsumieren, aber im Laufe des Drogenkonsums das Motiv zunehmend von dem Drang geprägt wird, das erlebte Glück oder den Rauschzustand zu wiederholen. Für viele wird die Droge zu einem zunächst einfachen Weg, emotionales Wohlbefinden und Harmonie zu empfinden. Auch bei Thorsten könnte diese Entwicklung eine Bedeutung haben: Der Drogenkonsum könnte auch für ihn eine Möglichkeit bieten, den Spannungen und Konflikten in seiner Familie zu entkommen und eine Art Zu-friedenheit zu erfahren, die ihm im Alltag verwehrt bleibt.
Die vorläufige Diagnose lautet aufgrund der oben genannten Faktoren: Missbrauch von Opiaten (insbe-sondere Heroin, Morphin oder verwandte Substanzen) sowie Missbrauch von Beruhigungs- und Schlaf-mitteln (Barbiturate, Tranquilizer), ohne (körperliche) Abhängigkeit (DIMD, 1996).
5 Klärung des Therapieziels
An dieser Stelle ist es schwierig, ein eindeutiges Therapieziel zu benennen, da Thorstens Mutter bislang nur ein Beratungsgespräch in Anspruch genommen hat. Es ist den vorliegenden Informationen nicht eindeutig zu entnehmen, ob Thorsten tatsächlich eine Psychotherapie anstrebt und ob er über die not-wendige Motivation zur Therapie sowie Einsicht in seine Erkrankung verfügt. Die Festlegung von The-rapiezielen sollte zudem vorrangig in Absprache mit dem Betroffenen erfolgen, um seine Perspektive zu berücksichtigen und eine tragfähige therapeutische Beziehung aufzubauen.
Am Anfang eines jeden therapeutischen Prozesses ist es wichtig, den Klienten nach seinen individuellen Zielen zu fragen. Es ist wichtig, dass er die Gelegenheit hat, seine eigene Situation zu beschreiben und anschließend seine Erwartungen an die Therapie bzw. den Beratungsprozess zu äußern. Diese offene Fragestellung ermöglicht es, realistische und erreichbare Ziele zu entwickeln, die sich an den Bedürf-nissen des Klienten orientieren. Um einen Therapieplan zu erstellen, sollten nach der Benennung des Therapieziels Details wie die konkreten Schritte zur Verwirklichung des Ziels besprochen werden.
Es wäre für Thorsten von Bedeutung, zuallererst zu bestimmen, was er sich in seinem Leben wünscht - sowohl in Bezug auf seine Suchtproblematik als auch auf die familiären Konflikte. Hat Thorsten schon ein deutlich umrissenes Ziel, kann darauf aufbauend die Arbeit fortgesetzt werden. Möglicherweise be-ginnt dann auch eine Therapie oder es erfolgt eine zusätzliche Beratung. Falls ein derartiges Ziel nicht besteht, wäre es essenziell, bei den kommenden Schritten sowohl die Untersuchung des Problems als auch die Ausarbeitung konkreter und umsetzbarer Therapieziele vorrangig zu behandeln.
Um Therapieziele gemeinsam zu entwickeln, stehen mehrere erprobte Vorgehensweisen zur Verfü-gung. Dazu gehören unter anderem gezielte Fragestellungen, eine Wunsch- oder Angstliste, eine Auf-listung der gewünschten Veränderungen im Selbstbild sowie Selbst- und Fremdeinschätzungen (Ham-brecht, 1996). Mit diesen Instrumenten kann eine individuelle und differenzierte Zielentwicklung vorge-nommen werden.
In Thorstens Fall sollte das wichtigste Therapieziel jedoch - unabhängig von weiteren Details - zunächst darin bestehen, eine dauerhafte Abstinenz von psychotropen Substanzen zu erreichen. Der Missbrauch von Substanzen ist nicht bloß eine kurzfristige Krise, sondern stellt eine eigenständige Störung dar, die einer Behandlung bedarf.
Um Thorsten zu einer stabilen emotionalen und sozialen Integration zu verhelfen, ist es neben der Abs-tinenz wichtig, die zugrunde liegenden psychosozialen Konflikte zu bearbeiten und nach Lösungen zu suchen. Dazu zählt auch, die Spannungen innerhalb der Familie zu reduzieren und eine Kommunikati-onsgrundlage zwischen Thorsten und seinen Eltern zu schaffen, die eine langfristige, gesunde Bezie-hung unterstützt.
6 Überblick über mögliche Therapieverfahren
6.1 Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie (SFBT)
Die Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie ist ein ressourcenorientierter Ansatz, der sich auf Lösungen anstatt auf Probleme konzentriert. Der von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in den 1980er Jahren entwickelte Therapieansatz hat sich als vielversprechend bei der Behandlung von Suchterkrankungen erwiesen. Anstatt sich eingehend mit der Vergangenheit oder den Ursachen der Abhängigkeit ausei-nanderzusetzen, liegt der Fokus auf den vorhandenen Stärken des Patienten und der Entwicklung einer abstinenzfördernden Zukunft (Berg & Miller, 1995).
6.1.1 Wirkmechanismen bei Sucht
Die Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie setzt auf spezifische Gesprächsstrategien, um bei Klienten mit Heroinabhängigkeit positive Veränderungen zu bewirken:
- Fokus auf Lösungen statt Probleme: Klienten werden ermutigt, nach Lösungen zu suchen, anstatt sich mit den negativen Aspekten ihrer Abhängigkeit auseinanderzusetzen (De Shazer, 1995).
- Anerkennung von Ausnahmen: Therapeutische Gespräche finden Augenblicke, in denen sich das Suchtverhalten nicht zeigte, um diese absichtlich zu fördern (Berg & Miller, 1995).
- Skalierungsfragen: Klienten schätzen ihre Fortschritte auf einer Skala ein, um positive Verän-derungen zu verdeutlichen und motivierende Ziele zu formulieren (O'Hanlon & Weiner-Davis, 1989).
- Zukunftsorientierung: Statt Rückfälle und vergangenes Fehlverhalten thematisiert, richtet sich die Therapie auf das mögliche Aussehen eines suchtfreien Lebens (Walter & Peller, 1992).
6.1.2 Empirische Studien und Anwendung
Einige Studien zeigen, dass lösungsfokussierte Ansätze erfolgreich bei Suchterkrankungen angewen-det werden können. Laut einer Studie von Gingerich und Eisengart (1996) erzielen Patienten, die eine lösungsfokussierte Therapie erhalten, raschere Fortschritte und zeigen eine größere Abstinenzmotiva-tion. Die Methode hat sich in der Praxis, besonders in ambulanten Therapieeinrichtungen, wo schnelle und effektive Veränderungen notwendig sind, als wirksam erwiesen.
Die Arbeit von Berg und Miller (1992) stellt ein Beispiel für die Nutzung der Lösungsfokussierten Kurz-zeittherapie im Bereich der Suchttherapie dar. Sie zeigten auf, dass Patienten sich durch spezifische lösungsorientierte Fragen intensiver mit ihren eigenen Kompetenzen zur Bewältigung ihrer Suchtprob-lematik beschäftigen. Dadurch wird das Verhalten nachhaltiger verändert und die Rückfallquote verrin-gert.
6.1.3 Bewertung
Indem sie Ressourcen, Stärken und mögliche Lösungen in den Vordergrund rückt, bietet die Lösungs-fokussierte Kurzzeittherapie eine wertvolle Ergänzung zur herkömmlichen Suchtbehandlung. Sie un-terstützt Heroinabhängige dabei, sich auf eine Zukunft ohne Drogen zu fokussieren und wirksame Be-wältigungsstrategien zu erarbeiten, indem sie das Gespräch strukturiert und zugleich flexibel führt.
6.2 Verhaltenstherapie
Als eine der wirksamsten Behandlungsmethoden für Suchterkrankungen hat sich die Verhaltensthera-pie erwiesen. Vor allem bei der Behandlung von Heroinabhängigkeit wird sie als wesentliche Maß-nahme angewendet, um dysfunktionale Verhaltensweisen zu durchbrechen und alternative Strategien zu entwickeln. Die Lerntheorie, insbesondere die Forschungen von Skinner (1973) und Bandura (1979), bildet die Grundlage der Verhaltenstherapie.
6.2.1 Wirkmechanismen bei Sucht
Die Grundlage der Verhaltenstherapie ist die Bestimmung und Anpassung jener Verhaltensweisen, die zur Aufrechterhaltung der Abhängigkeit beitragen. Es werden dabei unterschiedliche Methoden ver-wendet:
- Kognitive Umstrukturierung: Klienten lernen, ihre Abhängigkeit aus einer neuen Perspektive zu betrachten, indem sie dysfunktionale Denkmuster identifizieren und verändern (Beck et al., 1997).
- Konfrontation mit Auslösern für die Sucht: In kontrollierten Umgebungen werden Klienten ab-sichtlich Trigger-Situationen ausgesetzt, um ihre Reaktionen zu verändern (Marlatt & Gordon, 1985).
- Operante Konditionierung: Abstinenzfördernde Verhaltensweisen werden durch positive Ver-stärkung unterstützt, während negatives Verhalten konsequent verhindert wird (Higgins et al., 1994).
- Training sozialer Fähigkeiten: Da soziale Isolation und Mängel in der Konfliktbewältigung oft mit Suchtkrankheiten verbunden sind, werden gezielt soziale Kompetenzen trainiert (Margraf, 1996).
6.2.2 Empirische Studien und Anwendung
Studien zeigen, dass die Verhaltenstherapie bei Heroinabhängigkeit wirksam ist. Carroll et al. (1994) fanden in einer Studie heraus, dass die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) eine signifikante Rückfall-reduktion bewirken kann. Forschungen von Rawson et al. (1995) belegen zudem, dass eine Kombina-tion aus Verhaltenstherapie und medikamentösen Ansätzen (z.B. Methadon) besonders effektiv ist.
Ein anderes Beispiel ist die Kontingenzmanagement-Therapie, bei der abstinentes Verhalten durch Belohnungen gefördert wird. Forschungen ergaben, dass diese Herangehensweise eine hohe Erfolgs-quote bei der Bewahrung der Abstinenz aufweist (Petry et al., 1999).
6.2.3 Bewertung
Die Verhaltenstherapie stellt eine evidenzbasierte Behandlungsoption für Heroinabhängigkeit dar, in-dem sie gezielt problematische Verhaltensweisen und Denkmuster adressiert. Ihr Erfolg gründet sich auf der Implementierung lerntheoretischer Ansätze, der Unterstützung alternativer Bewältigungsstra-tegien sowie der Förderung abstinenzfördernder Verhaltensweisen.
6.3 Hypnosetherapie
Die Behandlung von Suchterkrankungen mittels Hypnosetherapie hat sich als vielversprechend erwie-sen. Im Bereich der Heroinabhängigkeit kann sie als zusätzliches Verfahren zur herkömmlichen Sucht-therapie eingesetzt werden. Ihr Potenzial zur Veränderung von Wahrnehmung, Verhalten und physio-logischen Prozessen wurde bereits in den frühen Arbeiten zur Hypnose untersucht (Schultz, 1994).
6.3.1 Wirkmechanismen bei Sucht
Die Grundlage der Hypnosetherapie ist die Herbeiführung eines Trancezustands, in dem das Unbe-wusste für Suggestionen besonders empfänglich ist. So ist es möglich, neue Denkmuster und Verhal-tensweisen zu festigen. Bei Menschen mit Heroinabhängigkeit kann dies vor allem in den folgenden Bereichen nützlich sein:
- Verminderung des Suchtdrucks (Craving): Posthypnotische Suggestionen ermöglichen es Pa-tienten, Suchtreize anders zu interpretieren und alternative Bewältigungsstrategien zu erarbei-ten (Miller & Diehl 1990).
- Änderung von nicht funktionalen Denkweisen: Hypnose hat die Fähigkeit, tief verwurzelte Überzeugungen zur Abhängigkeit zu verändern und das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu för-dern (Spiegel & Spiegel, 1978).
- Hilfe beim Entzug: Hypnose kann laut Studien körperliche Entzugserscheinungen wie Schlaf-probleme, Ängste und Schmerzen verringern (Barber, 1969).
6.3.2 Empirische Studien und Anwendung
Forschungen aus den 70er- und 80er-Jahren zeigen, dass eine erfolgreiche Integration von Hypnose in die Suchttherapie möglich ist. Als Beispiel dient die Studie von Blum et al. (1983), in der der Einfluss hypnotischer Suggestionen auf das Verlangen nach Opiaten untersucht und positive Effekte dokumen-tiert wurden. Eine Untersuchung von Kline (1972) ergab ebenfalls, dass durch Hypnose der Heroin-konsum zurückgehen kann.
Auch die Ego-State-Therapie stellt ein Beispiel dar: Dabei werden unterschiedliche innere Persönlich-keitsanteile angesprochen, um destruktive Muster zu überwinden (Watkins, 1993). In der Suchtbe-handlung wurde diese Methode erfolgreich eingesetzt, um innere Konflikte zu klären und die Abstinenz zu festigen.
6.3.3 Bewertung
Hypnosetherapie kann eine nützliche Ergänzung zu medikamentösen und psychotherapeutischen Be-handlungen von Heroinabhängigkeit sein. Sie entfalten ihre Wirkung, indem sie unbewusste Prozesse gezielt beeinflussen, die Abstinenzmotivation stärken und Entzugssymptome verringern.
7 Therapievorschlag auf Basis eines lösungsfokussierten Ansatzes
Es sollte zunächst angemerkt werden, dass eine ambulante Therapie durch einen nicht-ärztlichen Psy-chotherapeuten nur möglich ist, wenn die vorläufige Diagnose - Drogen- und Medikamentenmissbrauch ohne körperliche Abhängigkeit - bestätigt wird. Wenn eine körperliche Abhängigkeit von Morphin oder Benzodiazepinen festgestellt wird, sollte der Entzug ärztlich überwacht und möglicherweise stationär durchgeführt werden.
Sollte Thorstens im Anschluss an die Beratung den Beginn einer Therapie wünschen, so sollten sowohl eine Familientherapie, an der sich Thorsten und seine Eltern beteiligen, als auch eine Einzeltherapie, an der nur Thorsten teilnimmt, vorgeschlagen werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche ambulante Therapie ist in diesem Fall, dass alle Beteiligten, zumindest aber Thorsten selbst, freiwillig teilnehmen.
7.1 Familientherapie
Die Familientherapie befasst sich zunächst mit der Beschreibung und Analyse des Familiensystems. Es wird analysiert, auf welche Weise Verhaltens- und Beziehungsmuster sich negativ auf die Gesamtsitu-ation auswirken und zu zwischenmenschlichen Konflikten führen und diese perpetuieren. Das Ziel be-steht in einer verbesserten Kommunikation sowie in einem besseren Verständnis für die Situation der anderen Familienmitglieder. Allein das bewusste Wahrnehmen dieser Verknüpfungen kann zu Einsicht führen und daraufhin zu Änderungen im Verhalten sowie zu Verbesserungen im Umgang miteinander (Georgi et al., 1990).
Konstruktive Abgrenzungsstrategien, vor allem im Hinblick auf Drogenmissbrauch, sollten besonders betont werden. Bei einer konstruktiven Abgrenzung geht es nicht nur darum, die familiären Konflikte zu begreifen. Vielmehr ist es auch notwendig, konkrete Lösungsansätze zu entwickeln, wie Thorsten sich verhalten kann, ohne gegen seine Eltern und deren Vorstellungen anzukämpfen. Es ist von Be-deutung, dass Lösungen gemeinsam entwickelt werden, die der Lebensrealität der Familie gerecht werden, um die Bereitschaft zur Umsetzung neuer Verhaltensweisen zu fördern.
7.2 Einzelsitzungen und lösungsfokussierte Therapie
Falls Thorsten für Einzelsitzungen offen ist, kann auch hier lösungsfokussiert vorgegangen werden. An-statt die Ursachen des Suchtverhaltens in den Fokus zu rücken, wird aktiv nach positiven Ausnahmen gesucht: Existieren Zeiten, in denen die Konflikte mit den Eltern nicht vorkommen oder keine wesentli-che Rolle spielen? Wie unterscheiden sich die Tage, an denen Thorsten keinen Drogenkonsum zeigt, von anderen? Werden derartige Ausnahmen identifiziert, so lassen sich daraus Verhaltensänderungen ableiten, die dazu führen, dass die Ausnahme nach und nach zur Norm wird.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Therapie wird darin bestehen, dass Thorsten seine langfristigen Ziele und Werte festlegt. Was würde er in seinem Leben machen, wenn er keine Drogen mehr konsumieren würde? Welche Träume und Wünsche sind ihm wichtig? Diese positiven Visionen können als Wegwei-ser dienen und Antrieb für die nächsten Schritte im Therapieprozess sein.
7.3 Achtsamkeit und Coping-Strategien
Thorsten kann im Laufe der Therapie auch Achtsamkeitstraining und die Entwicklung von Bewälti-gungsstrategien erlernen. Diese Methoden können ihm dabei helfen, mit emotionalen und stressigen Situationen umzugehen, ohne auf Drogen zurückzugreifen. Entspannungsübungen, alternative Verhal-tensstrategien und die Arbeit mit Rückfallprognosen könnten dabei eine wesentliche Rolle spielen. Es geht darum, Thorsten zu helfen, seine Emotionen auf gesunde Weise zu regulieren und die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen.
7.4 Einbindung von sozialen Ressourcen
Die lösungsfokussierte Therapie sollte zudem verstärkt auf Thorstens soziale Ressourcen eingehen. Das bedeutet, dass er motiviert wird, positive soziale Kontakte zu suchen und zu pflegen, sei es mit Freunden, Bekannten oder anderen vertrauenswürdigen Personen. Diese sozialen Netzwerke können ihm eine bedeutende Unterstützung bieten und im Prozess der Abstinenz eine entscheidende Rolle spielen. Es wäre auch möglich, das Thema der Unterstützung durch Selbsthilfegruppen anzusprechen. Diese könnten ein neues soziales Umfeld für Thorsten bieten und ihn bei seiner Genesung unterstüt-zen.
7.5 Rückfallprophylaxe und Krisenintervention
Die Therapie sollte eindeutige Strategien für Krisensituationen und Rückfälle ausarbeiten. Thorsten könnte mit dem Therapeuten Situationen untersuchen, die Rückfälle fördern, und erfahren, wie er ihnen wirksam begegnen kann. Rückfallprognosen können ein entscheidender Faktor dafür sein, risikobe-haftete Situationen frühzeitig zu identifizieren und ihnen vorzubeugen. Dies könnte auch die Ausarbei-tung eines Krisenplans umfassen, der Thorsten konkrete Handlungsstrategien für herausfordernde Si-tuationen bietet.
7.6 Differenzierung zwischen Wünschen und Erwartungen
Ein weiteres Ziel der Therapie ist, dass Thorsten lernt, zwischen den Lebensanforderungen seiner Eltern und seinen eigenen Wünschen und Träumen zu differenzieren. Das bedeutet nicht, dass er den Erwar-tungen seiner Eltern entsprechen muss. Vielmehr sollte er eine konstruktive Abgrenzung finden, die ihm erlaubt, seinen eigenen Weg zu gehen, ohne seine Eltern vollständig abzulehnen. Seine eigene Identi-tätsentwicklung und die Formulierung realistischer Erwartungen und Wünsche werden durch ein vertief-tes Verständnis für seine Eltern und deren Sichtweise erleichtert.
8 Erfolgskontrolle
Im Verlauf dieser Arbeit wurde bereits die Empfehlung ausgesprochen, vollständige Abstinenz als das Hauptziel der Therapie festzulegen. Auch für die Erfolgskontrolle stellt diese Zielsetzung die Grundlage dar. Diese sollte sich konsequent auf eine Reduktion des Konsums und auf eine Förderung alternativer Bewältigungsstrategien stützen.
Es ist notwendig, dass die Erfolgskontrolle nicht nur den Drogenkonsum als isolierten Faktor misst, sondern auch Thorstens Fähigkeit bewertet, neue, gesündere Verhaltensweisen zu entwickeln, die den Konsum ersetzen. Es ist zu fragen, wie erfolgreich es ist, Thorsten nicht nur zur Abstinenz zu motivieren, sondern ihn auch dann zu unterstützen, wenn diese mit einer Neuordnung seines sozialen Umfelds verbunden ist. Dafür könnte es nötig sein, dass Thorsten neue Beziehungen und Strukturen entwickelt, um alte Kontakte zu vermeiden, die den Konsum fördern. Aus diesem Grund sollte die Erfolgskontrolle auch den sozialen Kontext sowie das soziale Netzwerk berücksichtigen, weil soziale Unterstützung eine wesentliche Komponente der Suchtbewältigung darstellt.
Derzeit ist anzunehmen, dass Thorsten sich noch in der Phase des Missbrauchs befindet und keine ausgeprägte körperliche Abhängigkeit besteht. Es ist aus dieser Sichtweise heraus sinnvoll, Thorsten einen gewissen Spielraum bei Entscheidungen zu geben. Dank des lösungsfokussierten Ansatzes kann Thorsten in dieser frühen Phase seiner Sucht aktiviert werden, um ein Bewusstsein für die Notwendig-keit von Abstinenz zu entwickeln, ohne dass ihm eine vollständige Abstinenz auferlegt wird. Es wäre stattdessen möglich, sich darauf zu konzentrieren, Ressourcen und positive Entwicklungen zu identifi-zieren, die Thorsten dabei unterstützen, sein Verhalten schrittweise zu ändern.
Die Aufgabe der Eltern sollte es nicht nur sein, das Konsumverhalten von Thorsten zu beobachten, sondern auch aktiv eine unterstützende Rolle im Veränderungsprozess einzunehmen. Durch gezielte Kommunikation, die auf Lösungsmöglichkeiten statt auf Defizite fokussiert, können die Eltern das Selbst-bewusstsein und die Selbstwirksamkeit von Thorsten stärken. Eine regelmäßige Reflexion über die Fort-schritte (z.B. wöchentliche oder monatliche Gespräche) ermöglicht es, die Erfolgskontrolle flexibel und an den individuellen Fortschritt anzupassen.
Ein erster Hinweis darauf, dass die Therapie erfolgreich war, wäre ein belegbarer Rückgang des Kon-sums. Kann Thorsten den Konsum von Drogen und Medikamenten erheblich verringern oder vollständig einstellen, so kann der therapeutische Prozess fortgesetzt werden. In diesem Fall könnten weiterfüh-rende therapeutische Maßnahmen, wie Gespräche zur Bewältigung von Konsumauslösern, die Erwei-terung sozialer Kompetenzen und Stressbewältigungsstrategien, hilfreich sein.
Bei steigendem Konsum, Auftreten von Entzugserscheinungen oder dem Hinzukommen weiterer Prob-leme wie Beschaffungskriminalität wäre eine umfassendere Intervention notwendig. In solchen Fällen ist es unerlässlich, dass Thorsten stationär entgiftet wird und eine weiterführende Suchttherapie erhält, um seine körperliche Gesundheit und psychische Stabilität zu gewährleisten.
Literatur- und Quellenverzeichnis
A) Bücher
Bandura, A. (1979). Sozial-kognitive Lerntheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.
Barber, T. X. (1969). Hypnosis: A Scientific Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
Beck, A. T., Wright, F. D., Newman, C. F., & Liese, B. S. (1997). Kognitive Therapie der Sucht. Wein-heim: Beltz.
Berg, I. K., & Miller, S. D. (1995). Kurzzeittherapie bei Alkoholproblemen: Ein lösungsorientierter An-satz (2. Aufl.). Heidelberg: Auer.
De Shazer, S. (1992). Wege der erfolgreichen Kurztherapie (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
De Shazer, S. (1995). Der Dreh: Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie (4. Aufl.). Heidelberg: Auer.
Georgi, H., et al. (1990). Familientherapie. Mannheim: PAL.
Hambrecht, M. (1996). Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik. München: Quintessenz.
Kline, M. V. (1972). Drug Addiction: A Hypnotic Approach. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.
Langbein, K., et al. (1983). Bittere Pillen. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Margraf, J. (1996). Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Heidelberg/Berlin: Springer.
Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). Relapse Prevention. New York: Guilford Press.
Miller T. & Diehl B. (1990). Moderne Suggestionsverfahren: Hypnose, Autogenes Training, Biofeed-back, Neurolinguistisches Programmieren. Berlin/Heidelberg: Springer.
Müller, A. J. (1980). Drogen - Fakten, Hintergründe und Perspektiven. In: H. Körner (Hrsg.), Heroin - Die süchtige Gesellschaft. Fellbach: Lucy Körner Verlag.
Müller, H. J. (1995). Suchttherapie und Supervision: Berufliche Probleme und Paradoxien in der statio-nären Suchttherapie und deren Einfluss auf die Struktur und inhaltliche Entwicklung einer Teamsuper-vision mit Suchttherapeuten. Frankfurt am Main: Peter Lang.
O'Hanlon, W. H., & Weiner-Davis, M. (1989). In Search of Solutions: A New Direction in Psychother-apy. New York: Norton.
Schultz, J. H. (1994). Hypnose-Technik. New York: Gustav-Fischer-Verlag.
Skinner, B. F. (1973). Wissenschaft und menschliches Verhalten = Science and Human Behavior. München: Kindler.
Spiegel, H., & Spiegel, D. (1978). Trance and Treatment. New York: Basic Books.
Vetter, B. (1995). Psychiatrie. Stuttgart: Gustav-Fischer-Verlag.
Walter, J. L., & Peller, J. E. (1992). Becoming Solution-Focused in Brief Therapy. New York: Brun- ner/Mazel.
Watkins, J. G. (1993). Ego States: Theory and Therapy. New York: Norton.
B) Zeitschriftenartikel
Blum, K., Cull, J. G., Braverman, E. R., & Comings, D. E. (1983). Reward Deficiency Syndrome. Amer-ican Scientist, 71 (6), 638-647.
Carroll, K. M., Rounsaville, B. J., & Nich, C. (1994). Cognitive Therapy for Cocaine Dependence. Ar-chives of General Psychiatry, 51 (12), 989-997.
Gingerich, W. J., & Eisengart, S. (1996). Solution-Focused Brief Therapy: A Review of the Outcome Research. Journal of Brief Therapy, 1 (2), 1-22.
Higgins, S. T., Delaney, D. D., Budney, A. J., Bickel, W. K., Hughes, J. R., & Foerg, F. (1994). A be-havioral approach to achieving initial cocaine abstinence. American Journal of Psychiatry, 151 (7), 1061-1070.
Petry, N. M., Martin, B., Cooney, J. L., & Kranzler, H. R. (1999). Give them prizes, and they will come. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67 (5), 804-811.
C) Monographien
Rawson, R. A., Obert, J. L., McCann, M. J., & Marinelli-Casey, P. J. (1995). Relapse prevention with central stimulant abusers. NIDA Research Monograph, 152, 97-113.
D) Sonstige
DIMD (1996): ICD-9, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-heitsprobleme. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.
[...]
- Quote paper
- Claas Michelsen (Author), 1997, Fallbearbeitung Drogenabhängigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1558996