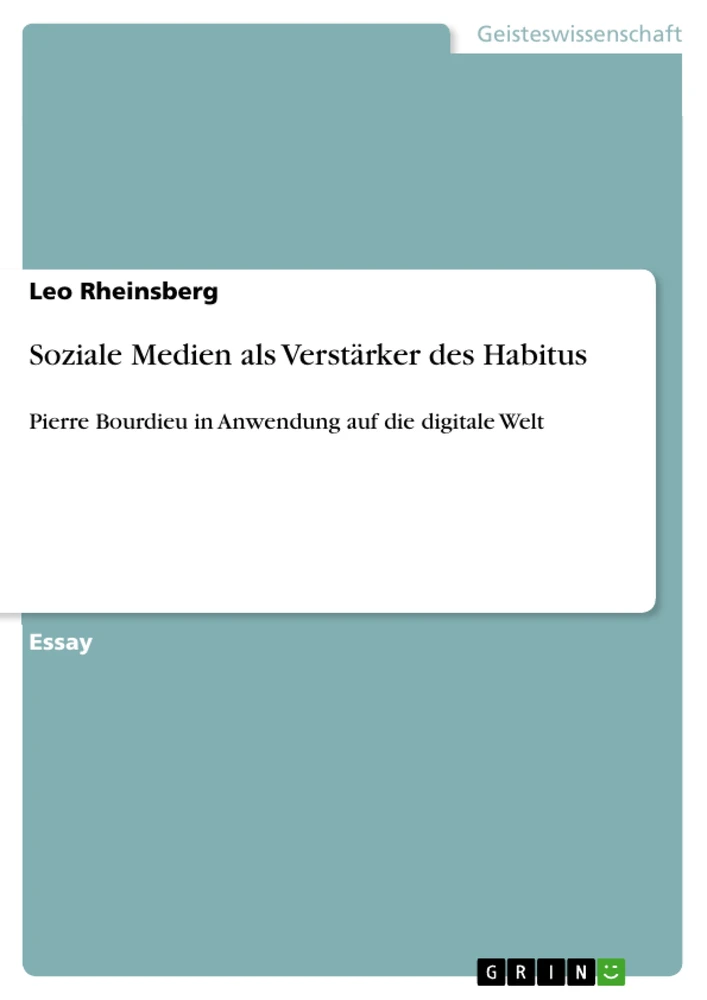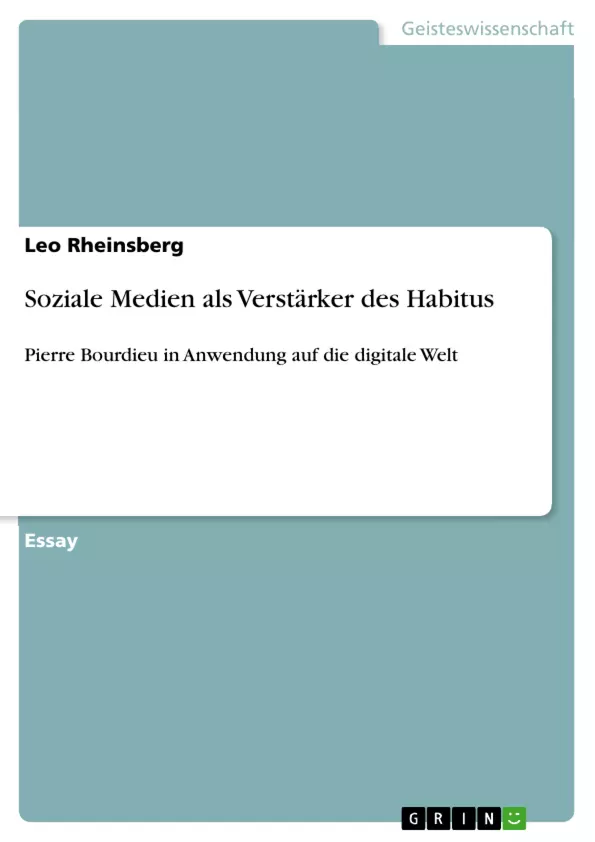Es ist jetzt an der Zeit die gesellschaftliche Relevanz, der von wenigen Großkonzernen vorangetriebenen Digitalisierung, anzuerkennen.
Seit dem Beginn dieses Jahrtausends hat die globale Gesellschaft nichts so sehr verbunden und so sehr gespalten wie die Online-Welt und ihre Sozialen Medien. Es liegt diesem digitalen Wandel ein Prozess fortwährender gesellschaftlicher Ungleichheit bei, der sich zudem noch zu verstärken scheint. Begriffe wie „Echokammer“, „Fake News“ und „Filter Bubble“ sind allgegenwärtig. Damit einhergehend wachsen Polarisierung, Populismus und Rechtsextremismus, drei Phänomene, die in Teilen auch von den Konzernen Facebook und Alphabet (Google & YouTube) gestützt werden.
Soziale Medien als Verstärker des Habitus
Seit dem Beginn dieses Jahrtausends hat die globale Gesellschaft nichts so sehr verbunden und so sehr gespalten wie die Online-Welt und ihre Sozialen Medien. Es liegt diesem digitalen Wandel ein Prozess fortwährender gesellschaftlicher Ungleichheit bei, der sich zudem noch zu verstärken scheint. Begriffe wie „Echokammer“, „Fake News“ und „Filter Bubble“ sind allgegenwärtig. Damit einhergehend wachsen Polarisierung, Populismus und Rechtsextremismus, drei Phänomene, die in Teilen auch von den Konzernen Facebook und Alphabet (Google & YouTube) gestützt werden (vgl. Vogl 2021: 166, 171f).
Es istjetzt an der Zeit die gesellschaftliche Relevanz, der von wenigen Großkonzernen vorangetriebenen Digitalisierung, anzuerkennen. So nutzten von den 14- bis 59-jährigen Deutschen im vierten Quartal 2019 89,7 % digitale online Medien (vgl. Andree und Thomsen 2020: 42). Angeführt wird die Gestaltung der digitalen Welt von Quasi-Monopolisten wie den „Big 4“ (Facebook (Instagram & WhatsApp), Alphabet (Google & YouTube), Apple, Amazon), auf diese entfallen 45 % der gesamten Online-Nutzungsdauer (vgl. Andree & Thomsen 2020: 200). Innerhalb der Sozialen Medien machen Facebook und Alphabet zusammen eine Nutzungsdauer von 94 % aus (vgl. Staab 2019:104ff). Soziale Medien im engeren Sinn sind, was den Anteil der Nutzungsdauer in Deutschland angeht, also ohne Messenger wie z.B. WhatsApp einzubeziehen, zu 82,9 % dem Facebook-Konzern zugehörig (Andree & Thomsen 2020: 146).
Die anfänglichen Hoffnungen von mehr Gerechtigkeit, Partizipation und einer Weltgesellschaft, die zusammenrückt, die die Gründungszeiten des Internets um die Jahrtausendwende begleitet haben, sind den Realitäten der Kommerzialisierung gewichen. Die digitale Konzentration hat in Bezug auf den „Grad der Ungleichverteilung der gesamten Aufmerksamkeit“ (Andree & Thomsen 2020: 30) laut einer im dritten Quartal des Jahres 2019 durchgeführten Studie von Andree und Thomsen, einen Gini-Koeffizienten (statistisches Maß zur Abbildung von Ungleichheit) von 0,988 (entspricht 98,8 %) erreicht, was einer extrem hohen Konzentration entspricht (vgl. Andree & Thomsen 2020: 29f). Diese Verhältnisse sind demokratiegefährdend, wie auch Professor Hindman von der University of Arizona, in seinem 2018 erschienenem Buch „The Internet Trap: How the Digital Economy Builds Monopolies and Undermines Democracy“ ausführt.
Hierfür nennen Andree und Thomsen in ihrem 2020 erschienenem „Atlas der digitalen Welt“ geschlossene Standards, Netzwerk- und Lock-in-Effekte sowie Selbstverstärkungsmechanismen als Gründe. Diese Effekte liegen innerhalb der Technik, doch die Menschen, die diese Technik unreflektiert hinnehmen und benutzen, sind der wesentliche Faktor für solche Zustände der Konzentration. Dabei gibt es seit Beginn des Internets andere Optionen in der digitalen Welt, mit denen sich Nutzer*innen ohne ein automatisches Auslösen der genannten Effekte online bewegen können: So bieten globale Open Source Projekte und Tech-Kollektive alternative unkommerzielle, transparente und hochwertige digitale Infrastrukturen, Betriebssysteme und vieles mehr (siehe Anhang).
Zunächst möchte ich analysieren wie Menschen in den sogenannten Sozialen Medien zusammen kommen oder sich abgrenzen und welche Rolle der genutzten Technik dabei zu kommt. Diesem Zusammenkommen liegt die Annahme zugrunde, dass die Gruppenzugehörigkeit in den Sozialen Medien genauso wie im analogen Leben fundamental vom jeweiligen Habitus eines Menschen beeinflusst wird.
Doch wo genau verlaufen die Grenzen von Ein- und Ausgrenzung zwischen den Menschen in den Sozialen Medien und wirken diese nicht eher als Verstärker vom jeweiligen Habitus bzw. als Ausgrenzungsverstärker? Wie zeigt sich dies in der Praxis und inwiefern kann dies mit Theorien von Pierre Bourdieu erklärt werden? Welche Wirkung haben Soziale Medien auf die Gesellschaft?
In der Auseinandersetzung mit den Sozialen Medien werde ich in Teilen einen Fokus auf die Anwendung von Facebook legen. Dabei können andere Anwendungsarten von Facebook und anderen Sozialen Medien in diesem Essay nicht hinreichend berücksichtigt werden. Zunächst folgt eine Erläuterung von Bourdieus Habitus-Konzept, um anschließend auf dieser Grundlage das Phänomen der Sozialen Medien zu untersuchen.
Im Jahr 1987 - über ein Jahrzehnt bevor die ersten Sozialen Medien im Internet entstanden - erschien Bourdieus Werk „Die feinen Unterschiede“, in dem er sein Habitus-Konzept auch im Zusammenhang mit Lebensstil und Distinktion erläuterte. Mit Habitus ist u.a. ein Rahmen des Seins eines Individuums gemeint, der durch das Sein anderer geprägt wird und wiederum diese prägt - ein Wechselspiel zwischen den Menschen untereinander und der Umstände in denen sie sich bewegen (vgl. Jenkins 2006: 51). Der Habitus gilt als verinnerlicht (inkorporiert) und mehrheitlich unbewusst oder unreflektiert. Was der Begriff „Habitus“ meint „[...] ist ein System von Grenzen. [...] Aber innerhalb dieser Grenzen ist er durchaus erfinderisch, sind seine Reaktionen keineswegs immer schon im Voraus bekannt.“ (Bourdieu 1987: 33). Mit Bourdieu ist der Habitus auch als ein System zu begreifen, das einer bestimmten Struktur entspricht innerhalb dieser er wiederum in demjeweiligen Rahmen strukturierend wirkt. In Bourdieus Worten: „Habitusformen sind Systeme dauerhafterDispositionen - strukturierte Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu wirken, d.h. als Erzeugungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen.“ (Bourdieu 1979: 165). Demnach kann der Habitus nicht nur als Habitus einer Person gedacht werden, sondern auch als Habitus einer Gruppe von Personen.
Bourdieu unterteilt die Gesellschaft in drei soziale Klassen: Die herrschende Klasse, die mittlere Klasse und die Volksklasse. In diesen sind verschiedene soziale Milieus vertreten (vgl. Trültzsch-Wijnen 2020: 430). Die Verortung des Menschen in der Gesellschaft und im spezifischen Raum der sozialen Positionen bestimmt Bourdieu über zwei (Haupt-) Kapitalarten: dem ,kulturellem Kapital4 und dem ökonomischem Kapital4. Die Ausprägung und Konstellation dieser Kapitalarten sind im Einzelfall bestimmend für die Position in der sich ein Mensch befindet, welcher Lebensstil und Habitus ihm zu eigen ist und welcher Geschmack diesem entspricht (vgl. Bongaerts 2008: 62).
Bourdieu geht davon aus, dass die Ausprägung des Habitus durch die Position des Menschen in der Gesellschaft und nicht durch das Individuum selbst bestimmt wird. Die unteren Klassen eifern dem Geschmack der oberen Klassen nach, sind jedoch begrenzt durch den Mangel verschiedener Kapitalarten. Die obere Klasse ist getrieben von der Abgrenzung (Distinktion) gegenüber den tiefer liegenden Klassen. Dabei erklärt Bourdieu den Hang zur Distinktion als unbewusste Handlung, die durch den Habitus intendiert ist (vgl. Fröhlich & Rehbein 2009: 105). Auf allen Ebenen des dem Habitus entsprechenden Lebensstils zementiert der Geschmack Unterschiede zwischen den Klassen und deren Milieus (vgl. Bourdieu 1987: 284ff). Der Habitus wirkt sich ebenfalls auf die Nutzung Sozialer Medien aus. Auch in der digitalen Welt bestimmt der Habitus wie und mit wem interagiert wird, was für ein Eintrag erstellt wird und welcher nicht. Wobei alle Daten, die von Menschen generiert werden, von Algorithmen weiterverarbeitet werden, die u.a. dazu programmiert sind einen Rahmen zu strukturieren in dem der Mensch möglichst lange Zeit online bleibt (vgl. Simon 2020: 32ff; vgl. Stöcker & Lischka 2018: 372), schon allein aufgrund der Logik von Konkurrenz und Profitmaximierung, der jedes Unternehmen im gegenwärtigen kapitalistischen System unterliegt. Diese Programmierung und die gesamte Struktur der Plattform selbst wirken sich wiederum strukturierend auf den Habitus aus: „Auch Individualprofile sind nichts als maschinell strukturierte Massenphänomene, die den datengenerierten Habitus des <Dividuellen> hervorbringen.“ (Vogl 2021: 179) (erläuternde Literatur zum „Dividuellen“ im Anhang). Wobei beispielsweise die algorithmisch beeinflussten Nutzungsmöglichkeiten und „persönliche“ Profileinstellungen von Facebook seit Beginn dazu einladen sich dem eigenen Habitus (bzw. dem seines Milieus) entsprechend einzurichten und die eigenen Beiträge einer selbst gewählten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit anderen zu verwehren.
Bourdieu erklärt den Habitus als ein Produkt von Praktiken und zugleich als ein Produzent von Praktiken. Als ein Produkt von Praktiken ist das Denk- und Wahrnehmungsschemata zu verstehen, welches den Geschmack und das daraus resultierende Handeln mitbestimmt (vgl. Fröhlich & Rehbein 2009: 82).
In der Benutzung von Facebook heißt das konkret, dass die Inhalte, die eine Person auf der Plattform produziert, durch den Habitus beeinflusst sind, diesen manifestieren und reproduzieren. Bestimmte Kommentare, „Likes“; „Shares“, das Hochladen von Fotos und Videos, das Besuchen bestimmter Profile, ist also auf den Habitus dieser Person (bzw. dessen Milieu) zurückzuführen und bietet wiederum die Basis für dessen Entstehen bzw. dessen Verfestigung. Nebenbei werden die Daten, die bei dieser spezifischen Nutzung auftreten von Software abgegriffen und analysiert, worauf aufbauend ein Raster einer entsprechenden Persönlichkeit konstruiert wird. Diesem datengenerierten Habitus entsprechend entstehen personalisierte Ergebnisse welche sogenannte. „Echokammern“ bilden, in denen der Habitus bestätigt und extremer wird. Zugleich wird der Zugang zu solch einer abgesonderten Gruppe strenger geregelt und die Ein- und Ausgrenzung dementsprechend immer determinierter (vgl. Stöcker & Lischka 2018: 382f). Der Austausch zwischen anders Denkenden wird dadurch weniger und die gesellschaftliche Polarisierung (vgl. Carstensen 2021: 422) und der Trend zu „Verschwörungserzählungen“ begünstigt (vgl. Stöcker & Lischka 2018: 382).
Die gruppenbezogene Ein- und Ausgrenzung in den Sozialen Medien findet weitgehend analog wie in der schon eingangs erwähnten und von Bourdieu untersuchten, nicht-digitalen Welt statt. Sie wird verstärkt durch die Struktur und Logiken der Plattformen und den fortwährend wechselseitigen Austausch zwischen Mensch und Technik.
Die Milieus der herrschenden Klasse, welche über große Mengen an ökonomischem Kapital verfügen, heben sich exemplarisch dadurch ab, indem sie ihren Reichtum und ihre Lebensumstände online präsentieren. Diese Lebensumstände können sich die mittlere Klasse und die Volksklasse nicht leisten (Mangel an ökonomischem Kapital). Auch das soziale Kapital, z. B. in Form von Fotos mit Filmstars, Politikerinnen oder Superreichen wird mobilisiert. Ausgegrenzt wird ferner darüber, dass ein Geschmack zur Schau gestellt wird, der sich grundlegend von den Geschmacksausprägungen anderer Milieus abhebt. Um Gefallen an Kunst zu finden braucht es etwa ein hohes kulturelles Kapital. Auch die angewandte Sprache unterscheidet sich zwischen den Klassen (und auch deren Milieus) teilweise so stark, dass sie zu einer Art Ausschlusskriterium wird.
Die Teilhabe am Leben derjenigen, die mit den verschiedenen Kapitalarten besser ausgestattet sind, wird zwar über offen zugängliche Profile in den Sozialen Medien online simuliert, wirkt jedoch eher als Ausgrenzungsverstärker. Dies kann damit begründet werden, dass die Teilhabe eben nur eine virtuelle ist und der Habitus so fundamental unterschiedlich, dass es zu keinen gemeinsamen Überschneidungen kommt (schon gar nicht in der Offline-Welt), sondern eher zur Verstärkung von Unterschieden im Habitus, Vorurteilen und Neid. Gleichzeitig steigt die real wachsende Ungleichverteilung von Kapital und Macht, wie u.a. die Berichte zu sozialer Ungleichheit von der NGO Oxfam seit Jahren belegen (vgl. Oxfam 2021).
Die Verstärkung des Habitus der Individuen und Gruppen auf den verschiedenen Seiten und der wechselseitige Austausch des Habitus zwischen Mensch und digitalem Medium, führt somit zu noch größeren Unterschieden zwischen den Klassen und ihren Milieus. Die Unterschiede bei Menschen mit verschiedenem Habitus bzw. unterschiedlichen Milieu (oder auch einer kleineren Gruppe) werden noch schwerer zu überwinden sein. Noch schwerer als die Überwindung ohnehin schon ist, wirkt das einem jeden Habitus eingeschriebene bzw. inne wohnende Moment der Trägheit gegen Veränderung. Dieses benennt Bourdieu als Hysteresis. Der Begriff Hysteresis ,,[...] erklärt den Konservatismus, der proportional zum Lebensalter zunimmt, die Reproduktion herrschender Zustände und der Situation unangemessenen Verhaltens. Außerdem erklärt er, dass Menschen immer die Umgebung suchen, für die sie am besten ausgerüstet sind, also am ehesten die Umgebung, in der ihr Habitus ausgeprägt wurde.“ (Fröhlich & Rehbein 2009: 114). Damit lässt sich begreifen warum die Nutzung Sozialer Medien Teilhabemöglichkeiten eher suggeriert als tatsächlich eröffnet und in der Praxis bzw. Anwendung zu deutlich stärkeren Abgrenzungsmechanismen als Partizipationspotenzialen führt und dadurch die Verteilung sozialer Positionen und gesellschaftlicher Machtverhältnisse weiter verschärft werden.
Die obigen Ausführungen lassen erkennen, dass das Habitus-Konzept auch auf die digitale Welt anwendbar ist und eine Analyse der Sozialen Medien ermöglicht. Die Interaktion zwischen den Menschen ist dementsprechend, gleichgültig ob online oder offline, nach der Struktur des Habitus angelegt bzw. bewegt sich innerhalb dessen Grenzen.
Bei Betrachtung der Sozialen Medien zeigt sich, dass ihre Webseitenstrukturen derart angelegt sind, dass sie den Nutzer*innen einen Rahmen dafür bieten sich einem nach ihrem Habitus konformen „Wohlfühlraum“ einrichten zu können. Dabei operieren Soziale Medien wie etwa Facebook nach einem Prinzip, dass es wahrscheinlicher macht mit Menschen des selben Habitus bzw. Milieus zusammen zu treffen, sie wirken demnach eingrenzend. Wenn dieses Prinzip nicht greift kommt es zur umgekehrten Auswirkung, der Ausgrenzung. Falls also ein Mensch mit einem Habitus der niedrigeren Klasse auf ein Profil eines Menschen einer höheren Klasse trifft, kann es zu den beschriebenen einseitigen Habitus verstärkenden Reaktionen kommen, da eben die Unterschiede im Habitus zu groß sind um überwunden werden zu können und sich der Habitus der niedrigeren Klasse in der Folge dessen verstärkt.
Des Weiteren wirken selbstverstärkende Mechanismen zwischen Menschen und digitaler Technik. Grund hierfür ist die auf Algorithmen basierte digitale Technik, die sich ähnlich wie ein Mensch dem anderen Menschen gegenüber verhält. Folglich kommt es zu einem Wechselspiel zwischen dem jeweiligen Habitus und ein Verhaltenslernprozess wird in Gang gesetzt. Die involvierten Menschen und digitalen Techniken sind entsprechend zeitgleich sowohl Produkte als auch Produzenten von Praktiken (vgl. Stöcker & Lischka 2018: 373).
Auf diese Weise wird dem menschlichen Verhältnis noch das Digitale hinzugefügt, als ein von Menschen programmierter digitaler Verstärker des Habitus. Über diese Verstärkung wird dann die gesellschaftliche Polarisierung begünstigt, welche sich ebenfalls wieder negativ auf den individuellen Habitus auswirkt.
Die benannten Zusammenhänge und Wechselwirkungen stehen wiederum in Verbindung mit weiteren Faktoren in der Online-Welt, die es alle wert sind genauer wissenschaftlich erforscht zu werden, wie beispielsweise personalisierte Nachrichtenkanäle, personalisierte Suchmaschinenergebnisse, Sucht- und Depressionspotentiale bei der Nutzung Sozialer Medien (siehe dazu „Studien“ im Anhang). Dem gegenüber stehen Faktoren und Ausgangsbedingungen in der Offline-Welt. Zu nennen seien hier insbesondere die Ungerechtigkeiten des Patriarchats und der Klassengesellschaft (vgl. Erden 2020: 84f; vgl. Roxanne 2020: 151), denen die (weißmännliche) symbolische Gewalt u.a. in Form von Algorithmen zugrunde liegt, sowie dominierende Geschlechtsvorstellungen und damit verbundene Ungleichheiten, welche sie online produzieren und manifestieren.
Für all diese und weitere wissenschaftliche Forschung braucht es den selbstverständlichen und sofortigen Zugriff auf alle Daten, die im Internet und in der Benutzung digitaler Maschinen generiert werden (vgl. Andree & Thomsen 2020: 255ff). Statt all diese Daten der Autorität kommerzieller Großkonzerne zu unterstellen, könnten diese anonymisiert und der wissenschaftlichen Forschung im Auftrag des Gemeinwohl anvertraut werden. Diese Veränderung in der Nutzung von digitalen Daten ist längst überfällig, denn die digitale Welt, welche die letzten Jahrzehnte entstanden ist, ist vermutlich keine, die langfristig eine demokratische und friedliche Gesellschaft bildet.
Auf persönlicher Ebene könnte es jetzt ein Schritt sein das eigene Verhalten in der digitalen Welt zu ändern und darüber nachzudenken, welche möglichen persönlichen und gesellschaftlichen Risiken und Konsequenzen das eigene Nutzungsverhalten hat bzw. haben könnte und dementsprechende Verhaltensänderungen selbst herbeiführen. In Bezug auf Soziale Medien könnte das heißen eine der Open Source Alternativen zu Facebook zu verwenden, wie beispielsweise Mastodon, Minds oder Diaspora (siehe Anhang „Open Source Projekte“), um zumindest den selbstverstärkenden Mechanismen zwischen Menschen und digitaler Technik (u.a. in Form von personalisierten Algorithmen) teilweise zu entgehen. Die so weit wie mög- lieh bewusste Reflexion über den eigenen Habitus und den Habitus des jeweiligen Gegenüber sowie die Überwindung des eigenen Habitus ist auehjederzeit zu empfehlen.
Ein weiterer Sehritt beginnt beim Zugang zum Internet. Hierbei kann beispielsweise ein „Tor Browser“ von „The Tor Projeet“ dabei helfen einen privaten Zugang (anonym und ohne per- sönliehe Spuren) zu erhalten und damit unter anderem den persönliehen Beitrag an datengenerierten Algorithmen (die von Quasi-Monopolisten gestaltet werden) zu beenden (mehr im Anhang unter „Zugang zum Internet“). Außerdem hilft die Nutzung von Freier Software (Open Souree) aueh in anderen Bereiehen der digitalen Welt bei der Wahrung der Privatsphäre und der Selbstbestimmung über die eigenen Daten (mehr im Anhang unter „Open Souree Projekte“).
Das Beenden der Nutzung sämtlieher Angebote von Quasi-Monopolisten wie den genannten „Big 4“ und stattdessen die Nutzung entspreehender Open Souree Alternativen und die Angebote von Teeh-Kollektiven stellt einen denk- und maehbaren Sehritt dar, um in der digitalen Welt Strukturen zu vermeiden, welehe die Untersehiede zwisehen den Klassen, ihren Milieus und den versehiedenen Habitus Trägerinnen tendenziell vergrößern. Aueh in der offline Welt bedeutet die Entsagung des Konsums der Produkte kommerzieller Großkonzerne und statt dessen die Nutzung unkommerzieller und solidariseher Alternativen, ein Sehritt Riehtung Abbau der Klassengesellsehaft.
Literaturverzeichnis
Andree, Martin; Thomsen, Timo (2020): Atlas der digitalen Welt. Frankfurt am Main: Campus
Bongaerts, Gregor (2008): Verdrängungen des Ökonomischen. Bourdieus Theorie der Moderne. Bielefeld: transcript
Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Carstensen, Tanja (2020): „Gender und das Digitale - Programmatiken, empirische Ergebnisse und Synergien an der Schnittstelle von Geschlechtersoziologie und Digitaler Soziologie“. In: Wolbring, Maasen, Sabine; Passoth, Jan-Hendrik (Hrsg.) Soziale Welt, Sonderband 23. Soziologie des Digitalen - Digitale Soziologie?. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S.411-429
Erden, Deniz (2020): „KI und Beschäftigung: Das Ende menschlicher Voreingenommenheit oder der Anfang von Diskriminierung 2.0?“. In: netzforma* e.V. (Hrsg.) Wenn KI, dannfemi- nistisch - Impulse aus WissenschaftundAktivismus. Berlin: netzforma*, S. 77 - 90
Fröhlich, Gerhard; Rehbein, Boike (2009): Bourdieu-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler
Jenkins, Richard (2006): Pierre Bourdieu. Key Sociologists. London: The Open University Taylor & Francis e-Library
Roxanne, Tiara (2020): „Re-präsentation verweigern“. In: netzforma* e.V. (Hrsg.) Wenn KI, dann feministisch - Impulse aus Wissenschaft und Aktivismus. Berlin: netzforma*, S. 147 - 156
Simon, Leena (2020): „Digitale Gewalt. Kontrollverlust und (digitale) Entmündigung - Das Gewaltpotential Künstlicher Intelligenz“. In: netzforma* e.V. (Hrsg.) Wenn KI, dann femans- tisch - Impulse aus WissenschaftundAktivismus. Berlin: netzforma*, S.31-46
Staab, Philipp (2019): Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Berlin: Suhrkamp
Trültzsch-Wijnen, Christine W. (2020): Medienhandeln zwischen Kompetenz, Performanz undLiteracy. Wiesbaden: SpringerVS
Vogl, Joseph (2021): Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart. München: C.H.Beck
Internet
Oxfam (2021): „Soziale Ungleichheit“, https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/soziale- ungleichheit [zuletzt aufgerufen am 02.09.2021]
Stöcker, C.; Lischka, K. (2018): „Wie algorithmische Prozesse Öffentlichkeit strukturieren“. In R. Mohabbat Kar; B.E. P. Thapa; P. Parycek (Hrsg.) (Unberechenbar? Algorithmen und Automatisierung in Staat und Gesellschaft. Berlin: Fraunhofer-Institut für Offene Kommuni- kationssystemeFOKUS, Kompetenzzentrum Öffentliche IT(ÖFIT), S.364-391. https://nbn-re- solving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-57598-9 [zuletzt aufgerufen am 24.08.2021]
Anhang
Zum Dividuellen
«Linie-Werden», «Welt-Werden», «Fliehen»
Aktuelles und Virtuelles zum Dividuellen, von Julia Bee: http://e-text.diaphanes.net/doi/10.4472/9783037346273.0015
Open Source Projekte
Soziale Medien: https://joinmastodon.org/
https://www.minds.com/
https://diasporafoundation.org/
Instant-Messaging-Dienste:
https://signal.org/de/#signal
https://threema.ch/de
Betriebssystem: https://www.linuxfoundation.org/
https://tails.boum.org/
Browser: https://www.torproject.org/download/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/
E-Mail-Programm: https://www.thunderbird.net/de/
Digitale Formate abspielen: https://www.videolan.org/vlc/
Büroarbeiten: https://de.libreoffice.org/
Bildbearbeitung: https://www.gimp.org/
Audiobearbeitung: https://www.audacityteam.org/
Filmbearbeitung: https://shotcut.org/
Für weitere Open Source Projekte siehe:
Eclipse Foundation Projektliste https://projects.eclipse.org/
Panglosslabs Open Source Projektliste https://panglosslabs.org/projects/osprojgc/
Tech-Kollektive (mit Solidarischer und Unkommerzieller Digitaler Infrastruktur) https://www.systemli.org/en/index.html
https://systemausfall.org/
https://www.immerda.ch/
https://riseup.net/
https://so36.net/
Zugang zum Internet
Browser: TOR https://www.torproject.org/download/
HTTPS Everywhere: https://www.eff.org/https-everywhere
uBlock - Ad Blocker!https://ublock.org/
NoScript!https://noscript.net/!
(bezalter VPN hider ist damit überflüssig)
...am sichersten in Verbindung mit dem Betriebssystem Tails: https://tails.boum.org/
Studien
Mehr als 100.000 Teenager süchtig nach Social Media: https://www.schau-hin.info/studien/studie-mehr-als-100000-teenager-suechtig-nach-social- mediaLangzeitstudie:
Viel Social Media erhöht Risiko für Depressionen: https://www.schau-hin.info/news/langzeitstudie-viel-social-media-erhoeht-risiko-fuer-depres- sionen
Depressionen durch Social-Media-Nutzung: https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/der-einfluss-sozialer-medien- auf-die-psyche/
Inspiration und Außerdem
Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung: https://www.fiff.de/
Keep the future unwritten: https://capulcu.blackblogs.org/
Electronic Frontier Foundation: https://www.eff.org/
Tracking von o2-Handy deaktivieren: https://www.telefonica.de/dap/selbst-entscheiden.html
Sichere Hardware gibts auf: https://resist.berlin/
[...]
- Arbeit zitieren
- Leo Rheinsberg (Autor:in), 2021, Soziale Medien als Verstärker des Habitus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1554472