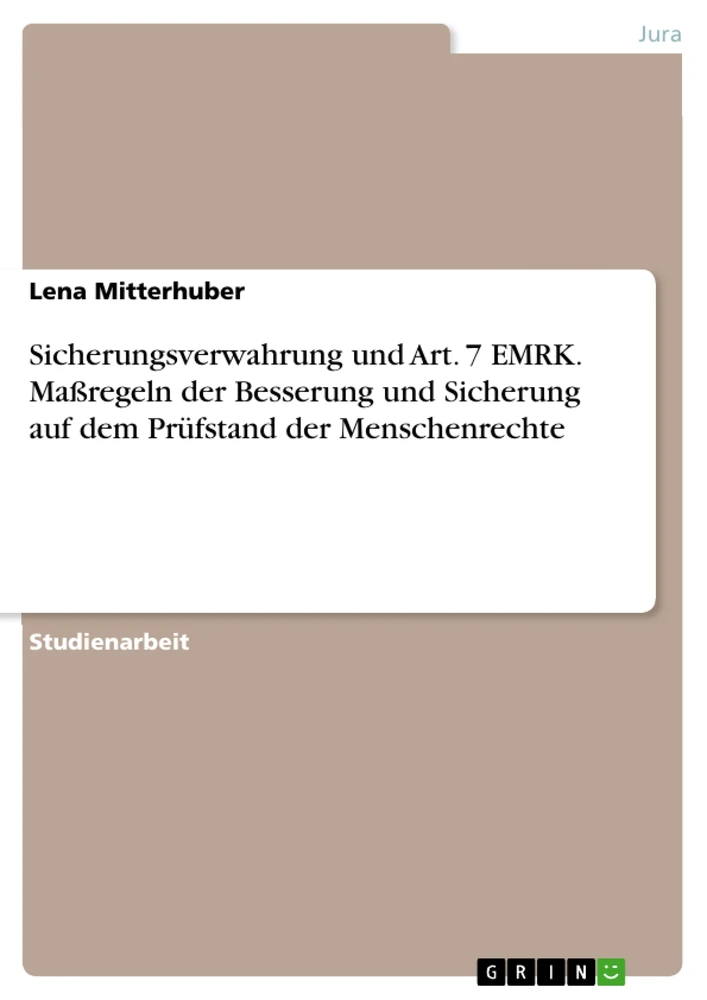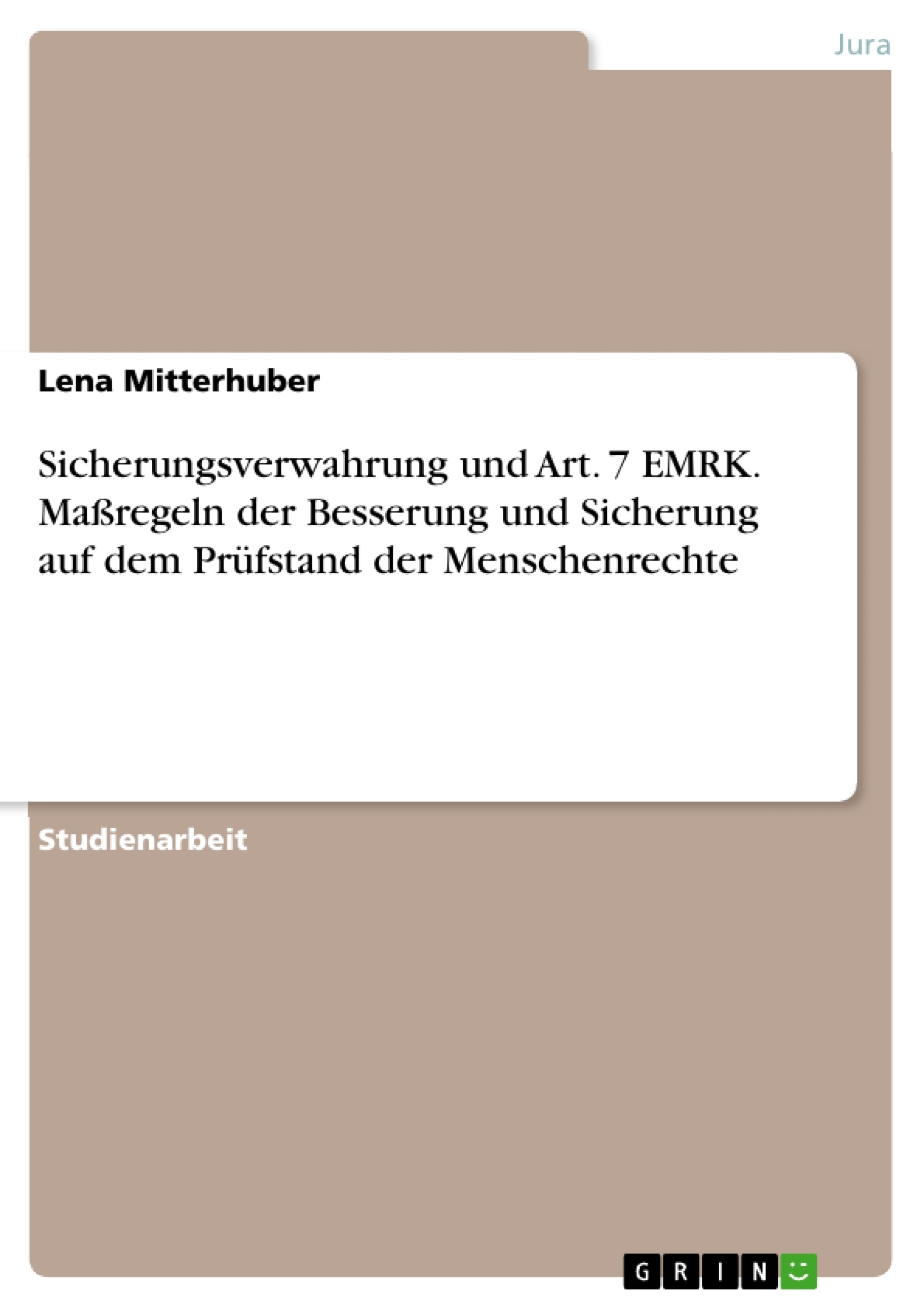Das Rückwirkungsverbot in Art. 7 EMRK sowie Art. 103 II GG verbietet die Verhängung einer schwereren Strafe, als zur Zeit der Tat angedroht. Ob in einem zweispurigen Sanktionensystem auch die Maßregel der Sicherungsverwahrung als Strafe umfasst wird, ist seit jeher umstritten. Die Streitfrage hat nun besondere Bedeutung erlangt durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg vom 17. Dezember 2009 im Fall M./Deutschland. Die Sicherungsverwahrung des M. war verlängert worden, nachdem der deutsche Gesetzgeber im Jahr 1998 die bis dahin geltende zehnjährige Höchstfrist der erstmaligen Sicherungsverwahrung rückwirkend aufgehoben hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Neuregelung 2004 als verfassungskonform erachtet. Der EGMR urteilte hingegen einstimmig, die rückwirkende Verlängerung der Sicherungsverwahrung des M. verstoße gegen Art. 5 I und Art. 7 I EMRK.
Nach einem Überblick über die Geschichte und Ausweitung der Sicherungsverwahrung als Maßregel sowie die Bedeutung und Ausprägungen des Art. 7 EMRK wird die Frage beantwortet, inwiefern die Analyse des EGMR überzeugt und die Sicherungsverwahrung eine Strafe im Sinne des Rückwirkungsverbots der Art. 103 II GG sowie Art. 7 EMRK darstellt. Hierbei werden insbesondere die unterschiedlichen Vorgehensweisen von EGMR und Bundesverfassungsgericht vergleichend herausgearbeitet und bewertet. Sodann wird ein Ausblick auf mögliche Auswirkungen des EGMR Urteils in Deutschland gewagt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung.
- B. Einführung in die Sicherungsverwahrung und Art. 7 EMRK
- I. Die Sicherungsverwahrung im Überblick.
- 1. Ursprung der Sicherungsverwahrung und des Maßregelrechts
- 2. Zweck und Legitimation der Sicherungsverwahrung.
- a) Einführung und Wegfall der zehnjährigen Höchstfrist.
- b) Gesetzesänderungen seit 1998.......
- c) Entwicklung in Zahlen.
- II. Art. 7 EMRK im Überblick: Bedeutung und Ausprägungen.
- C. Sicherungsverwahrung als Strafe im Sinne von Art. 7 EMRK
- I. Bestimmung des Anwendungsbereichs des Rückwirkungsverbots.......
- 1. Enge Auslegung des Rückwirkungsverbots..
- a) Deutsche Rechtsprechung und Literatur..
- b) Bisherige Rechtsprechung des EGMR..
- 2. Weite Auslegung des Rückwirkungsverbots.
- a) Rechtsprechung des EGMR...........
- b) Deutsche Literatur.
- 3. Bewertung..
- 4. Zwischenergebnis.......
- II. Annährung zwischen Sicherungsverwahrung und Freiheitsstrafe
- 1. Die Bedeutung der sog. Anlasstat.
- 2. Vorwurf des Etikettenschwindels
- 3. Vorwurf des Verwahrvollzugs
- 4. Sozialethisches Unwerturteil..
- 5. Weitere Gemeinsamkeiten.
- 6. Ergänzend zum Zweck: Sicherungsverwahrung als Strafe im Sinne des StGB?
- 7. Zwischenergebnis....
- D. Zusammenfassung und Ausblick..................
- I. Zusammenfassung: Sicherungsverwahrung als Strafe iSd Art. 7 EMRK
- II. Ausblick: Auswirkungen des EGMR Urteils im Fall M./D.
- 1. Bindungswirkung des EGMR Urteils M./D .....
- 2. Entlassung von M. sowie anderen Betroffenen
- a) Derzeitiger Entlassungsstand
- b) Entlassungsperspektiven..
- 3. Auswirkungen auf andere Formen der Sicherungsverwahrung
- 4. Völkerrechtskonforme Auslegung .....
- 5. Gesamtreform der Sicherungsverwahrung.
- 6. Ergebnis.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Sicherungsverwahrung im Kontext von Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Sie analysiert die rechtliche und praktische Problematik der Sicherungsverwahrung im Hinblick auf das Rückwirkungsverbot und die Frage, ob sie als Strafe im Sinne von Artikel 7 EMRK anzusehen ist.
- Die historische Entwicklung der Sicherungsverwahrung und ihre rechtliche Grundlage
- Die Interpretation des Rückwirkungsverbots in Artikel 7 EMRK und seine Anwendung auf die Sicherungsverwahrung
- Die rechtliche Einordnung der Sicherungsverwahrung im Vergleich zur Freiheitsstrafe
- Die Auswirkungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)-Urteils im Fall M. / Deutschland auf die Sicherungsverwahrung in Deutschland
- Die Notwendigkeit einer Reform der Sicherungsverwahrung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sicherungsverwahrung und des Rückwirkungsverbots nach Art. 7 EMRK ein. Kapitel B beleuchtet die historische Entwicklung der Sicherungsverwahrung in Deutschland und erläutert den Zweck und die Legitimation dieser Maßregel. Kapitel C analysiert die Frage, ob die Sicherungsverwahrung als Strafe im Sinne von Art. 7 EMRK betrachtet werden kann. Hierbei werden verschiedene Interpretationen des Rückwirkungsverbots sowie die vergleichende Analyse der Sicherungsverwahrung und der Freiheitsstrafe beleuchtet. Kapitel D fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und blickt auf die Auswirkungen des EGMR-Urteils im Fall M./Deutschland auf die Praxis der Sicherungsverwahrung.
Schlüsselwörter
Sicherungsverwahrung, Art. 7 EMRK, Rückwirkungsverbot, Strafe, Freiheitsstrafe, EGMR-Urteil M./Deutschland, Reform, Menschenrechte, Maßregelrecht, Rechtstatsachen, Rechtsprechung, Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Urteil des EGMR vom 17. Dezember 2009 zur Sicherungsverwahrung?
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilte im Fall M./Deutschland, dass die rückwirkende Verlängerung der Sicherungsverwahrung gegen das Rückwirkungsverbot (Art. 7 EMRK) und das Recht auf Freiheit (Art. 5 EMRK) verstößt.
Gilt die Sicherungsverwahrung rechtlich als Strafe?
Während das Bundesverfassungsgericht sie traditionell als präventive Maßregel ansah, stufte der EGMR sie aufgrund ihres Charakters und Vollzugs als „Strafe“ im Sinne der EMRK ein, womit das strikte Rückwirkungsverbot greift.
Was ist der Unterschied zwischen der Sichtweise des EGMR und des Bundesverfassungsgerichts?
Das Bundesverfassungsgericht hielt die Aufhebung der Höchstfrist 2004 für verfassungskonform. Der EGMR hingegen sah darin einen „Etikettenschwindel“, da sich der Verwahrvollzug kaum von der Strafhaft unterscheide.
Welche Auswirkungen hatte das Urteil auf inhaftierte Personen in Deutschland?
Das Urteil führte zur notwendigen Entlassung von Betroffenen, deren Verwahrung rückwirkend über die alte Zehnjahresfrist hinaus verlängert worden war, und erzwang eine Gesamtreform des Maßregelrechts.
Was bedeutet das Rückwirkungsverbot in Art. 7 EMRK?
Es verbietet die Verhängung einer schwereren Strafe als derjenigen, die zum Zeitpunkt der Begehung der Tat angedroht war.
Warum ist die historische Entwicklung der Sicherungsverwahrung relevant?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Sicherungsverwahrung von einer zeitlich begrenzten Maßnahme zu einer potenziell lebenslangen Verwahrung ausgeweitet wurde, was die menschenrechtliche Problematik verschärfte.
- Arbeit zitieren
- Lena Mitterhuber (Autor:in), 2010, Sicherungsverwahrung und Art. 7 EMRK. Maßregeln der Besserung und Sicherung auf dem Prüfstand der Menschenrechte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/154991