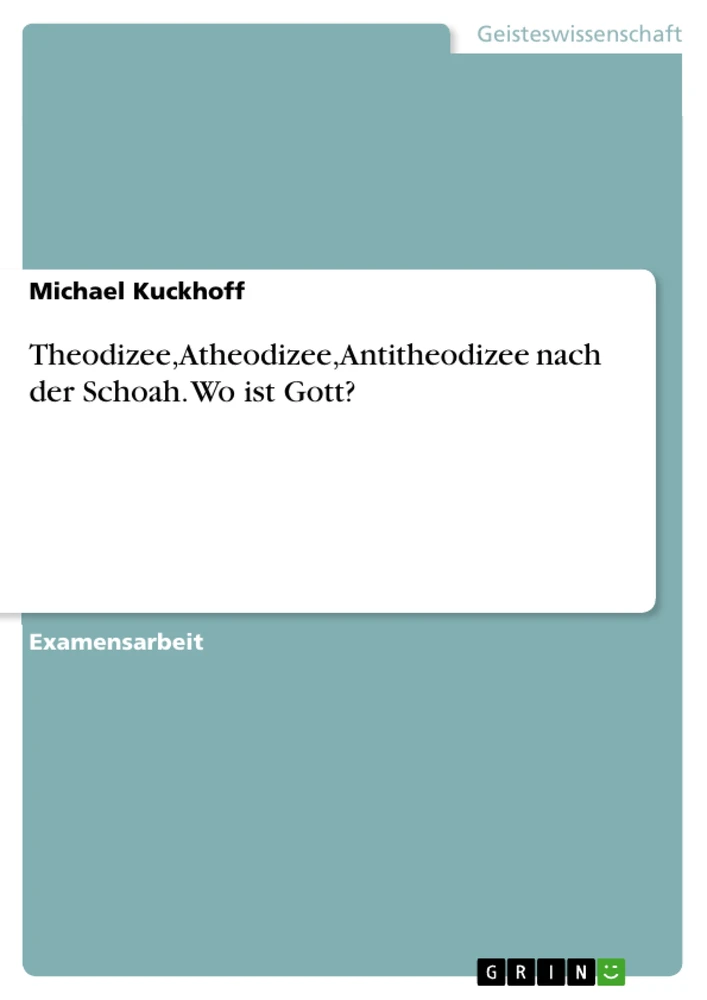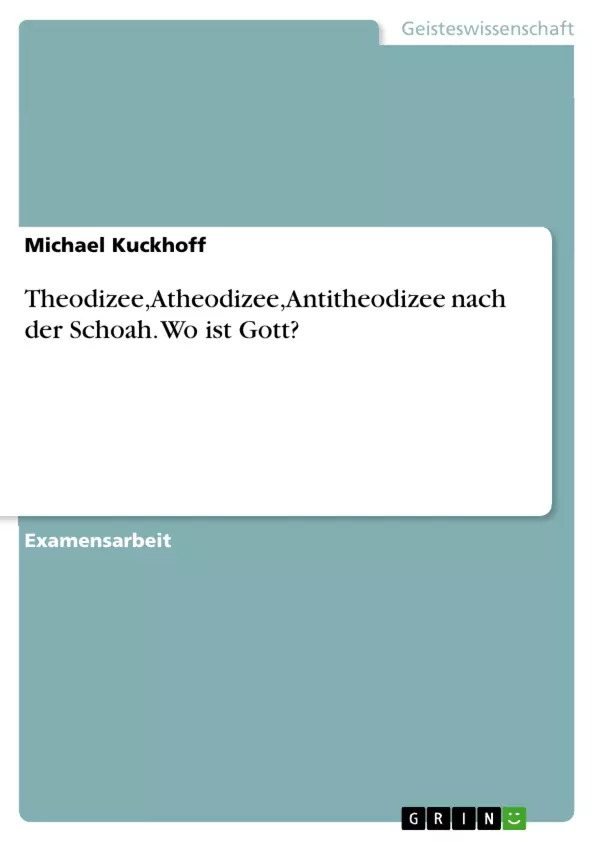Welchen Stellenwert haben die verschiedenen Positionen der Theodizee, Antitheodizee und der Atheodizee im philosophisch-theologischen Diskurs nach der Schoah? Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine qualitative, strukturierte Inhaltsanalyse. Dazu wurden Kommentare jüdischer Philosophen und Theologen einer vergleichenden Untersuchung unterzogen. Dabei ging es um eine inhaltliche Einordnung nach den Reaktionen aus Theodizee, Antitheodizee und Atheodizee.
In der tragischen Geschichte des jüdischen Leidens ragt die systematische Vernichtung des europäischen Judentums durch den Hitlerfaschismus 1933 bis 1945 als einzigartiges und besonders katastrophales Ereignis heraus. Die durch den nationalsozialistischen Terror verursachten existenziellen und spirituellen Qualen haben einen Diskurs ausgelöst, der als "Holocaust-Theologie" bekannt geworden ist. Dieser philosophisch-theologische Diskurs, den ich besser als "Theologie der Schoah" bezeichnen möchte, stellt eine eigene Dimension im jüdischen Denken dar.
Die paradigmatische Manifestation des Leidens in der Schoah hat zahlreiche Philosophen und Theologen herausgefordert, sich mit den Implikationen dieser Katastrophe für den jüdischen Glauben auseinanderzusetzen. Im Gefolge dieses langen, bis heute andauernden Prozesses der kritischen Aufarbeitung erschienen eine Vielzahl von Arbeiten, mit divergenten und auch kontroversen Ansichten zu diesem Thema. Im Mittelpunkt dieser Beiträge stehen Gott und die göttlichen Attribute, die Rolle des Leidens, der Stellenwert des Bösen und die wechselseitigen Bundesbeziehungen des jüdischen Volkes mit Gott.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissenschaftliche Fragestellung
- Methodik
- Jüdische Antworten nach der Schoah
- Auschwitz als Offenbarung
- Ende der jüdischen Bundesexistenz
- Dekonstruktion des traditionellen Gottesbegriffs
- „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“
- Verteidigung der ethischen Verpflichtung der Menschheit
- Theodizee, Atheodizee und Antitheodizee nach der Schoah
- Biblische Modelle
- Akedah
- Hiob
- Eved YHVH (nin)- Der leidende Knecht Gottes
- Hester panim (ª¹ d)- Das verborgene Antlitz Gottes
- Mipnei ḥat'aeinu (1'xvn 'ɔ¶n)
- Verteidigung des freien Willens
- Moderne Antworten auf die Schoah
- Schlussfolgerung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Positionen der Theodizee, Antitheodizee und Atheodizee im philosophisch-theologischen Diskurs nach der Schoah. Sie analysiert, wie jüdische Denker auf die Katastrophe reagiert haben und welche Implikationen dies für den jüdischen Glauben hatte.
- Die Reaktion des jüdischen Glaubens auf die Schoah
- Die verschiedenen theologischen Ansätze zur Erklärung des Holocausts
- Die Rolle biblischer Modelle in der Auseinandersetzung mit dem Leiden
- Die Entwicklung der Holocaust-Theologie im Laufe der Zeit
- Die kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Gottesvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Holocaust als einzigartiges und katastrophales Ereignis dar, das einen intensiven philosophisch-theologischen Diskurs, die „Theologie der Schoah“, ausgelöst hat. Sie skizziert die zentralen Fragen, die diese Theologie aufwirft: das Wesen Gottes, die göttliche Beziehung zum Leiden, die Rolle des Bösen und die Bundesbeziehungen zwischen dem jüdischen Volk und Gott. Die Arbeit selbst konzentriert sich auf die verschiedenen Positionen der Theodizee, Antitheodizee und Atheodizee im Umgang mit diesen Fragen.
Jüdische Antworten nach der Schoah: Dieses Kapitel beschreibt die drei Phasen der jüdischen Auseinandersetzung mit der Schoah, beginnend mit unmittelbaren, oft fragmentarischen Antworten ultraorthodoxer und chassidischer Rabbiner. Die zweite Phase, ab Mitte der 1960er Jahre, zeichnet sich durch rhetorisch kontroverse Antworten aus, die die theologischen Probleme analysieren. Die dritte Phase, ab den späten 1990er Jahren, ist geprägt von kritischer Analyse bestehender Antworten und der Erstellung von Historiografien, inklusive feministischer Perspektiven. Das Kapitel betont die Diversität der Reaktionen und die kontinuierliche Aufarbeitung der Schoah.
Biblische Modelle: Dieses Kapitel untersucht die Verwendung biblischer Modelle, insbesondere der Akedah (die Bindung Isaaks), zur Erklärung des Holocausts. Die Akedah wird als Paradigma des Martyriums verstanden, in dem das Leiden der Juden als Opferbereitschaft und Treue zu Gott interpretiert wird. Simcha Elberg wird als Beispiel angeführt, der die Ereignisse von Treblinka als eine moderne Akedah interpretiert. Das Kapitel betont die Funktion dieser biblischen Analogien im Versuch, den Holocaust theologisch zu verarbeiten und das Leid der Opfer zu erklären.
Schlüsselwörter
Schoah, Holocaust-Theologie, Theodizee, Antitheodizee, Atheodizee, Jüdischer Glaube, Gottesbild, Leiden, Böses, Bund, Biblische Modelle, Akedah, Jüdische Philosophie, Jüdische Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel der Arbeit auf, darunter Einleitung, Wissenschaftliche Fragestellung, Methodik, Jüdische Antworten nach der Schoah (mit Unterpunkten wie Auschwitz als Offenbarung, Ende der jüdischen Bundesexistenz, Dekonstruktion des traditionellen Gottesbegriffs, „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!“, Verteidigung der ethischen Verpflichtung der Menschheit), Theodizee, Atheodizee und Antitheodizee nach der Schoah, Biblische Modelle (mit Unterpunkten wie Akedah, Hiob, Eved YHVH, Hester panim, Mipnei ḥat'aeinu, Verteidigung des freien Willens), Moderne Antworten auf die Schoah, Schlussfolgerung und Ausblick.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht verschiedene Positionen der Theodizee, Antitheodizee und Atheodizee im philosophisch-theologischen Diskurs nach der Schoah. Sie analysiert, wie jüdische Denker auf die Katastrophe reagiert haben und welche Implikationen dies für den jüdischen Glauben hatte. Zu den Themenschwerpunkten gehören die Reaktion des jüdischen Glaubens auf die Schoah, theologische Ansätze zur Erklärung des Holocausts, die Rolle biblischer Modelle, die Entwicklung der Holocaust-Theologie und die kritische Auseinandersetzung mit Gottesvorstellungen.
Was behandelt die Einleitung?
Die Einleitung stellt den Holocaust als ein einzigartiges Ereignis dar und skizziert zentrale Fragen der Theologie der Schoah: das Wesen Gottes, die göttliche Beziehung zum Leiden, die Rolle des Bösen und die Bundesbeziehungen zwischen dem jüdischen Volk und Gott.
Was wird im Kapitel "Jüdische Antworten nach der Schoah" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die drei Phasen der jüdischen Auseinandersetzung mit der Schoah, beginnend mit unmittelbaren Antworten ultraorthodoxer Rabbiner, gefolgt von rhetorisch kontroversen Antworten und schließlich kritischer Analyse und Historiografien. Es betont die Diversität der Reaktionen und die kontinuierliche Aufarbeitung der Schoah.
Was wird im Kapitel "Biblische Modelle" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Verwendung biblischer Modelle, insbesondere der Akedah (die Bindung Isaaks), zur Erklärung des Holocausts. Die Akedah wird als Paradigma des Martyriums verstanden, in dem das Leiden der Juden als Opferbereitschaft und Treue zu Gott interpretiert wird. Es wird betont, dass diese Modelle dazu dienen, den Holocaust theologisch zu verarbeiten und das Leid der Opfer zu erklären.
Welche Schlüsselwörter sind mit der Arbeit verbunden?
Zu den Schlüsselwörtern gehören Schoah, Holocaust-Theologie, Theodizee, Antitheodizee, Atheodizee, Jüdischer Glaube, Gottesbild, Leiden, Böses, Bund, Biblische Modelle, Akedah, Jüdische Philosophie und Jüdische Theologie.
- Arbeit zitieren
- Michael Kuckhoff (Autor:in), 2024, Theodizee, Atheodizee, Antitheodizee nach der Schoah. Wo ist Gott?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1547678