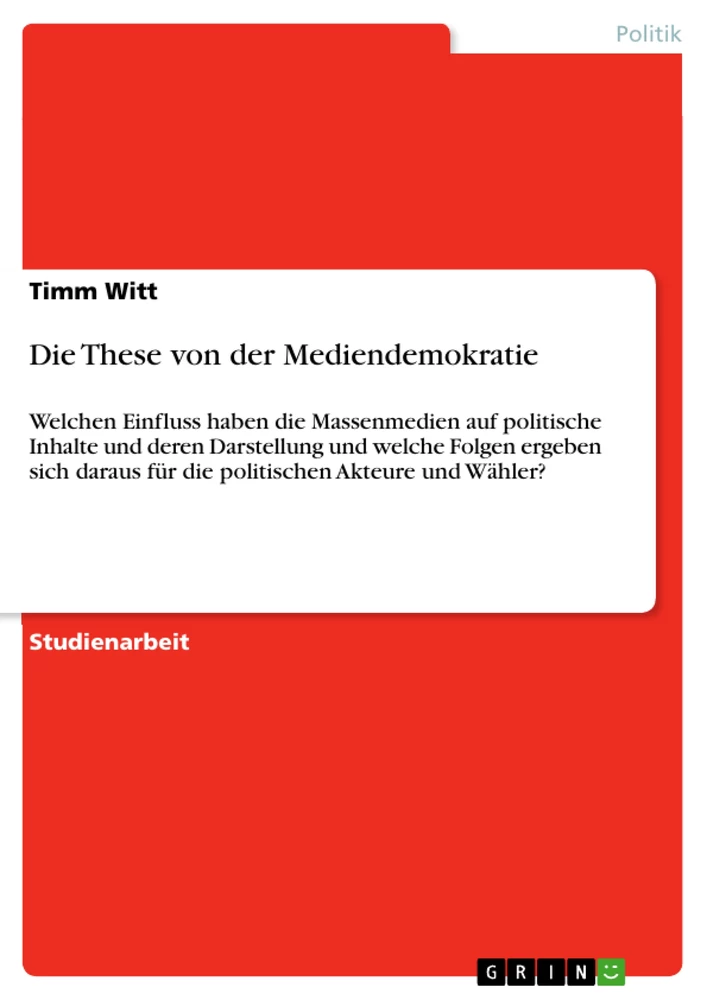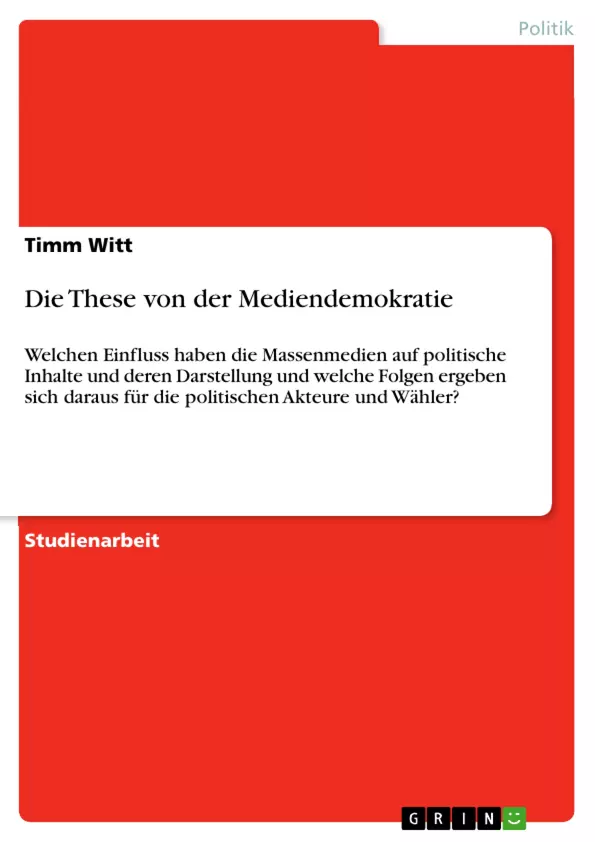Die immer häufigere Verwendung von Begriffen wie bspw. Medienwahlkampf, Medienkanz-ler, Mediengesellschaft oder Mediendemokratie deutet darauf hin, dass den Massenmedien offenbar eine bedeutende Rolle für die Meinungsbildung und das Wahlverhalten und somit für den politischen Prozess zugesprochen wird. Da das politische Geschehen von den Medien dargestellt, interpretiert und kommentiert wird, bilden sie das Bindeglied zwischen den Parteien und den Politikern einerseits und den nach Informationen suchenden Wählern anderseits. Abgesehen vom ohnehin sehr geringen direkten Kontakt zwischen Wählern und Parteien, werden programmatische Aussagen und personelle Profile der Parteien vor allem via Massenmedien an die Wähler vermittelt.
Kann man jedoch dem Schein Glauben schenken, dass die Medien ausnahmslos über politische Themen und Inhalte objektiv berichten? Und welchen Einfluss haben die Massenmedien auf politische Inhalte und deren Darstellung und welche Folgen ergeben sich daraus für die politischen Akteure und Wähler? Sind es wirklich noch die Politiker, die die Themenagenda aufstellen? Diese Fragen sollen im Laufe dieser Hausarbeit diskutiert und abschließend beantwortet werden.
Hierfür wird im Grundlagenteil zunächst der Terminus „Mediendemokratie“ begrifflich abge-grenzt und die rechtliche Grundlage und Funktion der Massenmedien erläutert. Anschließend werden theoretische Ansätze aufgezeigt, die das Verhältnis zwischen Medien und Politik beschreiben.
Im Hauptteil wird auf die Interdependenzen zwischen den Medien, Politikinhalten und Wählern eingegangen, indem die Einflüsse der Medien auf die Themenstrukturen und Ereignisdarstellung aufgezeigt werden. Anschließend findet eine kritische Würdigung der errungenen Erkenntnisse in Form einer Gefahren- und Chancen-Betrachtung einer Mediendemokratie statt.
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung der wichtigsten Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition und theoretische Grundlagen
- 2.1. Abgrenzung des Begriffs der Mediendemokratie
- 2.2. Rechtliche Grundlage und Stellung der Medien in der Verfassung
- 2.3. Funktionen der Massenmedien in der Politik
- 2.3.1. Informationsfunktion
- 2.3.2. Meinungsbildungsfunktion
- 2.3.3. Kritik- und Kontrollfunktion
- 2.3.4. Artikulationsfunktion
- 2.4. Theoretische Ansätze zum Verhältnis von Medien und Politik
- 2.4.1. Gewaltenteilungstheorie: Medien als „vierte Gewalt“
- 2.4.2. Instrumentalisierungs-/Dependenztheorie: Medien als Instrument der Politik oder Politik als Instrument der Medien
- 2.4.3. Symbiosetheorie: Politik und Medien als Interaktionszusammenhang
- 3. Interdependenzen zwischen Medien, Politikinhalten und Wählern
- 3.1. Veränderung der Themenstrukturen
- 3.1.1. Einflüsse der Medien als „Agenda-Setter“
- 3.1.1.2. Das Salience-Modell
- 3.1.1.3. Das Prioritätenmodell
- 3.1.2. Einflussnahme politischer Akteure auf die Medienagenda
- 3.1.2.1. Agenda-Building
- 3.1.2.2. Agenda-Cutting
- 3.1.2.3. Agenda-Surfing
- 3.1.1. Einflüsse der Medien als „Agenda-Setter“
- 3.2. Veränderung der Ereignisdarstellung
- 3.2.1. Orientierung an der Medienlogik
- 3.2.2. Personalisierung
- 3.3. Gefahren und Chancen der Mediendemokratie
- 3.1. Veränderung der Themenstrukturen
- 4. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Massenmedien auf politische Inhalte und deren Darstellung sowie die daraus resultierenden Folgen für politische Akteure und Wähler. Ziel ist es, die These der Mediendemokratie zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Mediendemokratie
- Rechtliche Grundlagen und Funktionen der Medien im politischen Kontext
- Theoretische Ansätze zum Verhältnis von Medien und Politik
- Interdependenzen zwischen Medien, Politikinhalten und Wählerverhalten
- Gefahren und Chancen der Mediendemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss von Massenmedien auf politische Inhalte, deren Darstellung und die daraus resultierenden Konsequenzen für politische Akteure und Wähler. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die zu behandelnden Aspekte, darunter die begriffliche Abgrenzung der Mediendemokratie, die rechtlichen Grundlagen und Funktionen der Medien sowie die Analyse der Interdependenzen zwischen Medien, Politik und Wählern. Die Einleitung unterstreicht die Relevanz des Themas angesichts der zunehmenden Medienpräsenz in politischen Prozessen.
2. Begriffsdefinition und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der begrifflichen Abgrenzung des Terminus „Mediendemokratie“ und differenziert ihn von verwandten Konzepten wie Mediatisierung. Es beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die verfassungsrechtlich garantierte Stellung der Medien, insbesondere die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit. Anschließend werden verschiedene theoretische Ansätze vorgestellt, die das komplexe Verhältnis zwischen Medien und Politik beschreiben, darunter die Gewaltenteilungstheorie, die Instrumentalisierungs-/Dependenztheorie und die Symbiosetheorie. Diese Kapitel legt den theoretischen Grundstein für die Analyse der Interdependenzen zwischen Medien, Politik und Wählern in den folgenden Kapiteln.
3. Interdependenzen zwischen Medien, Politikinhalten und Wählern: Dieses Kapitel analysiert die Wechselwirkungen zwischen Medien, politischen Inhalten und Wählern. Es untersucht den Einfluss der Medien auf die Themensetzung (Agenda-Setting) und die Darstellung politischer Ereignisse. Dabei werden verschiedene Modelle und Mechanismen, wie das Salience-Modell, das Prioritätenmodell, Agenda-Building, Agenda-Cutting und Agenda-Surfing, detailliert erläutert. Des Weiteren wird die zunehmende Orientierung an der Medienlogik und die Personalisierung politischer Kommunikation analysiert. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Betrachtung der Gefahren und Chancen einer Mediendemokratie ab.
Schlüsselwörter
Mediendemokratie, Mediatisierung, Massenmedien, Politik, Wählerverhalten, Meinungsbildung, Agenda-Setting, Medienlogik, Personalisierung, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Gewaltenteilung, Interdependenzen.
Häufig gestellte Fragen zu "Mediendemokratie": Eine umfassende Übersicht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Mediendemokratie. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzungserklärung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Massenmedien auf politische Inhalte, deren Darstellung und die daraus resultierenden Folgen für politische Akteure und Wähler. Die Arbeit beleuchtet und hinterfragt kritisch die These der Mediendemokratie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: die begriffliche Abgrenzung der Mediendemokratie, die rechtlichen Grundlagen und Funktionen der Medien im politischen Kontext, verschiedene theoretische Ansätze zum Verhältnis von Medien und Politik (Gewaltenteilungstheorie, Instrumentalisierungs-/Dependenztheorie, Symbiosetheorie), die Interdependenzen zwischen Medien, Politikinhalten und Wählerverhalten (Agenda-Setting, Medienlogik, Personalisierung), sowie die Gefahren und Chancen der Mediendemokratie.
Welche theoretischen Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene theoretische Ansätze zum Verhältnis von Medien und Politik, darunter die Gewaltenteilungstheorie (Medien als "vierte Gewalt"), die Instrumentalisierungs-/Dependenztheorie (Medien als Instrument der Politik oder umgekehrt) und die Symbiosetheorie (Politik und Medien als Interaktionszusammenhang). Diese Ansätze bilden die Grundlage für die Analyse der komplexen Interaktionen zwischen Medien, Politik und Wählern.
Wie wird der Einfluss der Medien auf die politische Agenda behandelt?
Der Einfluss der Medien auf die politische Agenda wird im Kontext des Agenda-Setting untersucht. Dabei werden verschiedene Modelle und Mechanismen detailliert erläutert, wie das Salience-Modell, das Prioritätenmodell, Agenda-Building, Agenda-Cutting und Agenda-Surfing. Die Arbeit analysiert, wie Medien die Themensetzung beeinflussen und wie politische Akteure versuchen, die Medienagenda zu beeinflussen.
Welche Aspekte der Medienberichterstattung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die zunehmende Orientierung an der "Medienlogik" in der politischen Kommunikation und die zunehmende Personalisierung politischer Ereignisse. Diese Aspekte werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die politische Meinungsbildung und das Wählerverhalten untersucht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung ab, die die zentralen Ergebnisse zusammenfasst und die Gefahren und Chancen der Mediendemokratie kritisch bewertet. Sie bietet keine endgültigen Antworten, sondern regt zur weiteren Auseinandersetzung mit dem komplexen Verhältnis zwischen Medien, Politik und Öffentlichkeit an.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Mediendemokratie, Mediatisierung, Massenmedien, Politik, Wählerverhalten, Meinungsbildung, Agenda-Setting, Medienlogik, Personalisierung, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Gewaltenteilung, Interdependenzen.
- Arbeit zitieren
- Timm Witt (Autor:in), 2009, Die These von der Mediendemokratie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/154496