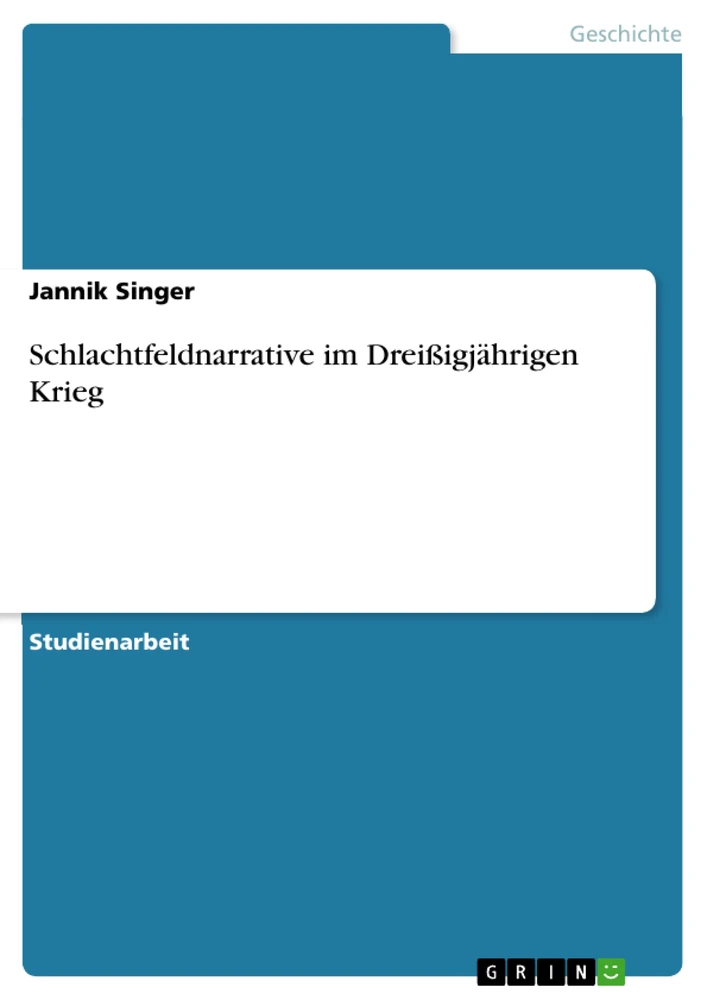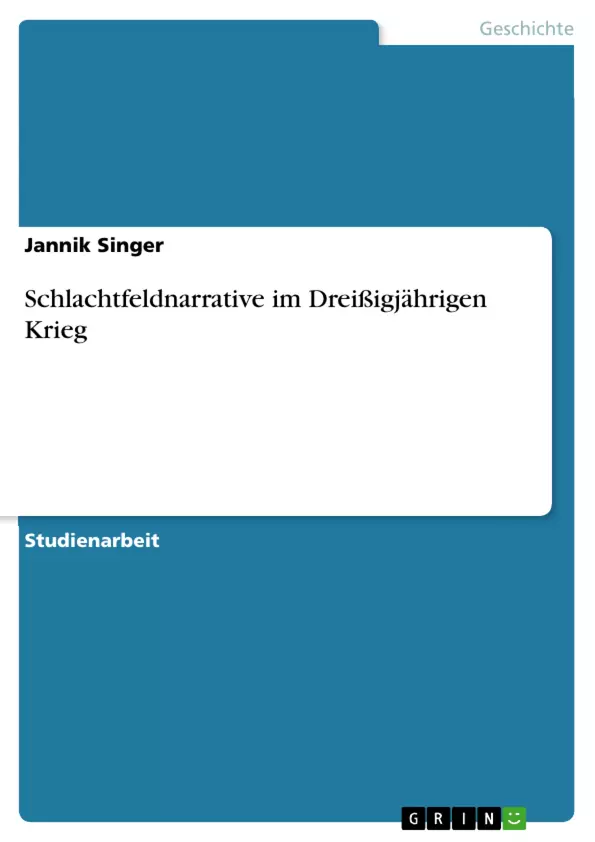Schlachtfeldnarrative als Quellen gibt es reichlich in der Geschichte. Sie berichten ganz individuell von den Erlebnissen im Krieg auf verschiedenste Arten. So existieren Erzählungen über den Perserfeldzug des römischen Kaisers Julian, die diesen in Form von Liedern auf epische Weise als niederträchtigen Menschen und inkompetenten Feldherrn stilistisch zeichnen. Perikles, ein genialer Rhetoriker, appelliert in seinen Leichenreden an die emotionale Bedeutung der gefallenen Soldaten und legitimiert somit häufig seine Kriegstaktiken. Die Erlebnisse, die Peter Hagendorf in seinem Tagebuch schildert, sind ohne den Einbezug der Emotionalität gar nicht analysierbar. Um in der Geschichtswissenschaft solche Quellen analysieren zu können, muss man also die entscheidende Komponente der Emotionalität fassbar machen. Dabei gilt es, sich in die Situationen der Personen hineinzuversetzen und die irrationalen Faktoren zu analysieren. Bislang fand jedoch in der Geschichtswissenschaft ebenjenes Einbeziehen der Emotionalität bei Frauen, oder besser gesagt, ohne Berücksichtigung des Faktors Gewalt gegen Frauen als Kriegstaktik, nicht statt. Vergewaltigungen sind lange ein „Nebeneffekt“, eine „Randnotiz“, eine „bedauerliche, aber logische Konsequenz“ des Krieges gewesen. Erst seit ein paar Jahren wird der Faktor Gewalt gegen Frauen im Krieg allmählich intensiver behandelt. Daher ist es nun die Aufgabe der Geschichtswissenschaft, sich selbst, Quellen oder bestehende kriegsdeutende Analysen zu hinterfragen und ihre Schlussfolgerungen zu prüfen. Dieses Ziel hat sich die vorliegende Arbeit gesetzt. Somit wird anhand zweier Bamberger Quellen, die die Schlacht um Bamberg von 1632 beschreiben, vergleichend betrachtet, inwiefern das Geschlecht eine Rolle bei Schlachtfeldnarrativen spielt. Beide Quellen sind, bis auf wenige Ausnahmen, nahezu unter gleichen Bedingungen entstanden – jedoch unterscheiden sie sich im Geschlecht des jeweiligen Autors. Die Quellen werden mithilfe mehrerer Analysekriterien miteinander verglichen und es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, die im besten Falle die vorausgehende Forschungsfrage Inwiefern beeinflusst das Geschlecht die Schlachtfeldnarrative einer Schlacht anhand des Beispiels der Schlacht um Bamberg von 1632? hinreichend beantworten soll.
Inhalt
1. Einleitung
2. Historischer Kontext
3. Quellenvorstellung
3.1 Junius
3.2 Jesuitenchronik
4. Quellenanalyse
4.1 Darstellung der Vorbereitung der Schlacht
4.1.1 Quelle Junius
4.1.2 Quelle Jesuiten
4.1.3 Vergleich
4.2 Darstellung Schlachtverlauf
4.2.1 Quelle Junius
4.2.2 Quelle Jesuiten
4.2.3 Vergleich
4.3 Darstellung nach der Schlacht
4.3.1 Quelle Junius
4.3.2 Quelle Jesuiten
4.3.3 Vergleich
5. Fazit
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Schlachtfeldnarrative als Quellen gibt es reichlich in der Geschichte. Sie berichten ganz individuell von den Erlebnissen im Krieg auf verschiedenste Arten. So existieren Erzählungen über den Perserfeldzug des römischen Kaisers Julian, die diesen in Form von Liedern auf epische Weise als niederträchtigen Menschen und inkompetenten Feldherrn stilistisch zeichnen. Perikles, ein genialer Rhetoriker, appelliert in seinen Leichenreden an die emotionale Bedeutung der gefallenen Soldaten und legitimiert somit häufig seine Kriegstaktiken. Die Erlebnisse, die Peter Hagendorf in seinem Tagebuch schildert, sind ohne den Einbezug der Emotionalität gar nicht analysierbar. Um in der Geschichtswissenschaft solche Quellen analysieren zu können, muss man also die entscheidende Komponente der Emotionalität fassbar machen. Dabei gilt es, sich in die Situationen der Personen hineinzuversetzen und die irrationalen Faktoren zu analysieren. Bislang fand jedoch in der Geschichtswissenschaft ebenjenes Einbeziehen der Emotionalität bei Frauen, oder besser gesagt, ohne Berücksichtigung des Faktors Gewalt gegen Frauen als Kriegstaktik, nicht statt. Vergewaltigungen sind lange ein „Nebeneffekt“, eine „Randnotiz“, eine „bedauerliche, aber logische Konsequenz“ des Krieges gewesen. Erst seit ein paar Jahren wird der Faktor Gewalt gegen Frauen im Krieg allmählich intensiver behandelt. Daher ist es nun die Aufgabe der Geschichtswissenschaft, sich selbst, Quellen oder bestehende kriegsdeutende Analysen zu hinterfragen und ihre Schlussfolgerungen zu prüfen. Dieses Ziel hat sich die vorliegende Arbeit gesetzt. Somit wird anhand zweier Bamberger Quellen, die die Schlacht um Bamberg von 1632 beschreiben, vergleichend betrachtet, inwiefern das Geschlecht eine Rolle bei Schlachtfeldnarrativen spielt. Beide Quellen sind, bis auf wenige Ausnahmen, nahezu unter gleichen Bedingungen entstanden - jedoch unterscheiden sie sich im Geschlecht des jeweiligen Autors. Die Quellen werden mithilfe mehrerer Analysekriterien miteinander verglichen und es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, die im besten Falle die vorausgehende Forschungsfrage Inwiefern beeinflusst das Geschlecht die Schlachtfeldnarrative einer Schlacht anhand des Beispiels der Schlacht um Bamberg von 1632? hinreichend beantworten soll.
Zum einen gilt es hierbei, die Stadt Bamberg im Dreißigjährigen Krieg mitsamt der mit ihr verbundenen Schlacht 1632 zu erforschen. Bambergs Geschichte im Dreißigjährigen Krieg ist erst in der neueren Forschung zu einer umfassenderen und ausführlichen Betrachtung gekommen. Ein wichtiges Werk ist hierbei die Dissertation von Johannes Hasselbeck aus dem Jahr 2021. Dabei erforscht Hasselbeck die Geschehnisse in und Auswirkungen für und von Bamberg im Dreißigjährigen Krieg und versucht sich an einer allumfassenden Darstellung und Erforschung der Stadt. Auch wenn Hasselbeck überwiegend auf Quellen zurückgreift, die Berichte, Protokolle oder Rechnungen einschließen, verwendet er ebenso die auch hier zu betrachtenden Quellen von Anna Maria Junius und die Jesuitenchronik. Eine weitere Monografie, die sich mit der militärischen Situation bei der Schlacht von Bamberg auseinandersetzt, ist das 2004 erschienene Werk von Peter Engerisser. Hierbei hat der Autor den militärischen Aspekt von u. a. der Schlacht von Bamberg herausgearbeitet und erforscht. Besonders interessant ist die darin enthaltene Liste aller Regimenter, die während der Schlacht von Bamberg ebenda agierten. Zum anderen wird nun der Forschungsstand von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen im Dreißigjährigen Krieg dargestellt. Einen übersichtlichen Einblick in die Geschlechterforschung im Hinblick auf Gewalt bietet das Buch von Opitz-Belakhal. Die Autorin versucht sich dabei an einer Art „allgemeinen Geschlechtergeschichte“ und thematisiert v. a. die Rolle der Frau in der Geschichte. Mit expliziter Gewalt in Konflikten gegen Frauen beschäftigt sich der Sammelband „Vor aller Augen“ von Zipfel et al. Dort wird der Fokus auf sexuelle Gewalt in Kriegen gelegt und ausführlich behandelt. Der Beitrag von Louise du Toit ist hier hervorzuheben, da sie den Fokus auf die Symbolik von Vergewaltigungen im Krieg legt. Um den Forschungsstand gemäß der Forschungsfrage thematisch einzugrenzen, sind v. a. auch die Beiträge von Lehner und Fabian aus dem 2023 erschienenen Sammelband von Labouvie zu nennen. Hier setzen sich beide Autorinnen mit Gewalt gegen Frauen im Krieg auseinander. Lehner legt dabei den Fokus auf dokumentierte Gewalt. Frauen erfahren, laut Lehner, im Laufe des 16. Jhd. eine Wandlung gesellschaftlicher Normen in Bezug auf Sexualität. So würde die Ehre der Frau auf einem sexuellen „Status“ beruhen, der ihnen zugesprochen oder genommen werden kann. Somit kann man in den Quellen sexualisierte Gewalt identifizieren und erforschen. Fabian stellt insbesondere Vergewaltigungen von Frauen in den Vordergrund und verdeutlicht, dass diese mitnichten lediglich ein „Zufallsprodukt“ männlichen Kontrollverlustes sind, sondern dahinter durchaus ein System herrscht, welches sich in der Art der Kriegsführung ansiedelt. Vergewaltigungen von Frauen dienen somit als „legitimes“ Mittel kriegerischer Handlungen bei Plünderungen, Eroberungen etc. Eine genaue Untersuchung der beiden Quellen von den Jesuiten und Junius im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede der Darstellung von der Schlacht von Bamberg, schließt somit eine Lücke im Forschungsdiskurs, indem man beide Quellen, die sich, bis auf wenige Merkmale sonst nur im Geschlecht der Autoren unterscheiden, nach bestimmten Kriterien vergleichend analysiert.
2. Historischer Kontext
Der schwedische König Gustav II. Adolf landete am 06. Juli 1630 auf Usedom in Pommern und griff somit militärisch in den Dreißigjährigen Krieg aktiv ein1. Sein Ziel war es, im sogenannten Dominium Maris Baltici, dem Kampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum, die Oberhand zu gewinnen und diese zu sichern2. Unterstützt von Subsidien aus Frankreich3 und der expansionistischen Haltung Schwedens, beließ es Gustav Adolf nicht dabei, sondern stärkte sein Heer und rückte weiter gen Süden vor4. Sein erster Vormarsch begann am 13.04.1631 in Richtung Frankfurt an der Oder5. Der Feldzug war von großem Erfolg gekrönt. Die Schweden schafften es bis 1634, in großen Teilen in Deutschland eine „hegemoniale Herrschaftsposition“6 aufzubauen7. Die erste größere Niederlage der Schweden erfolgte in Bamberg 16328. Hierbei verteidigte der schwedische Feldmarschall Gustaf Horn die von ihm noch im selben Jahr eroberte Stadt9 gegen den ligistischen Generalleutnant Johann T’Serclaes von Tilly10. Tilly gewann die Schlacht deutlich und zwang Horn zum Rückzug11. Nach dem Tod Gustav Adolfs 1632 bei der Schlacht bei Lützen, welche in einer militärischen Pattsituation mündete12, und der bedeutenden Niederlage der Schweden in Nördlingen13, zogen sich die Schweden aus Süddeutschland wieder zurück14. Für Bamberg war der Krieg vorerst vorbei15.
Die Bevölkerung spielte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine fundamentale Rolle. Sie diente der Armee als Versorgungsquelle. Plünderungen, Morde, Vergewaltigungen und Missbrauch, ausgehend von den umherziehenden Armeen, waren ein probates Mittel der Soldaten, sich zu versorgen und die Bevölkerung zu terrorisieren16. Ein beliebtes Ziel gaben somit auch katholische Geistliche ab. Neben ihrer gegensätzlichen Konfession sind die oftmals reichen Besitztümer von geistlichen Männern und Frauen ein beliebtes Ziel zur Plünderung und der Gewaltausübung17. Zudem galten Frauen als besonders vulnerable Gruppe. Vergewaltigungen waren nicht nur ein bestialisches „Ausarten“ männlicher Triebe, sie zählten genauso als valide Kriegstaktik. Mit Vergewaltigungen gegen Frauen terrorisierte und demoralisierte man nicht nur die Bevölkerung, man richtete eine „Botschaft“18 gegen die feindlichen Männer als Zeichen der Dominanz und des Sieges19.
3. Quellenvorstellung
3.l Junius
Anna Maria Junius war eine Dominikanernonne aus Bamberg. 1622 trat sie in den Orden ein und begann ab 1633, ein Tagebuch für das sogenannte Heiligengrabkloster anzufertigen. Dieses Tagebuch beginnt jedoch schon im Jahr 1622, weswegen sie alle Geschehnisse bis 1633 nachträglich dokumentierte20. Junius’ Informationsquelle war häufig das Gespräch am „Redefenster“ des Klosters gewesen, bei dem sie verschiedene Kontakte knüpfen und daraus Informationen gewinnen konnte21. Somit besaß sie „Insider-Informationen aus erster Hand“22. Junius überlebte den Dreißigjährigen Krieg23 und starb wahrscheinlich 1665.24
Die erste zu analysierende Quelle ist eine Chronik. Woodford sieht die Quelle von Junius25, welche erst 189126 veröffentlicht wurde, auch als frühe Form der Autobiografie an27. Somit kann es auch als Ego-Dokument zählen. Die Quelle ist als Archivgut des Archivs der Pfarrgemeinde St. Martin in Bamberg überliefert. Sie findet ihren Ursprung zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Junius schrieb den Text zwischen 1622 und 1634 in ihrer Heimat in Bamberg. Der Beweggrund des Textes ist dabei zweigeteilt. Zum einen hat die Quelle einen chronistischen Anspruch. Daher liegt es nahe, dass sie den Text für die nachkommenden Generationen ihres Klosters und somit als Chronistin schrieb28. Zum anderen dient der Text wahrscheinlich Junius als Hilfe, ihre Erlebnisse zu verarbeiten, indem sie diese aufschreibt. Da es keinen direkten „Auftraggeber“ dieser Chronik gibt, liegt die Annahme nahe, dass Junius es anfangs zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse nutzte, aber gleichzeitig auch ein chronistisches Ziel hegte29. Eine Veröffentlichung der Chronik war nicht vorgesehen30.
Der Ausschnitt der Quelle, die die Schlacht um Bamberg beschreibt, umfasst den 08. März 1632, bei dem die schwedischen Truppen sich und die Stadt auf die bevorstehende Schlacht vorbereiteten, den 09. März, dem eigentlichen Tag der Schlacht, sowie Teile des 10. März, dem Tag nach der Schlacht. Junius berichtet ausführlich in diesem Zeitraum über die Vorkehrungen, den Schlachtverlauf und den Ausgang. Dabei führt sie die von ihr geschilderten Ereignisse chronologisch an31.
3.2 Jesuitenchronik
Die Jesuitenchronik von Bamberg ist ein Zusammenschluss zweier zeitgenössischer Werke32, die der Universitätsprofessor Heinrich Weber 1885 veröffentlichte33. Dabei verfasste ein unbekannter Autor die Chronik, indem er 1654 vorangegangene Berichte zusammentrug und chronistisch niederschrieb34. Sonst ist nicht viel über den Ursprung der Chronik bekannt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass, anders als bei Junius, die Jesuiten ihre Informationen meist aus eigener Hand erfahren hatten, da sie, im Gegensatz zu den Dominikanernonnen, die Aufgabe hatten, ihr Kollegium zu verlassen, um den Menschen vor Ort Hilfe zu leisten35. Ebenso wie die Chronik von Junius kann die Jesuitenchronik ein Stück weit als Ego-Dokument betrachtet werden und sollte dieselben Aspekte eines Selbstzeugnisses berücksichtigen.
Die Jesuitenchronik beginnt ihre Schilderung der Schlacht um Bamberg ebenfalls am 08. März 1632, beschränkt sich jedoch auf die Vorbereitungen Tillys. Der unbekannte Autor schildert, ähnlich wie Junius, detailliert die Schlacht um Bamberg und erzählt ebenfalls über den Ausgang und die Folgen der Schlacht. Nach der Schlacht sei ein „Rector“36, also ein Leiter einer Jesuitenschule, erschienen und habe das Gebäude inspiziert. Es seien ebenfalls mehrere Stadtbewohner Bambergs gekommen und haben die Zerstörung der Schule mit Entsetzen begutachtet. Nach der Schuldzuweisung an die Schweden und dem Kontrollieren des Bestandes der Vorratskammer endet die Aufzeichnung um die Schlacht um Bamberg37. Auch hierbei fertigt der unbekannte Autor den Schlachtverlauf chronologisch an.
4. Quellenanalyse
4.1 Darstellung der Vorbereitung der Schlacht
Im folgenden Kapitel werden die Vorbereitungen der Schlacht behandelt. Dabei wird der Zeitraum vom 08. bis einschließlich 09. März bis zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Armeen betrachtet.
4.1.1 Quelle Junius
Anna Maria Junius schilderte die Vorbereitung bzw. das Geschehen vor der Schlacht sehr ausführlich. Von ihren knapp zwölf Seiten Text über die Schlacht widmet sie insgesamt ein Drittel, also knapp vier Seiten, der Vorbereitung. Dabei teilt sich das Themenspektrum in zwei Teile auf. Zum einen berichtet Junius von den militärischen Vorbereitungen der Schweden, die am Vortag und am Vormorgen der Schlacht die Stadt befestigen. Sie erzählt, dass die Schweden das Kloster präparieren und kampffähig machen wollen38. So sollen „die Jungfrawen [...] ein loch durch ihr kirghoff meüherlein brechen lassen / damit man ein und aus fahren kon“39. Außerdem soll der „kreutzgang im kloster mit brettern verschlagen“40 werden, damit „man nicht ins kloster sehn“41 kann. Am frühen Morgen des 09. März „haben 2 schweden“ die „mauhern durch brochen“42 und „angefange zwa Bastey43 zu Bawen“44. Dadurch, dass die Nonnen unmittelbar von den Vorbereitungen betroffen waren, weil das Kloster befestigt wurde, fällt der Bericht von Junius detailliert aus, da es auch als Chronik für den Orden bzw. das Kloster von großem Belang war. Zunächst schreibt Junius, dass, wenn Tilly „nur ein stund langsamer“45 gewesen wäre, mehrere Führungspersönlichkeiten wie der Graf von Solms oder der Feldmarschall Gustaf Horn das Kloster besichtigt und begutachtet hätten46. Dies zeugt von einer strategischen Bedeutung des Klosters47. Das Heiligengrabkloster liegt am nordöstlichen Rand Bambergs48 und nahe der Seesbrücke49. Das Kloster ist somit die letzte Verteidigungsmöglichkeit vor der eigentlichen Stadt Bamberg50 gegen die anrückenden Ligisten51. Zum anderen berichtet sie von diesen nun ausführlicher52. Junius war der Annahme, dass Tilly tödlich verletzt war und mit kaum Kriegsvolk aus Leipzig aufgebrochen wäre53. Dies teilte sie in einem Gespräch mit einem schwedischen Militär mit, der für das Kloster zuständig war54. Außerdem spricht Junius von Gerüchten über die bayrischen Truppenverbände, die sich momentan in ihrer Nähe aufhalten55. Diese sollen, nach Schweden suchend, durch die Dörfer ziehen, plündern und brandschatzen56. Auffällig ist hierbei, dass Junius viel über diese Gerüchte spricht57. Neben dem Fakt, dass Junius auf Gerüchte angewiesen ist58, bleibt die Darstellung der eigentlichen Vorbereitung spärlich, obgleich die provisorischen Umbauten am Heilligengrabkloster für die Klosterchronik relevanter sind, als Gerüchte über Truppen. Zumal Junius nachträglich diese Chronik über die Schlacht um Bamberg anfertigte59.
Anhand dieser ausführlichen Darstellungen dieser Gerüchte lässt sich eine wichtige Schlussfolgerung zur Darstellung von Junius zur Vorbereitung der Schlacht ziehen. Die anrückenden Truppen sind ligistische Soldaten. Da Junius eine katholische Geistliche war, sollte eigentlich die Freude über das mögliche Ende der Besatzung in der Chronik60 überwiegen. Der Fakt, dass sie die Chronik nachträglich schrieb, sollte ebenfalls dazu führen, nicht auf „Momentan-Gefühlslagen“ zu achten oder sie gar niederzuschreiben, sondern sich auf das tatsächlich „Erfahrene“ zu konzentrieren, vor allem wenn es sich nachträglich als offensichtlich falsche Annahme herausstellt. Allen voran lässt sich hierbei das Gerücht Tillys analysieren. Johann von Tilly galt als eifriger Katholik61 und war dank guter Kontakte zu Maximilian I. mit den bayrischen Gebieten schon einige Jahre vertraut62. Gleichzeitig war er für die Zerstörung Magdeburgs von 1631 berüchtigt63. Dabei hat Tilly den Angriff auf die Hansestadt befehligt, worin Tausende auf brutale Weise den Tod fanden64. Dies hat sich schnell im ganzen Reichsgebiet herumgesprochen65, auch in Bamberg. So gerieten z.B. in Franken protestantische Bayreuther mit katholischen Bambergern aneinander, die sich über Tilly stritten66. Eine mögliche Interpretation von Junius’ Text ist daher, dass ihre Furcht vor den Truppen so groß war, dass sie die Gespräche und Gedanken über die Soldaten besonders im Kopf hatte und auch nachträglich so ausführlich aufschrieb. Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass die Angreifer die eigentlichen Verbündeten sind. Die Schweden stellt sie zwar als Feinde dar und benennt diese auch so, jedoch überwiegt die Furcht vor den Ligisten. Die Mutmaßungen über Tilly implizieren auch eine Furcht vor diesem, vermutlich als Resultat seines Rufs aus Magdeburg. Summa summarum zeugt die Darstellung Junius’ von dem Vortag der Schlacht von großer Furcht und Unsicherheit über die eigentlichen Verbündeten. Um herauszufinden, inwiefern dies einen geschlechtsspezifischen Einfluss auf ihr Schlachtfeldnarrativ haben könnte, wird nun die Quelle von den Jesuiten zurate gezogen und abschließend mit der von Junius verglichen.
4.1.1 Quelle Jesuiten
Die Jesuitenchronik schildert nur äußerst knapp die Vorbereitungen zur Schlacht. So beschränkt sich der unbekannte Autor auf die beiden folgenden Sätze:
„In Eilmärschen kam Tilly am 8. März in Begleitung Altrinhers, Cronbergs, Farnsbach, Sulks und des Fürstbischofs nach Forchheim, empfing dort nach seiner Gewohnheit die hl. Sakramente, und wandte sich des folgenden Tages (9. März) gegen Bamberg, obschon er seine Truppen noch nicht alle beisammen hatte. In Hirschaid hielt er einen Kriegsrath, und schickte dann die leichte Croatische Reiterei voraus“67
Hierbei stechen zwei Besonderheiten hervor. Zum einen wird Tilly als gläubig dargestellt, in dem der Autor erwähnt, dass er „nach seiner Gewohnheit die hl. Sakramente“68 empfing. Dies impliziert eine disziplinäre Frömmigkeit Tillys. Dem Autor ist somit in der knappen Schilderung das Erwähnen des Glaubens von Tilly wichtig. Zum anderen verwendet der Jesuit konkrete Kriegstermini, wie „Kriegsrath“ oder die explizite Nennung der berittenen kroatischen Vorhut. Letztlich legt der Autor jedoch keinen großen Wert auf die Vorbereitungen zur Schlacht und lässt die Geschehnisse in Bamberg selbst unerwähnt.
4.1.3 Vergleich
Beide Quellen unterscheiden sich in den grundlegenden Aspekten nur im Geschlecht der Autoren. Beide sind katholische Geistliche, die über die Schlacht um Bamberg berichten. Jedoch fällt der Bericht bei Junius deutlich ausführlicher aus als bei den Jesuiten. Auch der Inhalt unterscheidet sich stark. Die Jesuiten berichten lediglich knapp von Tilly und betonen dessen Frömmigkeit und sein Agieren subtil. Junius schreibt zum einen über die Vorbereitungen am Kloster, wofür die eigentliche Chronik auch vorgesehen war. Zum anderen schreibt sie jedoch auch ausführlich über die Gerüchte der eigentlich verbündeten ligistischen Armeen. Dabei erweckt sie einen Eindruck der Unsicherheit, fast sogar schon der Furcht vor diesen. Mit dem Fakt, dass sie die Chronik erst 1633 begann und damit die Geschehnisse der Schlacht im Nachhinein aufschrieb, hielt sie es also für wichtig und notwendig, diese Informationen mit dem Leser zu teilen. Da es jedoch nicht das Kloster betrifft, sondern nur sie selbst - genauer gesagt die Nonnen und die Bevölkerung -, ist dies ein Indiz für eine Verarbeitung der Erlebnisse als Selbstzeugnis in der Retrospektive. Aufgrund dessen, dass sie die falschen Gerüchte ausführlich niederschreibt, zeigt sie die Angst und die Furcht, die sie vor den Armeen und vor Tilly hat. Die Sorge vor Söldnern in der Armee Tillys lässt sich ebenfalls an den Gerüchten ablesen, da Junius im Gespräch verwundert war, wie schnell Tilly eine Armee organisieren konnte, obwohl er, laut ihres Kenntnisstands, eigentlich kein „Kriegsvolk“ hätte haben können. Söldner galten im Dreißigjährigen Krieg als beliebtes Kriegsmittel, vor allem da mit zunehmender Kriegszeit die potentiellen Rekruten ausgingen69. Außerdem war Maximilian großer Befürworter der Kriegsführung mit Söldnern, was die Furcht vor dessen Einsatz weiter befeuert haben könnte70. Im Vergleich zu den Jesuiten zeigt sich also, dass die Furcht und die Unsicherheit bei Junius einen viel höheren Stellenwert haben als bei den Jesuiten, die die Vorbereitung auf das Kürzeste beschränken und dabei auch Tilly positiv darstellen. Beide Autoren mussten sich keine Sorgen machen, dass sie der Gefahr ausgesetzt sind, aufgrund ihrer Konfession von der Armee misshandelt zu werden, da die katholischen Liga-Truppen anrücken. Junius hatte sich jedoch im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, was die heranrückende Armee, die potentiell noch mit vielen Söldnern bestückt ist, für sie und die Stadt bedeuten würde. Die unterschiedliche Darstellungsweise könnte somit auf das Geschlecht zurückführen sein, da sich beide Autoren in der gleichen Lage, mit nahezu gleichen Ausgangspunkten, zu einer sehr unterschiedlichen inhaltlichen Erzählweise entschieden haben. Die Jesuiten haben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls vor der Schlacht gefürchtet, jedoch sahen sie es nicht als notwendig an, dies in ihrer Chronik mit den Lesenden zu teilen. Etwaige Sorgen um das eigene Wohl fanden keinen Platz, da der Autor schon bei der Darstellung der Vorbereitung der Schlacht weiß, dass er die Schlacht unbeschadet überlebt und auch im Vorhinein nicht viele Erlebnisse verarbeiten musste. Junius’ ausführliche Darstellung über die Vorbereitung, wobei sie viele Ängste und Sorgen indirekt preisgibt, obwohl sie auch in der Retrospektive schreibt, kann somit ein Indiz dafür sein, dass sich ihre Schlachtfeldnarrative, aufgrund der unterschiedlichen Sorgen, die sie sich als Frau macht - oder besser gesagt machen muss -, im Vergleich zu ihren männlichen „Kollegen“ geschlechtsspezifisch unterscheidet. Gleichzeitig gilt es zu erwähnen, dass der generelle Schreibstil beider Autoren sich stark unterscheidet. Während die Jesuitenchronik sich kurz und knapp ausdrückt, schildert Junius ihre Erlebnisse mit einer „malerischen“ Sprache. Das unterschiedliche Geschlecht ist abschließend betrachtet ein möglicher Faktor der Darstellungsweise, jedoch keineswegs die einzige Möglichkeit der Erzählperspektive.
4.2 Darstellung Schlachtverlauf
Im folgenden Kapitel wird die eigentliche Schlacht um Bamberg vom 09.03.1632 behandelt.
4.2.1 Quelle Junius
Auf knapp siebeneinhalb Seiten schildert Junius die Schlacht um Bamberg in ihrer gewohnt malerischen und „belebten“ Sprache71. Sie berichtet zunächst von „drei [kroatischen] Reitern“72, die die Vorhut zur Schlacht gebildet haben. Diese habe die heranrückende schwedische Infanterie besiegt und zurückgedrängt. Dabei beschrieb sie die gegnerischen Truppen als verängstigt und demoralisiert. Ein Soldat hätte vor Schreck „kaum ein[en] Schlag auf die Trommel“73 mehr ausführen können. Außerdem sollen mehrere schwedische Truppen beim Anblick vom eintreffenden Tilly so viel Angst gehabt haben, dass sie sofort geflüchtet sein sollen74. Daraufhin soll sich die schwedische Armee in den Stadtkern zurückgezogen haben und sich dort verschanzt haben. Die ligistischen Truppen sollen nur vor der von den in das Stadtinnere geflüchteten schwedischen Truppen heruntergelassene Zugbrücke haltgemacht haben, da sie diese nicht passieren konnten75. Die Schweden sollen sich im Laufe der Nacht zurückgezogen haben76. Die katholische Färbung in diesem Teil der Quelle wird deutlich erkennbar. Die katholischen Truppen sind bei Junius als deutlich überlegen dargestellt, während die protestantischen Schweden vor lauter Furcht kaum hätten kämpfen können. Auffallend ist, dass Junius explizite Gewaltakte äußerst detailliert beschreibt. So erzählt sie von einem Soldaten, der von hinten erschlagen wurde und dabei bei ihm ein „ohr rab gehangen“ hat77. Dies kann ein Zeichen der Verarbeitung der Erlebnisse bei der Schlacht sein. Außerdem bringt Junius zusätzlich noch eine göttliche Legitimität in die Schlacht. Sie erzählt von zwei „grosse[n] schüs[sen]“78, die von der eigenen Artillerie gefeuert worden waren. Dabei sei die eine Kanonenkugel in ein Haus geflogen, wo „ein Kind in der wigen79 gelegen hat“80, „aber die kugel dem kind gar keinen echten schadten“81 angetan hat. Das Haus, indem das Kind lag, sei zwar eingestürzt, das Kind sei wie ein Wunder jedoch verschont geblieben82. Diese „göttliche Gnade“ unterstreicht die aus katholischer Sicht geltende Rechtmäßigkeit, die ihnen Gott in diesem Krieg gab und soll zeigen, dass man der „richtigen“ Konfession angehörig ist. Für diesen Teil der Schlacht tritt die Selbstverarbeitung der Erlebnisse in ihrem Ego-Dokument in den Hintergrund und die katholische Klosterchronik in den Vordergrund. Eigene Erlebnisse werden von ihr detailliert beschrieben und dienen im Gesamtkontext der Chronik über das Kloster, indem sie als Person - anders als in Kapitel 4.1.1 - in den Hintergrund rückt und ihre Erfahrungen mit dem Suggerieren von „historischer Wahrheit“ „objektiv“ ausdrückt.
4.2.2 Quelle Jesuiten
Die Schlacht um Bamberg umfasst bei der Jesuitenchronik knapp eineinhalb der insgesamt fast vier Seiten. Die Chronik beginnt mit dem „Anrücken der Croaten“83, die den beim Dominikanerkloster stationierten schwedischen Offizier Wildenstein zum Rückzug gezwungen haben sollen. Dieser soll sich bei einer Bamberger Bewohnerin versteckt haben. Die Frau soll bei der Verfolgung Wildensteins einen ligistischen Soldaten behindert haben, worauf diese getötet wurde. Wildenstein wurde anschließend gefangen genommen84. Währenddessen sollen die verbliebenen Schweden sich ins Stadtinnere zurückgezogen haben und den Weg für die Ligisten durch das Schließen des Stadttores versperrt haben85. Auch hier bedient sich der Autor einer vermeintlich „objektiven“ Erzählweise, die den chronistischen Anspruch dieses Werkes untermalen soll. Gleichzeitig wird eine pro ligistische Färbung deutlich. Ähnlich wie bei Junius werden auch bei der Jesuitenchronik die katholischen Soldaten als deutlich überlegen dargestellt, während die schwedischen Soldaten sich fast ohne Widerstand direkt zurückziehen. Nach dem Eintreffen Tillys soll dieser den Befehl zum Stürmen der Stadt nicht gegeben haben, um damit die Stadtbevölkerung vor den Kampfhandlungen zu schützen. Jedoch sollen „die croatischen Reiter die Vorsicht des Feldherrn“86 missachtet haben und „einfach“ zum Angriff übergegangen sein. Dabei sollen sie Feldmarschall Horn gefangen genommen haben, der wiederum von seinen Truppen befreit wurde. Diese Aktion soll es den Schweden ermöglicht haben, einen Rückzug aus Bamberg zu organisieren87. Hierbei wird erneut deutlich, dass die Jesuitenchronik Tilly in ein positives Licht rückt. Nur durch den Ungehorsam der kroatischen Kavallerie, die „auf eigene Faust“ weiter die Stadt angriffen, hatte die Bevölkerung leiden müssen. Wenn es nach Tilly gegangen wäre, so impliziert die Chronik, wäre die Bamberger Bevölkerung verschont geblieben. Der weitere Schlachtverlauf bleibt unbeschrieben; die Chronik spricht nur von dem Rückzug aus der Stadt . Das weist ebenfalls auf eine katholische Färbung hin, denn die Tode beim Versuch, die Brücke zu stürmen, bleiben unerwähnt.
4.2.3 Vergleich
Beide Quellen unterscheiden sich bei der Darstellung und Erzählung der eigentlichen Schlacht nicht stark. Junius und der Jesuitenautor widmen der Schlacht die gleichen proportionalen
Anteile ihres Textes88. Beide Quellen dienen außerdem als nahezu einziges Quellenmaterial über den Schlachtverlauf aus der Erzählperspektive, da die meisten Zeugnisse um das Jahr 1632 vernichtet wurden89. Daher gelten beide Quellen als grundlegendes Quellenmaterial für die Schlacht um Bamberg. Der Grund für den Fokus der Jesuitenchronik auf Tilly, wie es auch schon in Kapitel 4 der Fall war, sticht hierbei wieder heraus. Auch Junius widmet sich in einigen Zeilen Tilly und leistet ebenfalls eine positive Darstellung Tillys, in dem sie ihn als Retter Bambergs zeichnet90. Die Jesuitenchronik legt jedoch den Fokus überwiegend auf Tilly und skizziert ihn als frommen, gnädigen und fehlerlosen Feldherrn, der nur aufgrund des übereifrigen Angreifens seiner eigenen Truppen nicht mehr Leben der Bevölkerung bei der Schlacht hätte verschonen können. Die durchweg positive Berichterstattung von Tilly könnte ihren Ursprung beim Tode Tillys 1632 haben, der dabei kontinuierlich von Jesuiten betreut wurde und dabei direkt mit dem Orden in Kontakt trat91. Die Darstellungen beider Autoren ähneln sich und zeigen eine klar pro katholische Färbung. Lediglich verschiebt sich bei beiden Autoren der Fokus der Erzählung. Während die Jesuitenchronik sich klar auf Tilly fokussiert, erzählt Junius etwaige Schlachtverläufe aus Sicht eines Bamberger Bewohners. Einen geschlechtsspezifischen Unterschied bei der tatsächlichen Schlachtfeldnarrative herrscht hierbei nicht vor. Beide Autoren beschreiben die Schlacht stimmig und sind dabei das Fundament der Quellenlage über die Schlacht von Bamberg. Die beiden Autoren mussten wahrscheinlich keine Gewalt am eigenen Leib erfahren, sondern blieben in der Schlacht verschont. Das Argument, dass Gewalt, vor allem gegenüber Frauen, in den Quellen meist unerwähnt bleibt92, muss hier jedoch als Möglichkeit angeführt werden, auch wenn es in diesen beiden Texten keine Hinweise dafür gibt93.
4.3 Darstellung nach der Schlacht
Im folgenden Kapitel werden die Darstellungen der Geschehnisse nach der Schlacht analysiert und verglichen.
4.3.1 Quelle Junius
Junius widmet dem letzten Teil der Schlacht knapp eineinhalb Seiten94. Die Schweden sollen „mechtig vil stadtliche beüt in der statt gelassen“95 haben, was einen fluchtartgigen Rückzug suggeriert. Den siegreichen Ausgang der Schlacht widmet sie nicht Tilly, sondern dem „allmechtige[n] gott“, „dem heilligen keisser heinerigen96 “ und einigen Heiligen97. Dieser soll ebenfalls Gott den Sieg zuschreiben, da der Feind mit 18.000 zu 8.000 Truppen überlegen war, und der Sieg an ein Wunder grenzen soll98. Diese Zahl weicht deutlich von den Zahlen der Forschung ab. Die Ligisten waren zwischen 10.000 und 20.000 Truppen stark, während die Schweden knapp 8.000 Männer befehligten99. Hier wird erneut die pro katholische Färbung des Textes mitsamt göttlicher Legitimation deutlich. Außerdem berichtet Junius, dass die Schweden in ihrem Domstift „bey sanct martin und gangolff ludterische prettig gehalten“100 haben. Ab dem 10. März „hat man wiederum im dumstifft die ersten heilligen mees gehalten“101 und den „abent des heilligen keyser heinerigs erhebung“102 zelebriert. Diese Rückkehr zur Normalität, beginnend mit den religiösen Riten und der Feier im Domstift, wo zuvor die Schweden protestantische Gottesdienste hielten, schließt die Darstellung der Schlacht ab. Es soll hierbei zeigen, dass man trotz der schwierigen Zeit im Krieg fromm bleibt und Gott dankt, sich für die katholische Konfession „entschieden“ zu haben. Daher schreibt Junius keinem Weltlichen den Sieg zu, sondern huldigt Gott und den Patronaten der katholischen Kirche, indem sie als Erstes den Alltag wieder mit den Frömmigkeiten beginnen.
4.3.2 Quelle Jesuiten
Die Jesuitenchronik beschäftigt sich knapp zwei Seiten mit dem Ausgang der Schlacht103. Ähnlich wie Junius beginnt der anonyme Jesuitenautor ebenfalls mit der zurückgelassenen Beute. Dieser berichtet jedoch, dass die Bamberger Bevölkerung die Beute geplündert haben sollen. So sollen zwei Jesuiten nach der Schlacht ins Kollegium zurückgekehrt sein und sollen berichtet haben, dass sie „300 Männer, Frauen, Knaben und Mädchen gezählt [haben], welche
Proviant, kostbare Kleider, Silber, Pferde“104 plünderten. Die Chronik berichtet zudem von einem „Rector“105, der am Folgetag der Schlacht das Kollegium begutachtet haben soll. Dieser soll das Kollegium überwiegend verwüstet vorgefunden haben, einzig die „kostbaren Gemälde“106 sollen verschont geblieben sein. Die Erzählungen decken sich mit dem chronistischen Anspruch der Quelle, da dieser nun zum ersten Mal auch das Kollegium beschrieb und die damit einhergehenden Folgen der Schlacht für den Jesuitenorden.
4.3.3 Vergleich
Auch hier decken sich beide Quellen überwiegend mit dem Inhalt, auch wenn wieder der Fokus ein jeweils anderer ist. Während Junius Gott und den Heiligen dankt und huldigt, beschäftigt sich die Jesuitenchronik mit vorwiegend weltlichen Geschehnissen, wie der Plünderung der Beute und des eigenen Kollegiums. Ein Unterschied in den Erzählungen liegt vor, nämlich dass Junius in keinem Satz etwaige Plünderungen erwähnt, die die Jesuitenchronik in den Vordergrund stellt. Das bereits oben genannte Argument, dass Gewalterfahrungen in den Quellen von v. a. weiblichen Autoren schwer zu entschlüsseln sind107, ist hierbei nicht triftig. Es liegen keine Hinweise oder Andeutungen auf geschlechtsspezifische Gewalt vor, weder seitens beider Armeen noch seitens der plündernden Bevölkerung. Vielmehr zeigt sich die positive Darstellung der Bamberger Bevölkerung durch Junius. Die oben genannte Frau, die Wildenstein Zuflucht gewährte, wird bei den Jesuiten als „Verräterin“ dargestellt, die daraufhin ermordet wurde. Junius, ebenfalls mit pro katholischer Berichterstattung, schrieb aber in ihrer Quelle, dass die Frau einen ordentlichen Geldbetrag bekommen hätte, wenn sie den schwedischen Offizier versteckt hätte.
5. Fazit
Abschließend lassen sich mehrere Erkenntnisse feststellen. Durch die Betrachtung zweier Quellen, die sich beinahe ausschließlich im Geschlecht der Autoren unterscheiden lassen, kann man die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Auswertung von Schlachtfeldnarrativen gut vergleichend analysieren. Man hat sowohl zeitlich, räumlich und konfessionell die gleichen Voraussetzungen. Jedoch steht man vor dem Problem, dass Gewalterfahrungen in Quellen, insbesondere bei Frauen, nur schwer greifbar sind, weil die gesellschaftlichen Strukturen und Gegebenheiten, v. a. bei Vergewaltigungen, stets die Betroffene durch die Parameter Reputation, Ehre, Glaube etc., ausschließt und verachtet. Deswegen muss man bei den Quellen auf Nuancen achten, die Hinweise darauf geben, ob zum einen Gewalt gegen den Autor oder die Autorin angewandt wurde, und zum anderen, wie die Erzählperspektive derjenigen sich dadurch wandelt. Haben dann weibliche Autoren einen anderen Fokus aufgrund des immensen gesellschaftlichen Drucks, der von Gewalt gegen sie selbst ausgeht? Die Frage lässt sich auch bei dieser Arbeit mit der Dominikanernonne Anna Maria Junius und der Jesuitenchronik nicht annähernd zweifelsfrei beantworten. Man kann Tendenzen von unterschiedlicher Furcht vor der Armee von Tilly sehen, indem Junius selbst in der Retrospektive falsche Gerüchte niederschreibt. Diese suggerieren den Eindruck, dass Junius ihre Erlebnisse im Nachhinein verarbeitet. Dies kann, jedoch muss kein geschlechtsspezifisches Merkmal sein, da man zum einen ohnehin sich vor der bevorstehenden Schlacht fürchten kann und zum anderen die Darstellung typisch Junius’ belebenden Erzählstil bedient. Diese Arbeit behandelt nur ein explizites Beispiel an einem expliziten Ereignis. Der Fakt, dass beide Quellen sich fast ausschließlich im Geschlecht unterscheiden, macht den Vergleich attraktiv, jedoch kann diese Arbeit nur einen qualitativen Vergleich bieten. Um untersuchen zu können, inwiefern sich Schlachtfeldnarrative in der Geschichtswissenschaft vom Geschlecht beeinflussen lassen, benötigt es ein breit aufgestelltes, quantitatives Forschungsfeld, um systematische Unterschiede feststellen zu können. So könnte man u. a. die Chroniken von Junius und der Jesuiten im Ganzen vergleichend erforschen oder ähnliche Fälle untersuchen, bei denen die Ausgangssituationen ähnlich vergleichbar sind.
Quellenverzeichnis
Nolting, Uta: Sprachgebrauch süddeutscher Klosterfrauen des 17. Jahrhunderts (Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit, Bd. 16), Münster u.a. 2010, S. 43-55.
Weber, Heinrich: Bamberg im dreißigjährigen Krieg. Nach einer gleichnamigen Chronik, Bamberg 1886, S. 19-23.
Literaturverzeichnis
Adrians, Frauke: „"Das sich einem Stein solt erbarmet haben". Der Dreißigjährige Krieg im Erleben der Zivilbevölkerung“, in: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung vom 20.07.2018, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/272820/das-sich-einem-stein-solt-erbarmet- haben/ [letzter Aufruf am 09.09.2024].
Asmus, Helmut: 1200 Jahre Magdeburg, Magdeburg 2000.
Engerisser, Peter: Von Kronach nach Nördlingen. Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Schwaben und der Oberpfalz 1631-1635, Weißenstadt 2004.
Essen, Micheal Fredholm von: The lion from the North. The swedisch army during the thirty years war: volume 1, 1618-1632, Warwick 2020.
Fabian, Stefanie: Zwischen Tabu und Beutelogik. Vergewaltigungen im Dreißigjährigen Krieg, in: Labouvie, Eva (Hrsg.): Geschlecht, Gewalt, Gesellschaft, Bielefeld 2023, S. 169-188.
Hartmann, Peter C.: Die Jesuiten, 2. Aufl., München 2008.
Hasselbeck, Johannes: dan der krig ist ein wüdtentes tihr. Der Dreißigjährige Krieg und die Bewältigung seiner Folgen in Bamberg 1632-1693, Baden-Baden 2021.
Junius, Anna Maria; Hümmer, Friedrich Karl: Bamberg Im Schweden-Kriege. Nach Einem Manuscripte (Mittheilungen Über Die Jahre 1622-1634), Bamberg, 1891.
Junkelmann, Marcus: Tilly. Der katholische Feldherr, Regensburg 2011.
Kaiser, Michael: „Excidium Magdeburgense“. Beobachtungen zur Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt im Dreißigjährigen Krieg, in: Meumann, Markus und Niefanger, Dirk (Hrsg.): Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmungen und Darstellung von Gewalt im 17. Jahrhundert, Göttingen 1997, S. 43-64.
Kaiser, Michael: Politik und Kriegsführung. Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg, Münster 1999.
Kampmann, Christoph: Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines Europäischen Konflikts, 2. Aufl., Stuttgart 2013.
Münkler, Herfried: Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618-1648, 3. Aufl., Berlin 2017.
Opitz-Belakhal, Claudia: Geschlechtergeschichte, 2. Aufl., Frankfurt/New York 2018.
Opitz-Belakhal, Claudia: Von Frauen im Krieg zum Krieg gegen Frauen. Krieg, Gewalt und Geschlechterbeziehungen aus historischer Sicht, in: L’Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 3 (1992), S. 31-44.
Scheutz, Martin: "... im Rauben und Saufen allzu gierig". Soldatenbilder in ausgewählten Selbstzeugnissen katholischer Geistlicher aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in: L' homme: Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 12 (2001), S. 51-72.
Saito, Keita: Das Kriegskommissariat der bayerisch-ligistischen Armee während des Dreißigjährigen Krieges, Göttingen 2020.
Wilson, Peter H.: Der Dreißigjährige Krieg. Eine Europäsische Tragödie, Cambridge 2009.
Woodford, Charlotte: ,Wir haben nicht gewist/was wir vor angst und schrecken thun sollen’: Autobiographical Writings by Two Nuns from the Thirty Years‘ War, in: Davies, Mererid Puw et al.(Hrsg.): Autobiography by Women in German, Bern, 2000, S. 53-68.
[...]
1 Vgl. Münkler, Herfried: Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618-1648, 3. Aufl., Berlin 2017, S. 418.
2 Vgl. Kampmann, Christoph: Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines Europäischen Konflikts, 2. Aufl., Stuttgart 2013, S. 13-15.
3 Vgl. Wilson, Peter H.: The Thirty Years War. Europe‘s Tragedy, Cambridge 2018, S. 561f.
4 Vgl. Kampmann S. 73f.
5 Vgl. Essen, Micheal Fredholm von: The lion from the North. The swedisch army during the thirty years war: volume 1, 1618-1632, Warwick 2020, S. 62.
6 Kampmann S. 74.
7 Vgl. ebd. S. 73f.
8 Vgl. Engerisser, Peter: Von Kronach nach Nördlingen. Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Schwaben und der Oberpfalz 1631-1635, Weißenstadt 2004, S. 50.
9 Vgl. Hasselbeck, Johannes: dan der krig ist ein wüdtentes tihr. Der Dreißigjährige Krieg und die Bewältigung seiner Folgen in Bamberg 1632-1693, Baden-Baden 2021, S. 101.
10 Vgl. ebd. S. 103f.
11 Vgl. ebd. S. 104.
12 Vgl. Münkler S. 596.
13 Vgl. Wilson S. 650f.
14 Vgl. ebd. S. 651f.
15 Ab 1641 wütete der schwedisch-französische Krieg weiter, vgl. Hasselbeck S. 140.
16 Vgl. Adrians, Frauke: „"Das sich einem Stein solt erbarmet haben". Der Dreißigjährige Krieg im Erleben der Zivilbevölkerung“, in: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung vom 20.07.2018, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/272820/das-sich-einem-stein-solt-erbarmet-haben/ [letzter Aufruf am 09.09.2024].
17 Vgl. Scheutz, Martin: "... im Rauben und Saufen allzu gierig". Soldatenbilder in ausgewählten Selbstzeugnissen katholischer Geistlicher aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in: L' homme: Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 12 (2001), S. 51-72, S. 51f.
18 Opitz-Belakhal, Claudia: Von Frauen im Krieg zum Krieg gegen Frauen. Krieg, Gewalt und Geschlechterbeziehungen aus historischer Sicht, in: L’Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 3 (1992), S. 31-44, S. 41.
19 Vgl. ebd. S. 40f.
20 Vgl. Hasselbeck S. 67.
21 Vgl. Engerisser S. 194f, Anm. 204.
22 Ebd. S. 195, Anm. 204.
23 Vgl. Hasselbeck S. 67.
24 Vgl. ebd., Anm. 300.
25 Diese Arbeit verwendet die Übersetzung von Nolting als Quelle, obgleich die Erstpublikation schon im Jahr 1891 war: Nolting, Uta: Sprachgebrauch süddeutscher Klosterfrauen des 17. Jahrhunderts (Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit, Bd. 16), Münster u.a. 2010, S. 43-55.
26 Junius, Anna Maria; Hümmer, Friedrich Karl: Bamberg Im Schweden-Kriege. Nach Einem Manuscripte (Mittheilungen Über Die Jahre 1622-1634), Bamberg, 1891.
27 Woodford, Charlotte: ,Wir haben nicht gewist/was wir vor angst und schrecken thun sollen’: Autobiographical Writings by Two Nuns from the Thirty Years‘ War, in: Davies, Mererid Puw et al.(Hrsg.): Autobiography by Women in German, Bern, 2000, S. 53-68,S. 57.
28 Im Vorwort von Hümmer spricht die Pfarrgemeinde von „unserer Chronistin“, vgl. Hümmer S. 3.
29 Hümmer spricht ebenfalls von dem „Tagebuch“ von Junius, vgl. Ebd. S. 4.
30 Vgl. Hasselbeck S. 67.
31 Vgl. Nolting S. 43-55.
32 Historia Collegii SJ Bambergensis und der erste Teil der Litterae annuae, vgl. Hasselbeck S. 68.
33 Weber führte die Jahre 1631-1636, 1639-1643 und 1645-1649 beider Werke zusammen, vgl. ebd.
34 Vgl. ebd.
35 Dies ist ein Grundprinzip des Jesuitenordens gewesen vgl. ebd. S. 68, ebenso vgl. Hartmann, Peter C.: Die Jesuiten, 2. Aufl., München 2008, S. 28f. Ihre Präsenz vor Ort wird auch bei ihren Kollegiengründungen in den Städten sichtbar. Dort waren sie sehr beliebt und hatten viele Möglichkeiten, ihre (missionarischen) Aufgaben durchzuführen, vgl. Hartmann S. 37f.
36 Weber, Heinrich: Bamberg im dreißigjährigen Krieg. Nach einer gleichnamigen Chronik, Bamberg 1886, S. 19- 23, S. 22.
37 Vgl. ebd. S. 19-23.
38 Nolting S. 43f.
39 Ebd.
40 Ebd. S. 44.
41 Ebd.
42 Ebd.
43 Bastionen.
44 Ebd. S. 44.
45 Ebd.
46 Ebd.
47 Auch die akribischen Befestigungsbauten am Vortag der Schlacht zeigt die Wichtigkeit des Gebäudes.
48 Vgl. Hasselbeck S. 88.
49 Vgl. ebd. S. 94, Grafik 1.
50 Hasselbeck spricht bei der Lage des Klosters von einer Vorstadt, vgl. ebd. S. 88.
51 Tilly kam mit seiner Armee von Forchheim, vgl. Engerisser S. 47.
52 Ebd. S. 44-47.
53 Vgl. Nolting S. 45.
54 Vgl. ebd. S. 44f.
55 Vgl. ebd.
56 Vgl. ebd. S. 45f.
57 Von den knapp 4 Seiten Schilderungen vor der Schlacht verwendet sie fast die Hälfte für die Gerüchte der bayrischen Truppen und eine halbe Seite für die Gerüchte von Tilly, vgl. ebd. S. 43-46.
58 Siehe oben: Redefenster.
59 Vgl. Hasselbeck S. 67.
60 Vor allem weil man die katholische „Färbung“ der Quellen berücksichtigen muss, vgl. ebd. S. 66.
61 Vgl. Junkelmann, Marcus: Tilly. Der katholische Feldherr, Regensburg 2011, S. 19.
62 Vgl. ebd. S. 19, 30f, 36f.
63 Vgl. Kaiser, Michael: Politik und Kriegsführung. Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg, Münster 1999, S. 375.
64 Vgl. Asmus, Helmut: 1200 Jahre Magdeburg, Magdeburg 2000, S. 556.
65 Vgl. Kaiser, Politik und Kriegsführung, S. 375.
66 Vgl. Kaiser, Michael: „Excidium Magdeburgense“. Beobachtungen zur Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt im Dreißigjährigen Krieg, in: Meumann, Markus und Niefanger, Dirk (Hrsg.): Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmungen und Darstellung von Gewalt im 17. Jahrhundert, Göttingen 1997, S. 43-64, S. 45f.
67 Weber S. 19.
68 Ebd.
69 Saito, Keita: Das Kriegskommissariat der bayerisch-ligistischen Armee während des Dreißigjährigen Krieges, Göttingen 2020, S. 31f.
70 Ebd.
71 Vgl. Nolting S. 46-54.
72 Ebd. S. 47.
73 Ebd. S. 48.
74 Ebd. S. 50.
75 Ebd. S. 51.
76 Ebd. S. 52.
77 Ebd. S. 49.
78 Ebd. S. 52.
79 Wiege.
80 Ebd. S. 53.
81 Ebd.
82 Ebd.
83 Weber S. 20.
84 Ebd.
85 Ebd.
86 Ebd. S. 21.
87 Ebd.
88 Ca. 40-50%.
89 Vgl. Hasselbeck S. 66f.
90 Nolting S. 49f.
91 Vgl. Junkelmann S. 57.
92 Vgl. Fabian, Stefanie: Zwischen Tabu und Beutelogik. Vergewaltigungen im Dreißigjährigen Krieg, in: Labouvie, Eva (Hrsg.): Geschlecht, Gewalt, Gesellschaft, Bielefeld 2023, S. 169-188, S. 176.
93 Für einen generellen Überblick aufgrund des noch weitestgehend unerforschte Themenfeld ist folgender Beitrag auch hilfreich: Opitz-Belakhal, Claudia: Geschlechtergeschichte, 2. Aufl., Frankfurt/New York 2018, v.a. S. 125ff.
94 Nolting S. 54-55.
95 Ebd. S. 54.
96 Heinrich.
97 Nolting S. 54.
98 Ebd.
99 Hasselbeck S. 103f.
100 Ebd. S. 55.
101 Ebd.
102 Ebd.
103 Weber S. 21-23.
104 Ebd. S. 21.
105 Ebd. S. 22.
106 Ebd.
107 Siehe Fabian.
- Quote paper
- Jannik Singer (Author), 2024, Schlachtfeldnarrative im Dreißigjährigen Krieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1544133