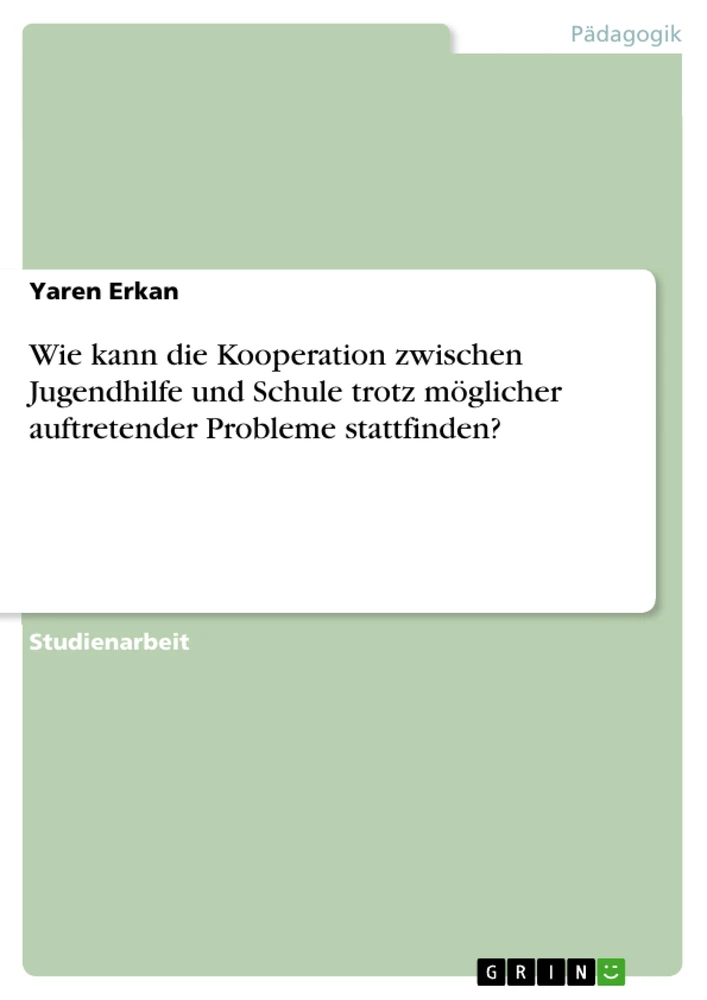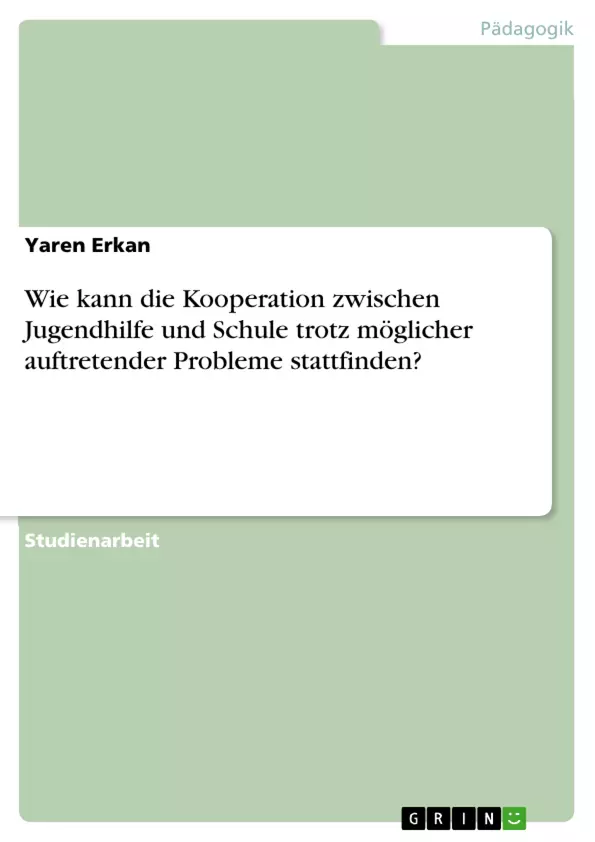Die Hausarbeit beleuchtet die Frage, inwiefern eine erfolgreiche Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule trotz möglicher Herausforderungen realisiert werden kann. Zunächst werden die grundlegenden Aufgaben von Schule und Jugendhilfe definiert sowie Unterschiede zwischen beiden Institutionen herausgearbeitet. Anschließend wird analysiert, welche Wege und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bestehen, wobei auch potenzielle Konflikte und Probleme thematisiert werden. Ein gelungenes Praxisbeispiel, das Projekt „AGIL“, dient dabei zur Veranschaulichung. Abschließend wird eine kritische Reflexion der Ergebnisse vorgenommen. Die Arbeit bietet eine fundierte Grundlage für Studierende und Fachkräfte, die sich mit interdisziplinärer Kooperation im Bildungs- und Sozialbereich befassen möchten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Schule
2.1. Aufgaben der Schule
3. Jugendhilfe
3.1. Definition von Jugendhilfe
3.1.1. Aufgaben der Jugendhilfe
4. Unterschiede zwischen der Schule und der Jugendhilfe
5. Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
5.1. Möglichkeiten und Wege der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
5.2. Mögliche auftretende Probleme in der Kooperation
5.3. Beispiel eines gelungenen Kooperationsprojekts: Das Projekt „AGIL“
6. Reflexion
7. Literaturverzeichnis
8. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Fragestellung, inwiefern die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe trotz möglicher auftretender Schwierigkeiten und Hürden gelingen kann. Hierzu wird zunächst eine begriffliche Abgrenzung der Jugendhilfe gezogen und ihr Leistungsspektrum umrissen. Um mögliche Anknüpfungspunkte herauszuarbeiten, werden die verschiedenen Aufgabenbereiche der Schule dargestellt. Im Anschluss werden mögliche Hürden und Möglichkeiten der Kooperation erörtert.
Eine Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung ist insofern relevant, dass Jugendhilfe und Schule zwei grundlegend verschiedene pädagogische Systeme darstellen, die zwar beide einen Sozialisationsauftrag haben, aber Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Perspektiven betrachten und ihnen auf unterschiedliche Weise begegnen. Schule hat sich vom Lern- zum Lebensort gewandelt; dies trifft insbesondere für die Ganztagsschulen zu. Mit dem gesellschaftlichen Wandel sehen sich viele Kinder und Jugendliche immer mehr sozialen und individuellen Schwierigkeiten gegenüber. Bei vielen Heranwachsenden äußert sich dies beispielsweise im Schulabsentismus und einem Abfall der schulischen Leistungen sowie einer generellen Ablehnungshaltung der Schule gegenüber. Familiäre Bedingungen und Erziehungsschwierigkeiten der Eltern, Unsicherheiten bezüglich der Aufenthaltserlaubnis bei minderjährigen Geflüchteten sowie damit verbundene mögliche seelische Beeinträchtigungen (beispielsweise durch Kriegserfahrungen) können die Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen ebenfalls beeinträchtigen. Damit der Schul- und Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen gesichert werden kann, müssen Jugendhilfe und Schule eng zusammenarbeiten und Diagnostik, Prävention und Intervention bei Problemen leisten. Dies kann nur durch einen engen und kontinuierlichen Austausch der Fachkräfte sowie der Eltern und adäquater Rahmenbedingungen realisiert werden.
2. Schule
Die Institution Schule unterliegt bestimmten äußeren Regularitäten wie der Schulpflicht, dem Grundgesetz und den Landesschulgesetzen. Sie ist formal strukturiert was ihre Ziele, Inhalte, Rahmenbedingungen und Überprüfungsformen betrifft. Die Verwaltung des Schulwesens obliegt dem jeweiligen Bundesland. Als öffentliche Institution wird sie staatlich beaufsichtigt und begünstigt die Formung von Eliten. In Deutschland ist die Bildungsinstitution Schule sowohl horizontal als auch vertikal in verschiedene Schulformen gegliedert; ergänzt werden diese durch Berufsschulen und Förderschulen. Außerschulische Ansprechpartner bilden die Schulämter und Schulbehörden.1
2.1. Aufgaben der Schule
„Die Schule hat den gesellschaftlichen Auftrag, Kinder und Jugendliche für ihr Leben zu qualifizieren, indem sie ihnen Allgemeinbildung und beruflich verwertbare Kenntnisse vermittelt. [...] Alle Kinder haben nicht nur das Recht, die Schule zu besuchen, sondern auch die Pflicht, dies zu tun.“[2]
Schule und ihre wirkenden Fachkräfte haben die Aufgabe, den Bildungserfolg und die Qualifikation der SchülerInnen zu gewährleisten. Hierzu bedient sich Schule selektierender Maßnahmen wie Klausuren, Lernstandtests, mündlichen Prüfungen und weiteren Überprüfungsformen. Zugleich hat sie aber die Aufgabe, Kinder und Jugendliche mit verschiedenen sozialen Zugangsvoraussetzungen in die Schulgemeinschaft zu integrieren und zu einem demokratischen Miteinander zu erziehen.3
Aufgrund der leistungsabhängigen Selektion hat Schule eine Verteilungsfunktion, da sie Berechtigungen und gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten erteilt.4
3. Jugendhilfe
Die Jugendhilfe basiert hingegen auf Freiwilligkeit und ist rechtlich im Bundesgesetz SGB VIII sowie den Landesausführungsgesetzen zum SGB VIII verankert. Sie stellt einen unterstützenden Teil des Erziehungssystems und der Sozialen Arbeit dar. Ihre gesellschaftliche Wertschätzung erfährt sie durch ihre Beschäftigung mit und ihre Angebote für Problemgruppen. Wie in SGB VIII kodifiziert, zeichnet sie sich durch eine Pluralität von institutionellen Erscheinungsformen und öffentlich-freien Trägern aus; unter Anderem arbeitet sie eng mit Jugendämtern zusammen.5
3.1. Definition von Jugendhilfe
Der Blick in die Fachliteratur zeigt, dass eine konkrete Definition der Jugendhilfe aufgrund ihres breiten und vielschichtigen Wirk- und Aufgabenspektrums schwierig aufzustellen ist.6 Das BMFSFJ beschreibt die Kinder- und Jugendhilfe folgendermaßen:
„Die Kinder- und Jugendhilfe fördert Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und hilft jungen Erwachsenen in besonders schwierigen Situationen. Sie berät und unterstützt Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung ihrer Kinder.“7
3.1.1. Aufgaben der Jugendhilfe
Primär setzt sich Jugendhilfe das Ziel, Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien bei der Lebensbewältigung und sozialen Integration zu unterstützen. Dies realisiert sie, indem sie für positive Lebensvoraussetzungen und Entwicklungschancen die Grundsteine legt und die sozio-individuelle Entfaltung der Beteiligten fördert, um Benachteiligungsstrukturen zu mindern.8
Der Leistungsbereich der Jugendhilfe erstreckt sich auf Förderangebote in Zusammenarbeit mit der Schule, mit Erziehungsberechtigten und mit Kindertageseinrichtungen. Zudem stellt die Jugendhilfe Unterstützungsangebote für Erziehende, seelisch beeinträchtigte Kinder und Heranwachsende sowie für junge Erwachsene zur Verfügung.9
Des Weiteren ist die Jugendhilfe laut § 42 im Sozialgesetzbuch dazu verpflichtet, Kinder und Jugendliche in ihre Obhut zu nehmen; eine vorläufige Inobhutnahme erfolgt bei den Schützlingen, die unbegleitet nach Deutschland einreisen. Zudem verfügt die Jugendhilfe über die Entscheidungshoheit im Hinblick auf die Pflegeerlaubnis der Heranwachsenden, kann in Familiengerichten mitwirken und die Vormundschaft ihrer Bedürftigen anerkennen. Ferner können auch Mütter, Pflegende und Vormünder die Beratung und Unterstützung der Jugendhilfe bei der Vaterschaftsfeststellung sowie der Forderung von Unterhaltsgeld in Anspruch nehmen.10
4. Unterschiede zwischen der Schule und der Jugendhilfe
Die Bildungs- und Erziehungssysteme Schule und Jugendhilfe sind voneinander unabhängig organisiert und weisen seit Anfang der zwanziger Jahre eine separate Entwicklung auf. Schule schreibt der Sozialpädagogik eine untergeordnete Bedeutung zu und sieht sie als Auffangstelle für schwierige und störende SchülerInnen. Die Schule zeigt einen deutlichen Grad an Institutionalisierung, wobei erkennbare Zuständigkeitsstrukturen und hierarchische Ordnungen etabliert werden. Sie ist im Zuständigkeitsbereich der Länder angesiedelt. Als staatliches Pflicht- bzw. Zwangssystem fungiert sie als Institution formaler Bildung, setzt Lernzeiten und -orte fest und geht von homogenen Lerngruppen und Lernbedingungen aus, deren Leistungen einer standardisierten Beurteilung unterliegen. Der selektive Leistungsdruck begleitet die Lernenden in ihrer gesamten Schullaufbahn und bestimmt maßgeblich die Versetzung oder Nicht-Versetzung.11
Die Jugendhilfe ist kommunal organisiert und wird von diversen Trägern finanziert. Als Teil der Sozialen Arbeit sieht sie sich fernab von einem Belohnungssystem auf Grundlage von Leistungen: Sie zielt auf Integration statt Segregation. Die Angebote und Leistungen können von Interessierten auf freier Basis in Anspruch genommen und thematisch mitbestimmt werden. Die Jugendarbeit ist maßgebend lebensweltlich ausgerichtet und dabei frei von lernzielorientierten Vorgaben oder Selektionsmechanismen.12
Sowohl Jugendhilfe als auch Schule befinden sich in einem stetigen Wandel, der von einer gegenseitigen Annäherung gekennzeichnet ist: Die Jugendhilfe misst Bildung seither stärker Bedeutung bei und konzentriert sich darauf, die Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen auf ihre Zielgruppen abzuschwächen. Die Schule wird mit den Herausforderungen der Individualisierung und der kumulativen Fokussierung auf Leistung konfrontiert. Zudem wird angestrebt, dass die Schule sich zu einem Ort des Lebens entwickelt und nicht nur als reiner Lernort fungiert. Sowohl die Jugendhilfe als auch die Schule haben als Sozialisationsinstanz die gemeinsame Aufgabe, Kinder zu mündigen, gleichberechtigten Mitgliedern der Gesellschaft heranzubilden. Ebenso sind beide Systeme für Bildung und Erziehung der Bezugspersonen verantwortlich, richten sich an den gleichen Personenkreis und haben dasselbe räumliche Bezugsnetzwerk. Des Weiteren ist die für eine Fortentwicklung notwendige Planungskultur beiden Instanzen systeminhärent.13 Inwiefern eine Kooperation zwischen beiden Institutionen ungeachtet der Unterschiede und vor dem Hintergrund der Gemeinsamkeiten erfolgen kann, wird im nächsten Kapitel herausgearbeitet.
5. Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
Schule und Jugendhilfe haben das gemeinsame Ziel der Sozialisation Heranwachsender. Eben dieses Ziel stellt die Basis sämtlicher Kooperationsvereinbarungen beider Instanzen dar. Zur Sicherung der Sozialisation und des Schulerfolges sind Schule und Jugendhilfe aufeinander angewiesen. Primär unterliegt der Bildungsauftrag rechtlich nach Art. 7 GG der Schule. Die Jugendhilfe setzt dann ein, wenn soziale oder individuelle Benachteiligungen den schulischen Erfolg gefährden oder wenn sie die parentale Rolle bei der Bildungsgewährleistung ersetzen oder unterstützen muss. Die Kooperation beider Systeme ist unabdingbar, damit beide ihre jeweilige Aufgabe erfüllen können.14
Wieland formuliert es folgendermaßen:
„Wenn Schule den in § 13 Abs. 1 SGB VIII definierten Fall als gegeben sieht oder mit Eltern konfrontiert ist, die ihre elterlichen Funktionen nicht oder nur mithilfe von Fachleuten der Jugendhilfe ausüben, braucht sie den Kontakt zur Jugendhilfe, die entsprechende Hilfen einleitet bzw. gewährt.“15
Allerdings lässt auch diese Beschreibung die Wege der konkreten Kooperationsmaßnahmen offen. Vorauszusetzen ist, dass SchulpädagogInnen sich mit der Arbeitsweise der Jugendhilfe auseinandersetzen und Kontakt zu Fachpersonal aufbauen; ebenso wie, dass Sozialarbeiter der Jugendhilfe das System Schule kennen und die Interaktion mit Lehrenden suchen. Allerdings kritisiert die Jugendhilfe, dass eine systemimmanente Veränderung zu einer stärkeren Öffnung und einer Kooperation auf Augenhöhe mit der Jugendhilfe seitens der Schule nicht besteht. Daher wird die Forderung nach einer wechselseitigen fachlichen Anerkennung der FunktionsträgerInnen laut.16
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule wird bereits in dem Dritten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes angeordnet. Dort heißt es:
„Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie sollen sich insbesondere bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen.“17
Wie genau diese Kooperation jedoch erfolgen soll, wird in diesem Gesetz nicht näher erläutert. So heißt es im Weiteren, dass die öffentlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Kooperation durch die Einrichtung solcher Strukturen, die eine Beteiligung aller im Sozialraum befindenden Schulen und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe sichern, fördern sollen. Zudem wird die Gestaltung und Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts vorausgesetzt, welches über die Schwerpunkte und Bereiche der Zusammenarbeit und über die Realisierungsschritte Aufschluss gibt.18
5.1. Möglichkeiten und Wege der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
Schlägt man den Begriff Kooperation im Lexikon nach, findet man folgende Definition des Begriffs: „[A]uf ein gemeinsames Ziel gerichtete Tätigkeit mehrerer Partner, von denen jeder bestimmte Teilaufgaben übernimmt, Zusammenarbeit“19. Übertragen auf die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule impliziert dies, dass sich beide Institutionen als gleichberechtigte Partner wahrnehmen, sich gemeinsam der Lösung von Konflikten widmen und Aufgabenverteilungen vornehmen.20
Laut Maykus sollten Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schule und Jugendhilfe zum Einen im Gesetz verankert sein und des Weiteren in den Förderrichtlinien, Konzepten, Empfehlungen, Qualitätsstandards und den Schulprogrammen. Ferner sollte die kommunale Zusammenarbeit von Schul- und Jugendhilfeverwaltung nach Maykus optimiert werden. Schule und Jugendhilfe sollten sowohl im Sozialraum als auch im regionalen Raum durch entsprechende Netzwerke verbunden sein. Beide Partner verschreiben sich der Auseinandersetzung mit Themen wie der Transition von Schule zum Beruf, der Elternarbeit, dem Umgang mit verhaltensauffälligen Lernenden, gemeinsamen Projekten sowie Hilfen in Fragen zur Erziehung. Als konkrete Formen der Zusammenarbeit nennt Maykus die Implementierung von Fachtagen oder Runde Tischen, die Einzelfallarbeit und Fallkooperation, themenspezifische Projekte und gemeinsame Fortbildungen vor.21
Als Faktoren einer gelingenden Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe führt Maykus die positive Wahrnehmung der Öffnungstendenzen und eine kooperationstolerante Eigenständigkeit beider Seiten an. Darüber hinaus sollten Kooperationsvereinbarungen und -gestaltungen von Beginn an transparent sein. Eine erfolgreiche Kooperation setzt ebenso die Klärung von Strukturen und Arbeitsebenen voraus, um ein qualitatives Arbeitsverhältnis zu schaffen. Anlassbezogene Zielsetzungen wie die Planung von Inhalten und Projekten können die Zusammenarbeit erleichtern und voranbringen. Die Kooperation sollte zudem regelmäßig bewertet und gepflegt werden, um ihre Langfristigkeit und Qualität zu gewährleisten.22
Maykus zeichnet zwei Ebenen von notwendigen Kooperationsvoraussetzungen auf: Auf der ersten (höheren) Ebene befinden die wesentlichen übergreifenden Entwicklungserfordernisse, die fachpolitisch und überindividuell definiert sind; auf der darauffolgenden zweiten Ebene befinden sich die Entwicklungserfordernisse der Schule und der Jugendhilfe, die sich spezifisch an die Fachpersonen richten. Auf der zweiten Ebene ist die Einführung von Kommunikationsstrukturen von großer Relevanz. Eine effektive Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule kann beispielsweise durch Bildung von interdisziplinären Arbeitsgemeinschaften erfolgen, die aus den Fachkräften des Lehrpersonals und der Schulsozialarbeiter sowie der Jugendhilfe bestehen. Ferner können die Sozialpädagogen in Gremien einbezogen werden, um Qualitätskriterien zu ermitteln und zu evaluieren. Hierbei ist der offene und stetige Austausch zwischen den Fachkräftegruppen von großer Relevanz. Der kollegiale Austausch hinsichtlich Fragen der Angebotserweiterung, Selbstevaluation und Qualitätssicherung muss seitens der Schule ermöglicht werden.23
Weiterentwicklung sollte auch auf Ebene des Schulkonzeptes in Partizipation der Schulsozialarbeiter erfolgen; hier können verpflichtende Zielsetzungen und Kooperationsvereinbarungen entwickelt werden. Die Bereitstellung und Realisierung von materiell-technischen Voraussetzungen wie (Besprechungs-)Räumen, Diensttelefon, Computer sollte Schule gewährleisten. Für eine kontinuierliche finanzielle Sicherheit sollte seitens der Bildungspolitik gesorgt werden, indem neuartige Finanzierungsmodelle entworfen werden, so Maykus. Des Weiteren sollte die Jugendhilfe im Schulgesetz stärker verankert und ihre schulische Kooperation im SGB VIII präzisiert werden. Die Gewährleistung gemeinsamer Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten fällt ebenfalls unter die übergreifenden Rahmenbedingungen. Bereits in der Ausbildung beider Fachkräftegruppen sollten gemeinsame Diskurse geschaffen und Berührungspunkte der Schul- und Sozialpädagogik thematisiert werden, um Kooperationen den Weg zu ebnen.24
Die Gelingensbedingungen für die Kooperation können in sechs Felder zusammengefasst werden: Sicherheit, Fachlichkeit, Klarheit, Offenheit, Wertorientierung, Partnerschaftlichkeit und stabile Rahmenbedingungen. Ein an die systematische Qualitätsentwicklung nach Karsen Speck (2004) angelehntes Verfahren kann als Leitfaden dienen. Dieses Verfahren unterscheidet zwischen Vorbereitung, Konzeptentwicklung und Qualitätssteuerung, Information und Transfer sowie Bericht und Reflexion. Nach erfolgtem Durchlauf des Verfahrens wird an der Konzeptgestaltung und Qualitätssteuerung erneut angesetzt, sodass sich ein Kreislauf bildet.25
In der ersten Phase der Vorbereitung erfolgen Vorgespräche zwischen den Leitungen, die die Analyse des Bedarfs, der Transparentmachung von Zielen und Erwartungen, die Planung der Finanzierung und Evaluation der Rahmenbedingungen sowie die Festlegung der Agierenden und der Ebenen thematisieren. Hierbei werden Erwartungen, Rollen, Ziele und Grenzen aller Akteure intern festgelegt. In der nächsten Phase der Konzeption und Qualitätssteuerung werden die Grundsteine und Inhalte der Kooperation schriftlich verhandelt: Absprachen bezüglich der Zuständigkeiten und Konfliktbewältigungsverfahren werden getroffen, Ansprechpersonen werden gewählt und weitere Teamsitzungen werden festgelegt. Die Implementierung einer Steuergruppe, die Vertreter aller Gruppen beinhaltet, sowie einer Kooperationsarbeitsgruppe, die alle Systembeteiligten umfasst, sollen die Entwicklung von Qualitätsstandards und -verfahren und ihre Sicherung in den Blick nehmen. In der Phase des Transfers und der Information werden die breite Öffentlichkeit und die Eltern und SchülerInnen mit den Kooperationsprozesse und dem Fachpersonal bekannt gemacht. Hier erfolgt die Vernetzung mit außerschulischen Partnern und den Institutionen der Jugendhilfe. Es folgt die Phase der Evaluation, in der regelmäßig die Einhaltung der Ziele und die Qualitätsentwicklung überprüft werden sollten. Die Ergebnisse der Evaluation werden im Jahresbericht und als Selbstevaluation sowie Konzeptreflexion zum Anlass genommen und anschließend veröffentlicht.26
5.2. Mögliche auftretende Probleme in der Kooperation
Aufgrund der ähnlichen Aufgabenbereiche von SozialpädagogInnen und Lehrkräften sollten ihre Zuständigkeiten im Nachmittagsbereich klar definiert werden, um Unklarheiten und Überschneidungen zu vermeiden. Zudem kann die Unsicherheit der Finanzierung zu Problemen bei der kontinuierlichen Einstellung von weiterem Personal führen. In der Fachliteratur wird auf den Mangel an qualitativen Kooperationskonzepten, die Ausnutzung des Jugendhilfepersonals bei der Übermittagsbetreuung und die verstärkte schulische Einbindung der Jugendhilfe ohne Rücksicht auf die freie Jugendarbeit hingewiesen.27
Die Kooperationsbeeinträchtigungen von Schule und Jugendhilfe können vor allem struktureller Natur sein, da bereits auf Ausbildungsebene die Zweiteilung in Studium und Ausbildung erfolgt. Während Schule systematisch-formal strukturiert ist, wird Jugendhilfe in frei gestaltbaren Räumen aktiv. Der Blick auf die Personallage zeigt, dass häufig ein Schulsozialarbeiter in einem Lehrerkollegium tätig ist und die Jugendhilfe singulär vertritt.28
Als Kooperationshindernisse können die bestehende Gesetzeslage und die politischen Rahmenbedingungen angeführt werden, die einen Optimierungsbedarf aufweisen. Dieser besteht in Bezug auf das Thema der Bildung, die weit gestreute Finanzierung sowie den hinderlichen Datenschutz. Der verstärkte Fokus auf ein Ergebnis und eine Wirkungsorientierung sind zielführender aus Sicht der Experten. Zudem muss die Zusammenarbeit mit den Eltern stärker in den Blick genommen werden, um Familien grundlegender zu unterstützen. Widerstrebende Vorbehalte gegenüber der Kooperation seitens der Fachkräfte können ebenfalls für eine Beeinträchtigung der Zusammenarbeit sorgen, sodass von Beginn an eine positive Motivierung der Lehrenden erfolgen muss. Dies kann durch eine Optimierung ihrer Fachkenntnisse durch Fort- und Weiterbildungsangebote hinsichtlich der Kooperation geschehen. Auch die Ressourcenknappheit von Personal und die verschiedenen Arbeitskulturen beider Fachkräftegruppen können hinderlich sein. Daher muss für eine kontinuierlichen Aufstockung der personellen Ressourcen gesorgt werden und unterschiedliche Arbeitszeiten müssen bei der Gestaltung von Gremien berücksichtigt werden.29
Laut dem aktuellen 16. Kinder- und Jugendbericht könnten die Potenziale der verstärkten Kooperation zwischen außerschulischen Partnern der Jugendhilfe und der Schule noch weiter ausgeschöpft werden, besonders vor dem Hintergrund der politischen Bildung im Ganztag.30
5.3. Beispiel eines gelungenen Kooperationsprojekts: Das Projekt „AGIL“
In der Informationsbroschüre zur Jugendhilfe und Schule der Stadt Aachen werden einige good practice -Beispiele wie das Projekt „AGIL“ an Grundschulen exemplarisch angeführt. „Aktiver gesünder is(s)t leichter“ lautet das Präventionsprogramm, das der Ortsverband Aachen des Deutschen Kinderschutzbundes seit 2007 verfolgt und untersucht, wie ErzieherInnen und LehrerInnen Kinder unterschiedlichen Alters dazu motivieren können, mehr Obst und Gemüse zu sich zu nehmen und sportlich aktiver zu werden. Finanziert wird das Projekt durch das Bundesprogramm „Besser Essen. Mehr Bewegen. KINDERLEICHT-Regionen“. Die Moderatoren des Projekts sind spezifisch für Ernährung und Psychomotorik ausgebildet und statten einmal pro Woche in einem Zeitraum von zwei Jahren ausgewählten Kindertagesstätten und Primarschulen einen Besuch ab. Die beteiligten Kinder durchlaufen insgesamt 80 Themeneinheiten zu Ernährung und Bewegung. Dieses Projekt ist besonders nachhaltig, da die ErzieherInnen und LehrerInnen ebenfalls eingebunden werden und nach Programmende an den Programmpunkten anknüpfen können. Für SchülerInnen der Primarschule findet dieses Programm einen Wiedererkennungswert beim Wechsel in eine Offene Ganztagsschule und ihre Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich. Ein weiterer Vorteil des Programms stellt der verstärkte Austausch zwischen den Fachkräften der Kindertagesstätten und Schulen dar und kann Übergänge zwischen den Institutionen erleichtern.31
6. Reflexion
Eine abschließende Betrachtung zeigt, dass sowohl Jugendhilfe als auch Schule grundlegende Unterschiede in Struktur und Arbeitsweise aufweisen, die jedoch zugunsten der Kooperation genutzt werden können.
Das Gelingen der Kooperation ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Auf der Ebene der Akteure sollte eine offene Kommunikationskultur geschaffen werden, die den Rahmen für die gegenseitige Wertschätzung und kooperationsbegeisterte Haltung der beteiligten Fachkräfte bildet. Die Begegnung auf gleicher Augenhöhe ist besonders relevant, da die Berufsgruppen sich sowohl in Ausbildung als auch in Ansehen nach wie vor stark unterscheiden und ein mögliches Hindernis darstellen können. Daher muss im Vorhinein eine klare Zuständigkeitszuordnung und Rolleneinteilung der Fachkräfte erfolgen, um Erwartungshaltungen, Missverständnissen und Überschneidungen zu vermeiden. In einem Kooperationsvertrag sollten unter Anderem getroffene Vereinbarungen bezüglich Aufgabenteilungen, Arbeitsweise, Besprechungen und Maßnahmen schriftlich protokolliert und dokumentiert werden. Dieser kann zugleich bei der Evaluation und Überprüfung der Qualität der Kooperation von Nutzen sein und weitere Entwicklungsbereiche erkennbar machen.
Der fachliche Austausch des Personals kann durch die Bildung von interdisziplinären Arbeitsgruppen unterstützt werden, bei dem alle Fachkräfte des Systems Schule und Jugendhilfe eingebunden sind. Hierzu gehören auch gemeinsame Fortbildungen, um sich gegenseitig anzunähern und gemeinsame Diskurse und thematische Berührungspunkte zu schaffen.
Den übergreifenden Rahmen bildet die finanzielle Sicherung der Kooperation von Schule und Jugendhilfe, da letztere von öffentlichen Trägern in unterschiedlicher Höhe finanziert wird. Hier sollten neue Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden, um eine kontinuierliche qualitative Zusammenarbeit zu gewährleisten. Ebenso sollten personelle, materielle und räumliche Ressourcen kontinuierlich bereitgestellt werden.
Der Stellenwert einer gelingenden Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist gegenwärtig so hoch wie noch nie und wird mit Blick auf mögliche Veränderungen in der Bildungspolitik umso mehr an Bedeutung gewinnen, um Kinder und Jugendliche, die dem Wandel der Gesellschaft und dem Bildungswesen sowie individuellen Schwierigkeiten gegenüberstehen, aufzufangen und bestmöglich zu unterstützen.
7. Literaturverzeichnis
Bock, Karin: Die Kinder- und Jugendhilfe. In: Thole, Werner (Hsrg.) (2012): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag. S. 439-460.
Maykus, Stephan (2011): Kooperation als Kontinuum. Erweiterte Perspektive einer schulbezogenen Kinder- und Jugendhilfe. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
Meyer, Thomas/Patjens, Rainer (Hrsg.) (2020): Studienbuch Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
Rausch, Jürgen/Berndt, Stefan (2012): Jugendhilfe in Kooperation mit der Ganztagsschule. Zum Strategieverständnis von Jugendhilfe im Wandel von Schule. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
Olk, Thomas/Speck, Karsten: Kooperation von Jugendhilfe und Schule. In: Thole, Werner (Hsrg.) (2012): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer VS Verlag. S. 355-360.
Wieland, Norbert (2010): Die soziale Seite des Lernens. Positionsbestimmung von Schulsozialarbeit. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
Online-Quellen:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2020): 16. Kinder- und Jugendbericht. Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf [Stand: 12.07.2023].
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2022): Fragen und Antworten: Kinder- und Jugendhilfe. Verfügbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/kinder-und-jugendschutz/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe/fragen-und-antworten-kinder-und-jugendhilfe-86352 [Stand: 13.07.2023].
Deutsches Rotes Kreuz (2011): „Jugendsozialarbeit an Schule erfolgreich gestalten - Qualitätsentwicklung in der Kooperation von Jugendsozialarbeit und Schule“. Expertise. Verfügbar unter: https://jugendsozialarbeit.de/media/raw/Expertise_QE_DRK.pdf [Stand: 13.07.23].
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) (2005): Leitgedanken zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Verfügbar unter: https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=25136&token=5b348dd797576658508272e557703afff7fd1a66&sdownload= [Stand: 30.06.2023].
DWDS (2023): Kooperation. Eine Definition. Verfügbar unter: https://www.dwds.de/wb/Kooperation [Stand: 14.07.2023].
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2023): Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG). Verfügbar unter: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6645&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=424701 [Stand: 30.06.2023].
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI NRW): Aufgaben des Jugendamtes. Verfügbar unter: https://www.mkjfgfi.nrw/aufgaben-des-jugendamtes [Stand: 01.07.2023].
Sozialgesetzbuch SGB VIII: Achtes Buch. Kinder- und Jugendhilfe. Verfügbar unter: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/2.html [Stand: 30.06.2023].
Stadt Aachen (2019): Jugendhilfe und Schule. Zukunft gemeinsam gestalten. Eine Broschüre. Verfügbar unter: https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/familie/dokumente/jugendhilfe_schule.pdf [Stand: 13.07.2023].
8. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Systematische Qualitätsentwicklung in der Schulsozialarbeit. In: Deutsches Rotes Kreuz (2011): „Jugendsozialarbeit an Schule erfolgreich gestalten - Qualitätsentwicklung in der Kooperation von Jugendsozialarbeit und Schule“. Expertise. S. 44.
[...]
1 Vgl. Maykus 2011, S. 92.
2 GEW 2005, S. 12.
3 Vgl. Maykus 2011, S. 92.
4 Vgl. GEW 2005, S. 12.
5 Vgl. Maykus 2011, S. 92.
6 Vgl. Bock 2012, S. 440.
7 BMFSFJ 2022.
8 Vgl. Maykus 2011, S. 92.
9 Vgl. Sozialgesetzbuch SGB VIII: Achtes Buch. Kinder- und Jugendhilfe.
10 MKJFGFI NRW: Aufgaben des Jugendamtes.
11 Vgl. Rausch/Berndt 2012. S. 49 f.
12 Vgl. ebd., S. 50.
13 Vgl. ebd., S. 51.
14 Vgl. Wieland 2010, S. 180 f.
15 Ebd., S. 181.
16 Vgl. ebd., S. 181 f.
17 3. AG-KHJG-KJFöG, §7/1.
18 Vgl. 3. AG-KHJG-KJFöG, §7/2-3.
19 DWDS „Kooperation“.
20 Vgl. Maykus 2011, S. 25.
21 Vgl. ebd., S. 26.
22 Vgl. ebd., S. 43.
23 Vgl. Maykus 2011, S. 52.
24 Vgl. ebd., S. 52.
25 Vgl. Deutsches Rotes Kreuz 2011, S. 43.
26 Vgl. Deutsches Rotes Kreuz 2011, S. 44.
27 Vgl. Olk/Speck 2012, S. 357 f.
28 Vgl. Maykus 2011, S. 61.
29 Vgl. Rausch/Berndt 2012, S. 128 f.
30 Vgl. BMFSFJ 2020, S. 17.
31 Vgl. Stadt Aachen 2019, S. 46 f.
- Quote paper
- Yaren Erkan (Author), 2023, Wie kann die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule trotz möglicher auftretender Probleme stattfinden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1544127