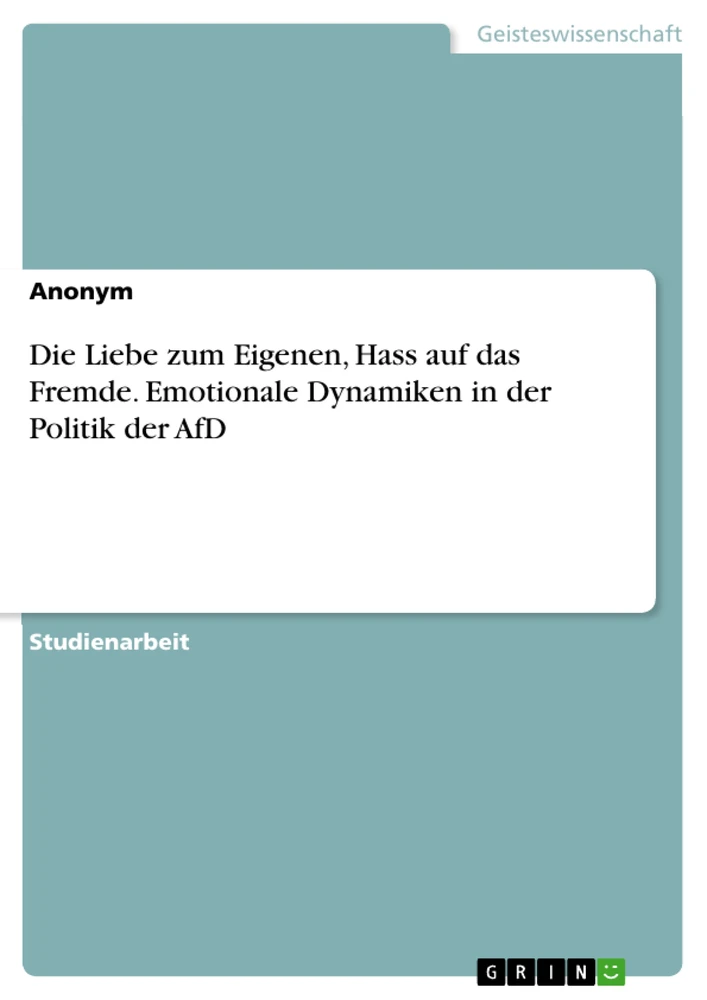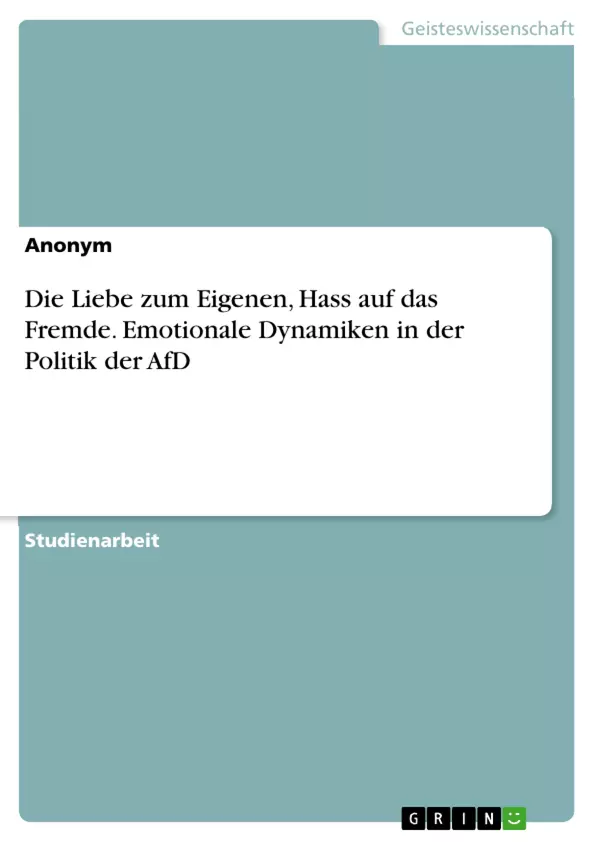Diese Hausarbeit analysiert die emotionalen Dynamiken in der politischen Kommunikation der Alternative für Deutschland (AfD). Im Mittelpunkt steht die Frage, welche politischen Emotionen die AfD nutzt, wie sie erzeugt werden und welche Rolle diese bei der Mobilisierung und Festigung ihrer Anhängerschaft spielen. Die Arbeit untersucht zentrale Mechanismen wie das "Wir gegen die"-Schema, den Einsatz von Humor und implizitem Hass sowie die Bedeutung sozialer Medien. Außerdem beleuchtet sie, wie tief verankerte gesellschaftliche Strukturen wie Rassismus und psychologische Phänomene wie "psychic-numbing" die Strategien der AfD unterstützen. Ergebnisse zeigen, wie die AfD durch affektive Dynamiken eine starke emotionale Bindung zu ihrer Anhängerschaft schafft und ihre politische Agenda vorantreibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das kollektive „Wir“ bei der AfD
- Affekttheorie
- Die Nutzung von Humor
- Hass als Grundlage für ein stärkeres Wir-Gefühl
- Die Rolle des strukturellen Rassismus
- Das Phänomen „psychic-numbing“
- Die Rolle der sozialen Medien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, wie die AfD politische Emotionen nutzt, um Anhänger zu mobilisieren und ihre politische Agenda voranzutreiben. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Welche politischen Emotionen nutzt die AfD in ihrer Kommunikation, wie werden diese erzeugt und wie bewirken diese eine Festigung der Anhängerschaft?" Ein besonderer Fokus liegt auf der Erzeugung eines kollektiven „Wir-Gefühls“ und der damit verbundenen Abgrenzung von Außenstehenden. Die Rolle von Humor und implizitem Hass wird ebenfalls analysiert.
- Analyse der emotionalen Strategien der AfD zur Mobilisierung von Wählern.
- Untersuchung der Konstruktion eines kollektiven „Wir-Gefühls“ bei der AfD.
- Die Rolle von Humor und implizitem Hass in der Kommunikation der AfD.
- Der Einfluss von Affekten auf die politische Mobilisierung.
- Die Abgrenzung von „Innen“ und „Außen“ durch die AfD.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der emotionalen Strategien der AfD ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Nutzung politischer Emotionen zur Mobilisierung von Anhängern und zur Durchsetzung der politischen Agenda. Sie betont die Bedeutung der jüngsten Wahlergebnisse und die zunehmende Zustimmung der AfD bei jungen Wählern. Die Arbeit kündigt eine Analyse der Mechanismen an, mit denen die AfD ein Wir-Gefühl erzeugt und gleichzeitig Außenstehende ausschließt, mit einem Fokus auf Humor und implizitem Hass. Die methodische Vorgehensweise, die auf Literatur, ethnologischen Beobachtungen und Interviews beruht, wird ebenfalls skizziert.
Das kollektive „Wir“ bei der AfD: Dieses Kapitel analysiert die Strategie der AfD, ein kollektives „Wir-Gefühl“ zu schaffen, indem sie ein „Wir gegen die“-Schema verwendet. Es wird auf die Unterscheidung zwischen „In-Group“ und „Out-Group“ eingegangen, wobei die „In-Group“ (die Anhänger der AfD) positiv dargestellt wird, während die „Out-Group“ (die Außenstehenden) als Bedrohung wahrgenommen wird. Das Kapitel beleuchtet, wie diese Konstruktion der sozialen Identität durch Emotionen und sprachliche Mittel unterstützt wird, und wie Rechtspopulisten Beschimpfungen und Schuldzuweisungen nutzen, um ihre eigene Gruppe von der Verantwortung freizusprechen. Es wird auf die Bedeutung von Emotionen als kulturelle und soziale Konstruktionen hingewiesen, die über individuelle innere Zustände hinausgehen.
Affekttheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Affekttheorie als methodischem Ansatz zur Untersuchung von Emotionen und Kollektiven. Die Affekttheorie betont nicht-sprachliche Kräfte (Affekte), die Menschen beeinflussen, und betrachtet Emotionen als „zwischen“ Kräfte, die Körper auf bestimmte Weise miteinander verbinden. Es wird auf die Verbindung der Affekttheorie zum Schauspiel eingegangen, um zu verdeutlichen, dass Macht nicht nur durch Worte, sondern auch durch Gefühle und körperliche Ausdrucksformen vermittelt wird. Die Affekttheorie versteht Macht als ein dynamisches Wechselspiel zwischen Akteur und Publikum und betrachtet die emotionale Wirkung politischer Kommunikation, wobei ein Beispiel des kollektiven Lachens als Gemeinschaftsbildner und Abgrenzungsmittel zur eigenen Gruppe gebracht wird.
Die Nutzung von Humor: Dieser Unterabschnitt beschreibt eine ethnografische Beobachtung einer AfD-Wahlkampfveranstaltung. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle des Gelächters als Affekt, der die Teilnehmer verbindet und gleichzeitig politische Gegner herabsetzt. Durch das gemeinsame Lachen wird ein Gefühl der Zugehörigkeit geschaffen und die eigene Gruppe in eine überlegene Position gebracht.
Schlüsselwörter
AfD, Rechtspopulismus, Emotionen, kollektives „Wir“, Affekttheorie, In-Group, Out-Group, Humor, Hass, politische Mobilisierung, soziale Medien, „psychic-numbing“, struktureller Rassismus.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit über die AfD?
Diese Hausarbeit untersucht, wie die AfD politische Emotionen nutzt, um Anhänger zu mobilisieren und ihre politische Agenda voranzutreiben. Sie analysiert insbesondere die Erzeugung eines kollektiven „Wir-Gefühls“ und die damit verbundene Abgrenzung von Außenstehenden, sowie die Rolle von Humor und implizitem Hass.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt dieser Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Welche politischen Emotionen nutzt die AfD in ihrer Kommunikation, wie werden diese erzeugt und wie bewirken diese eine Festigung der Anhängerschaft?"
Welche Themen werden in dieser Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die emotionalen Strategien der AfD zur Mobilisierung von Wählern, die Konstruktion eines kollektiven „Wir-Gefühls“, die Rolle von Humor und implizitem Hass, den Einfluss von Affekten auf die politische Mobilisierung sowie die Abgrenzung von „Innen“ und „Außen“ durch die AfD.
Welche methodischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf Literatur, ethnologischen Beobachtungen und Interviews.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die zentrale Forschungsfrage vor und betont die Bedeutung der jüngsten Wahlergebnisse der AfD. Sie kündigt eine Analyse der Mechanismen an, mit denen die AfD ein Wir-Gefühl erzeugt und gleichzeitig Außenstehende ausschließt.
Was wird im Kapitel "Das kollektive „Wir“ bei der AfD" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Strategie der AfD, ein kollektives „Wir-Gefühl“ zu schaffen, indem sie ein „Wir gegen die“-Schema verwendet. Es wird auf die Unterscheidung zwischen „In-Group“ und „Out-Group“ eingegangen und beleuchtet, wie diese Konstruktion der sozialen Identität durch Emotionen und sprachliche Mittel unterstützt wird.
Was ist die Affekttheorie und welche Rolle spielt sie in dieser Arbeit?
Die Affekttheorie wird als methodischer Ansatz zur Untersuchung von Emotionen und Kollektiven genutzt. Sie betont nicht-sprachliche Kräfte (Affekte), die Menschen beeinflussen, und betrachtet Emotionen als „zwischen“ Kräfte, die Körper auf bestimmte Weise miteinander verbinden.
Welche Rolle spielt Humor in der Kommunikation der AfD, laut dieser Arbeit?
Humor wird als Affekt analysiert, der die Teilnehmer verbindet und gleichzeitig politische Gegner herabsetzt. Durch das gemeinsame Lachen wird ein Gefühl der Zugehörigkeit geschaffen und die eigene Gruppe in eine überlegene Position gebracht.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Hausarbeit verbunden?
Die Schlüsselwörter sind: AfD, Rechtspopulismus, Emotionen, kollektives „Wir“, Affekttheorie, In-Group, Out-Group, Humor, Hass, politische Mobilisierung, soziale Medien, „psychic-numbing“, struktureller Rassismus.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2024, Die Liebe zum Eigenen, Hass auf das Fremde. Emotionale Dynamiken in der Politik der AfD, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1539758