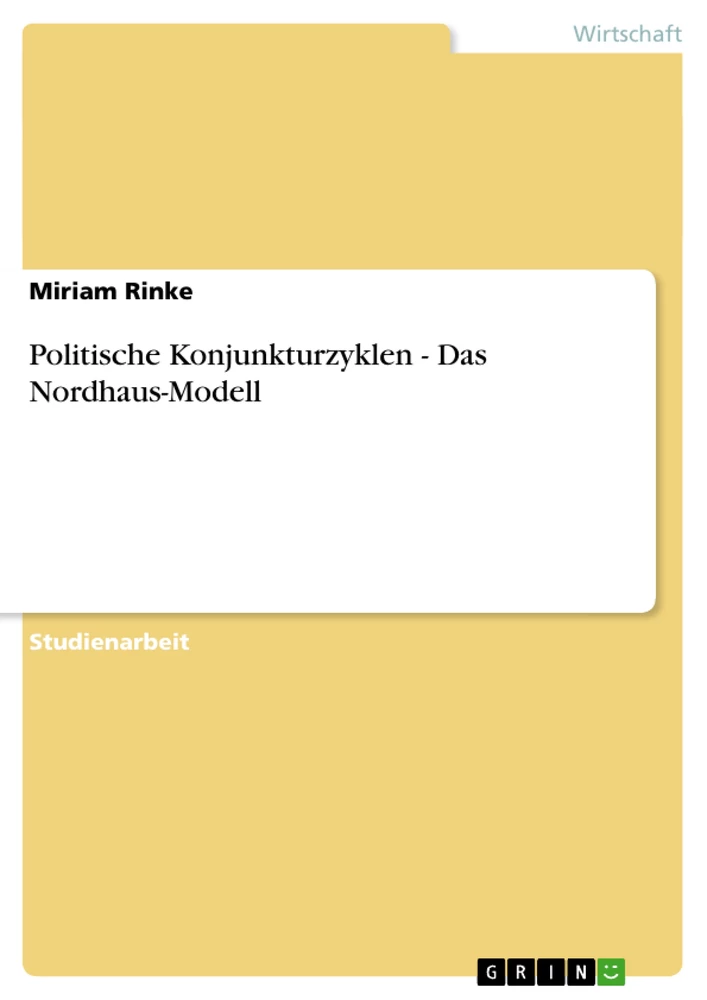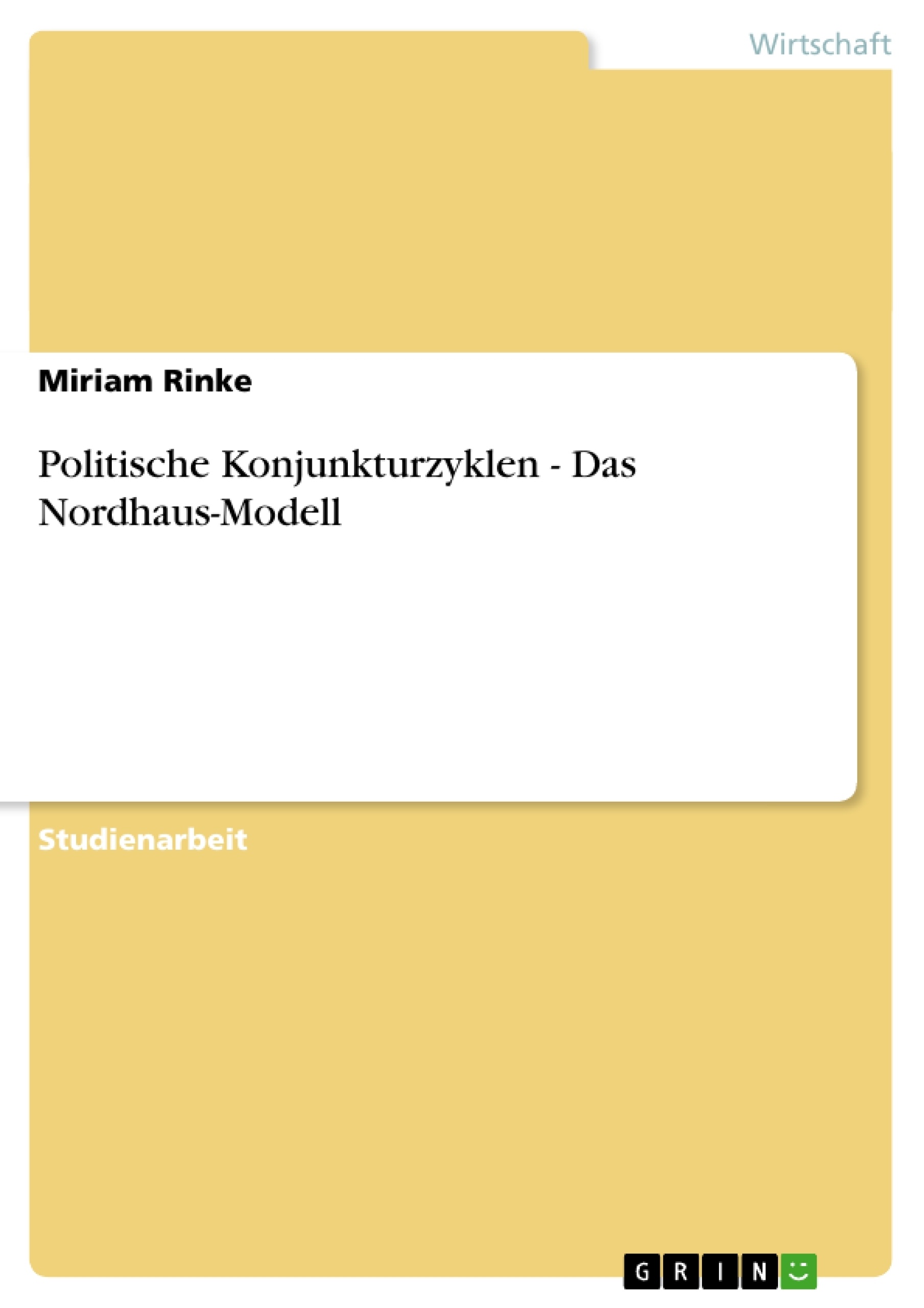„The timing of elections influences the rate of unemployment [...] the short-term managament of
inflation and unemployment, the flow of tranfer payments, the undertaking of expansionary or
contractive economic policies, and the time perspective of economic policy-making...Economic life
vibrates with the rhythms of politics “ [Tufte (1978, S. 137)].
In der traditionellen Volkswirtschaftslehre wird unterstellt, dass sich die wirtschaftspolitischen
Entscheidungsträger auf makroökonomischer Ebene wie wohlwollende Diktatoren verhalten,
welche sich auf eine Stabilisierungspolitik konzentrieren und versuchen, extreme Konjunkturschwankungen
zu glätten. Diese normative Sichtweise berücksichtigt dabei allerdings nicht die
Frage, ob die wirtschaftspolitischen Instanzen überhaupt gewillt sind, sich allgemeinwohlorientierend
zu verhalten oder ob ihre Eigeninteressen bei dem Einsatz konjunkturpolitischer Instrumentarien
miteinfließen, was eine stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik erst beeinträchtigen
würde.
Im Gegenzug dazu berücksichtigt die Theorie des Politischen Konjunkturzyklus dieses Verhalten
der wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie und
untersucht die Auswirkungen und Wechselbeziehungen zwischen Regierung, Wahlzeitpunkten,
Wählern und Wirtschaftslage. Diese Interdependenzen verdeutlicht auch das obige Eingangszitat
von Tufte.
Die ersten Versuche, das Politikerverhalten und die ökonomische Entwicklung miteinander zu
verbinden, fand in der Mitte des 20. Jahrhunderts statt1. Es dauerte allerdings bis 1975, dass
William D. Nordhaus seinen in dieser Hinsicht bahnbrechenden Aufsatz “The Political Business
Cycle“ veröffentlichte, in dem er den Begriff des Politischen Konjunkturzyklus aufgriff und ihn zur
Theorie des Politischen Konjunkturzyklus ausweitete. Nordhaus geht in seiner Ausführung davon
aus, dass es der Regierung möglich ist, einen Konjunkturzyklus und damit Schwankungen in der
Wirtschaft zu erzeugen.
Inhalt dieser Seminararbeit soll deshalb sein, das Konjunkturmodell von Nordhaus darzustellen und
zu erläutern, wobei das Modell im ersten Teil in den Theorienkontext eingeordnet wird.
[...]
1 Siehe dazu u.a. Schumpeter(1939), Kalecki (1943), Akerman (1947), wenngleich die Zusammenhänge von Wirtschaft
und Politik schon früher betrachtet wurden, setzte die intensive Beschäftigung erst Mitte des 20. Jhd. ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Modellbeschreibung
- 2.1. Definition „Politischer Konjunkturzyklus“ und Einordnung des Modells
- 2.2. Annahmen des Modells
- 2.2.1. Phillipskurvenkonzept - Beschreibung der Wirtschaft
- 2.2.2. Wählerverhalten
- 2.2.3. Regierungsverhalten und Politiker
- 2.3. Analytische Modelldarstellung
- 3. Kritische Würdigung des Modells
- 3.1. Allgemeine Kritikpunkte und Problembereiche
- 3.2. Empirische Evidenz des Modells
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit präsentiert und erläutert das Konjunkturmodell von Nordhaus. Zuerst wird das Modell in den Kontext bestehender Theorien eingeordnet. Anschließend werden die Annahmen des Modells bezüglich der Wirtschaft, der Wähler und der Regierung detailliert dargestellt und erklärt. Die Arbeit schließt mit einer analytischen Darstellung des Modells ab.
- Einordnung des Nordhaus-Modells in die Theorie des Politischen Konjunkturzyklus
- Analyse der Annahmen des Modells über Wirtschaft, Wähler und Regierung
- Beschreibung des Phillipskurvenkonzepts im Modell
- Analytische Darstellung des Nordhaus-Modells
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Modell und seiner empirischen Evidenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die traditionelle volkswirtschaftliche Sichtweise gegenüber, die wirtschaftspolitische Entscheidungsträger als wohlwollende Diktatoren darstellt, die Konjunkturschwankungen glätten wollen. Im Gegensatz dazu steht die Theorie des Politischen Konjunkturzyklus, die das Eigeninteresse der Entscheidungsträger und deren Einfluss auf die Wirtschaftspolitik berücksichtigt. Nordhaus' Aufsatz "The Political Business Cycle" von 1975 wird als bahnbrechende Arbeit in diesem Bereich hervorgehoben, die die Möglichkeit der Regierung zur gezielten Erzeugung von Konjunkturzyklen postuliert. Die Arbeit skizziert ihren weiteren Verlauf, der die Darstellung und Erklärung des Nordhaus-Modells, die Erläuterung der Annahmen sowie eine analytische Modelldarstellung umfasst.
2. Modellbeschreibung: Dieses Kapitel definiert den „Politischen Konjunkturzyklus“ und ordnet das Nordhaus-Modell in den theoretischen Kontext ein. Es beschreibt detailliert die Annahmen des Modells, darunter das Phillipskurvenkonzept zur Darstellung der Wirtschaft, das Wählerverhalten und das Regierungsverhalten von Politikern. Die verschiedenen Aspekte des Wählerverhaltens und des politischen Kalküls werden im Detail beleuchtet, und wie diese das wirtschaftspolitische Handeln beeinflussen. Es bildet die Grundlage für die spätere analytische Darstellung des Modells.
3. Kritische Würdigung des Modells: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Bewertung des Nordhaus-Modells. Es beleuchtet allgemeine Kritikpunkte und Problembereiche, die die Vereinfachungen und Annahmen des Modells betreffen. Ein zentraler Punkt ist die Auseinandersetzung mit der empirischen Evidenz, die untersucht, inwieweit die Vorhersagen des Modells durch reale Daten bestätigt werden. Die kritische Würdigung analysiert die Stärken und Schwächen des Modells im Kontext realer wirtschaftspolitischer Prozesse.
Schlüsselwörter
Politischer Konjunkturzyklus, Nordhaus-Modell, Phillipskurve, Wählerverhalten, Regierungsverhalten, Wirtschaftspolitik, Makroökonomie, Neue Politische Ökonomie, Empirische Evidenz, Konjunkturschwankungen.
Häufig gestellte Fragen zum Nordhaus-Modell des Politischen Konjunkturzyklus
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit präsentiert und erläutert das Konjunkturmodell von William Nordhaus, welches den „Politischen Konjunkturzyklus“ beschreibt. Sie ordnet das Modell in den Kontext bestehender Theorien ein, analysiert dessen Annahmen bezüglich Wirtschaft, Wähler und Regierung, und bietet eine analytische Darstellung des Modells sowie eine kritische Würdigung mit Blick auf empirische Evidenz.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Einordnung des Nordhaus-Modells in die Theorie des Politischen Konjunkturzyklus, Analyse der Annahmen des Modells über Wirtschaft, Wähler und Regierung, Beschreibung des Phillipskurvenkonzepts im Modell, analytische Darstellung des Nordhaus-Modells, kritische Auseinandersetzung mit dem Modell und seiner empirischen Evidenz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung, die den Kontext des Politischen Konjunkturzyklus und die Bedeutung des Nordhaus-Modells darstellt; eine detaillierte Modellbeschreibung, einschließlich der Annahmen über Wirtschaft, Wähler und Regierung; eine kritische Würdigung des Modells mit Fokus auf allgemeine Kritikpunkte und empirische Evidenz; eine Schlussbetrachtung; und ein Literaturverzeichnis.
Was ist der Politische Konjunkturzyklus nach Nordhaus?
Der Politische Konjunkturzyklus beschreibt, wie das Eigeninteresse von Entscheidungsträgern und deren Einfluss die Wirtschaftspolitik prägen. Im Gegensatz zur traditionellen Sichtweise wohlwollender Diktatoren, die Konjunkturschwankungen glätten wollen, berücksichtigt Nordhaus' Modell das Kalkül von Politikern und deren Strategien vor Wahlen.
Welche Annahmen macht das Nordhaus-Modell?
Das Modell basiert auf Annahmen über das Zusammenspiel von Wirtschaft (Phillipskurvenkonzept), Wählerverhalten (Reaktion auf wirtschaftliche Entwicklungen) und Regierungsverhalten (politisches Kalkül der Politiker). Es wird detailliert dargestellt, wie diese Annahmen die wirtschaftspolitischen Entscheidungen beeinflussen und den Konjunkturverlauf gestalten.
Wie wird das Phillipskurvenkonzept im Modell verwendet?
Das Phillipskurvenkonzept beschreibt den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Im Nordhaus-Modell wird es verwendet, um die Auswirkungen der wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf die Wirtschaft darzustellen und die Möglichkeiten der Regierung zur Beeinflussung des Konjunkturverlaufs zu modellieren.
Welche Kritikpunkte werden an dem Nordhaus-Modell geäußert?
Die Arbeit diskutiert allgemeine Kritikpunkte, die sich auf Vereinfachungen und Annahmen des Modells beziehen. Ein wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung mit der empirischen Evidenz – wie gut werden die Vorhersagen des Modells durch reale Daten bestätigt?
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des Modells?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Politischer Konjunkturzyklus, Nordhaus-Modell, Phillipskurve, Wählerverhalten, Regierungsverhalten, Wirtschaftspolitik, Makroökonomie, Neue Politische Ökonomie, Empirische Evidenz, Konjunkturschwankungen.
- Quote paper
- Miriam Rinke (Author), 2003, Politische Konjunkturzyklen - Das Nordhaus-Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/15363