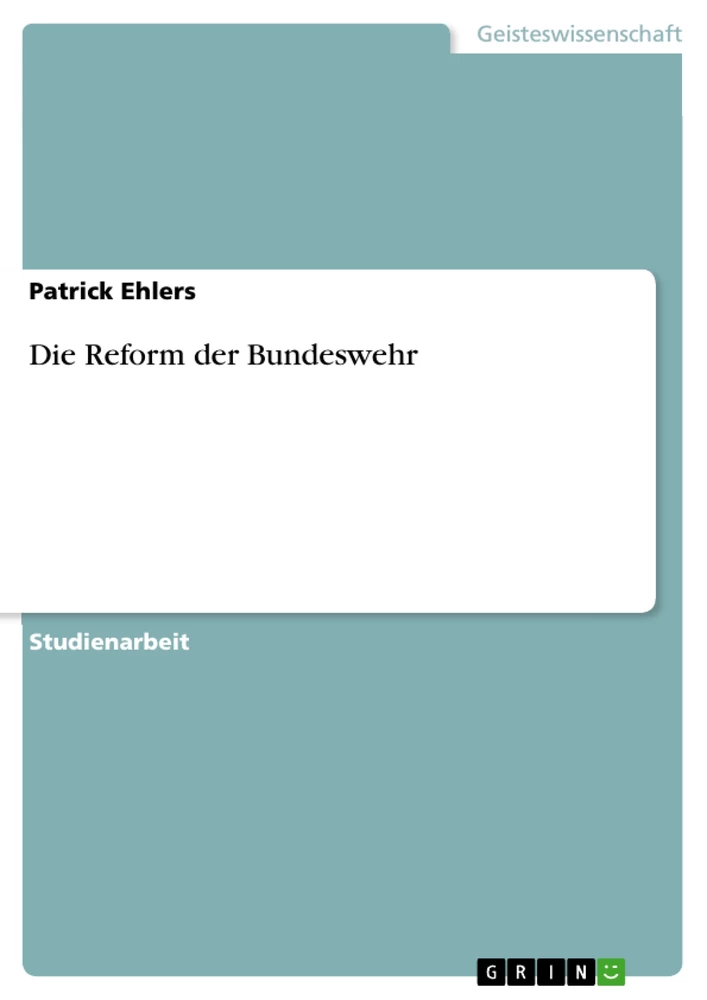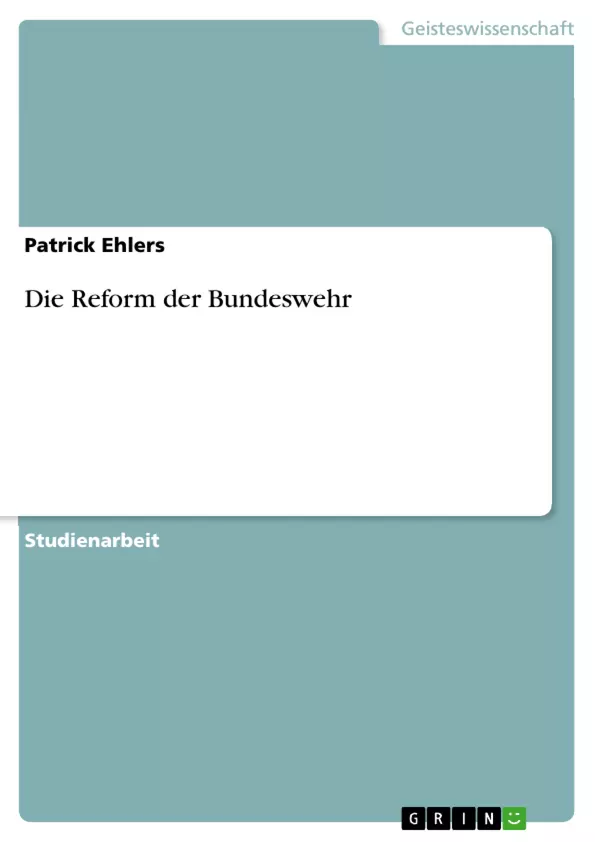Soziologie ist die Lehre von den Formen und den Gesetzen menschlichen Zusammenlebens,
insbesondere von den Beziehungen, Interdependenzen und Wirkungen von Handlungen innerhalb
einer Gruppe oder Gesellschaft. Militärsoziologie beschäftigt sich demnach mit den
Wechselwirkungen von Bundeswehr und deutscher Gesellschaft, was insbesondere bei der
Frage nach der zukünftigen Struktur der Bundeswehr in Verbindung mit der allgemeinen
Wehrpflicht, die ja Teile der Gesellschaft unmittelbar berührt, der Fall ist.
Wenn man über mögliche zukünftige Entwicklungen und Entwicklungsstränge der Bundeswehr
der Bundesrepublik Deutschland redet, sollte man kurz darauf eingehen, warum diese
Thematik seit geraumer Zeit öffentlich diskutiert wird. „Nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts, der deutschen Einigung, den vertraglichen Abmachungen über eine beträchtliche
Verringerung der deutschen Streitkräfte, der wachsenden Wehrungerechtigkeit und schlie ßlich
in der Erwartung weiter personeller Abrüstungsmaßnahmen in den kommenden Jahren
ist es ein offenes Geheimnis, dass vielerorts über eine mögliche Abschaffung der Wehrpflicht
nachgedacht wird.“1
Ein Grund hierfür kann grundsätzlich wohl im Ende des Kalten Krieges zu sehen sein. War
während des Kalten Krieges in einer klaren dichotomen Denkweise in Ost und West die Bedrohungssituation
eindeutig definiert, so war dies nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
und dem daraus resultierenden Ende des Warschauer Paktes, des so genannten Ostblocks,
nun nicht mehr möglich. Eine Reaktion auf dieses Ereignis in Form einer Änderung der
Struktur und der Erscheinung der Bundeswehr blieb lange aus, bis die latenten Defizite im
Rahmen internationaler friedenssichernder Maßnahmen mit der Zeit immer offensichtlicher
wurden.
Damit ist in erster Linie nicht die Ausstattung mit moderner und vernünftig gewarteter Militärtechnologie
gemeint – obwohl auch diese offenbar dringend reform- und erneuerungsbedürftig
wären. Vielmehr geht es um die Frage, ob man mit einer anderen Personal- und
Einsatzstruktur der Bundeswehr angemessener auf die neuen Herausforderungen reagieren
kann; ob man mit dem bundesdeutschen Modell der allgemeinen Wehrpflicht immer noch die
veränderte Form der Einsätze erfüllen kann, oder ob dieses Modell vielmehr weder zweckmäßig noch zeitgemäß ist. [...]
1Wette,Wolfram,Deutsche Erfahrungen mit der Wehrpflicht 1918–1945. Abschaffung in der Republik
und Wiedereinführung in der Diktatur, in:Foerster (Hrsg.), Die Wehrpflicht,München 1994, S.91
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Gründe für Wehrpflicht in Deutschland
- Preußen: Militärreform durch Scharnhorst
- Militär im deutschen Kaiserreich
- Aufgabe der Wehrpflicht in der Weimarer Republik auf äußeren Druck
- Die Wiederbewaffnung im westlichen Bündnis; Reformgedanke der Bundeswehr: „Bürger in Uniform“
- Der Verfassungsrahmen des Grundgesetzes
- Wehrpflicht und Grundgesetz
- Veränderte politische und militärische Rahmenbedingungen
- Ende der Ost-West-Konfrontation
- Veränderte Aufgaben der NATO
- Veränderte globale Bedrohungsszenarien (Nord-Süd-Konflikte; UNO-Einsätze; Friedenssicherung und „Nation Building“; Internationaler Terrorismus)
- Veränderte Anforderungen an eine künftige Bundeswehr
- Flexibel und hochtechnisiert
- ,,out-of-area-Einsätze“
- Aktueller Stand der Reform
- Bundeswehr im internationalen Vergleich
- Positionen der Parteien
- Kabinettsbeschluss vom 25.07.01
- Die Position der militärischen Führer
- Die Positionen der politischen Parteien
- Keine Mehrheit für eine Aufgabe der Wehrpflicht bei den Volksparteien
- Die Position der Wissenschaft und der „Weizsäcker-Kommission“
- Kommission,,Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“
- Fazit - Wehrpflicht abschaffen ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Reform der Bundeswehr und befasst sich mit der Frage, ob die Wehrpflicht beibehalten oder durch eine Berufsarmee ersetzt werden soll. Die Arbeit untersucht die historischen Gründe für die Wehrpflicht in Deutschland, die veränderten politischen und militärischen Rahmenbedingungen, die veränderten Anforderungen an eine künftige Bundeswehr und die Positionen verschiedener Akteure, darunter das Militär, politische Parteien, die Wissenschaft und die „Weizsäcker-Kommission“.
- Historische Entwicklung der Wehrpflicht in Deutschland
- Veränderte Sicherheitslage nach dem Kalten Krieg
- Anforderungen an die Bundeswehr im 21. Jahrhundert
- Politische Debatte um die Wehrpflicht
- Positionen verschiedener Akteure zur Reform der Bundeswehr
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bundeswehrreform ein und skizziert den soziologischen Kontext der Diskussion über die Wehrpflicht. Kapitel 1 beleuchtet die historischen Gründe für die Wehrpflicht in Deutschland, beginnend mit der preußischen Militärreform und der Rolle des Militärs im Deutschen Kaiserreich. Kapitel 2 setzt sich mit dem Verfassungsrahmen des Grundgesetzes auseinander und untersucht die Rolle der Wehrpflicht im Grundgesetz sowie die veränderten politischen und militärischen Rahmenbedingungen. Kapitel 3 analysiert die veränderten Anforderungen an eine künftige Bundeswehr im Hinblick auf Flexibilität, Hochtechnologie und ,,out-of-area-Einsätze“. Kapitel 4 betrachtet die Positionen der Parteien, den Kabinettsbeschluss vom 25.07.01 und die Position der militärischen Führer zur Reform der Bundeswehr.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Wehrpflicht, der Bundeswehrreform, dem Kalten Krieg, den veränderten Sicherheitsbedrohungen, der NATO, den internationalen Einsätzen der Bundeswehr, der Flexibilität und Hochtechnologie der Streitkräfte und den Positionen verschiedener Akteure im politischen Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Wehrpflicht in Deutschland so intensiv diskutiert?
Nach dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen Einigung änderten sich die Bedrohungsszenarien, was die Frage aufwarf, ob ein Massenheer noch zeitgemäß und zweckmäßig ist.
Was war das Leitbild „Bürger in Uniform“?
Es war das Reformkonzept der Bundeswehr bei ihrer Gründung, das eine enge Verflechtung von Militär und demokratischer Gesellschaft durch wehrpflichtige Soldaten sicherstellen sollte.
Welche neuen Herausforderungen gibt es für die Bundeswehr im 21. Jahrhundert?
Dazu zählen internationale friedenssichernde Einsätze (UNO/NATO), Krisenbewältigung, Nation Building und der Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
Was versteht man unter „Wehrungerechtigkeit“?
Es beschreibt die Situation, in der aufgrund sinkender Bedarfe der Bundeswehr nur noch ein kleiner Teil eines Jahrgangs tatsächlich eingezogen wurde, was als unfair gegenüber den Dienenden empfunden wurde.
Welche Empfehlungen gab die Weizsäcker-Kommission ab?
Die Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“ untersuchte Strukturen für eine flexiblere und modernisierte Armee, die den neuen globalen Anforderungen gerecht wird.
Wie standen die politischen Parteien zur Abschaffung der Wehrpflicht?
Die Arbeit zeigt, dass es lange Zeit keine Mehrheit bei den Volksparteien für eine Aufgabe der Wehrpflicht gab, während andere Akteure bereits früh für eine Berufsarmee plädierten.
- Arbeit zitieren
- Patrick Ehlers (Autor:in), 2003, Die Reform der Bundeswehr, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/15245