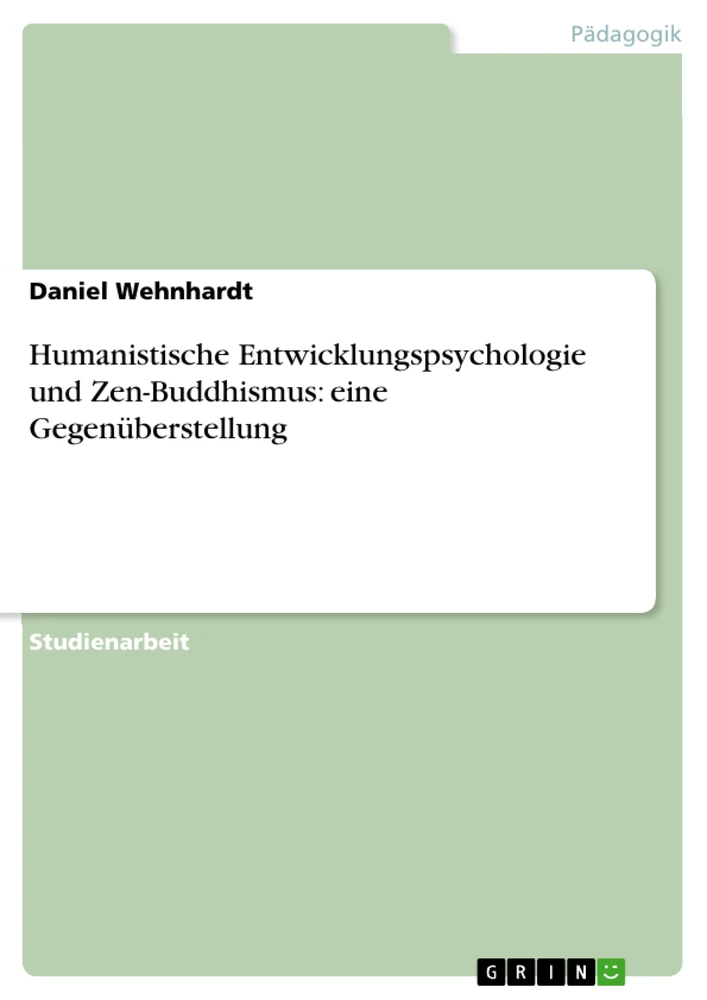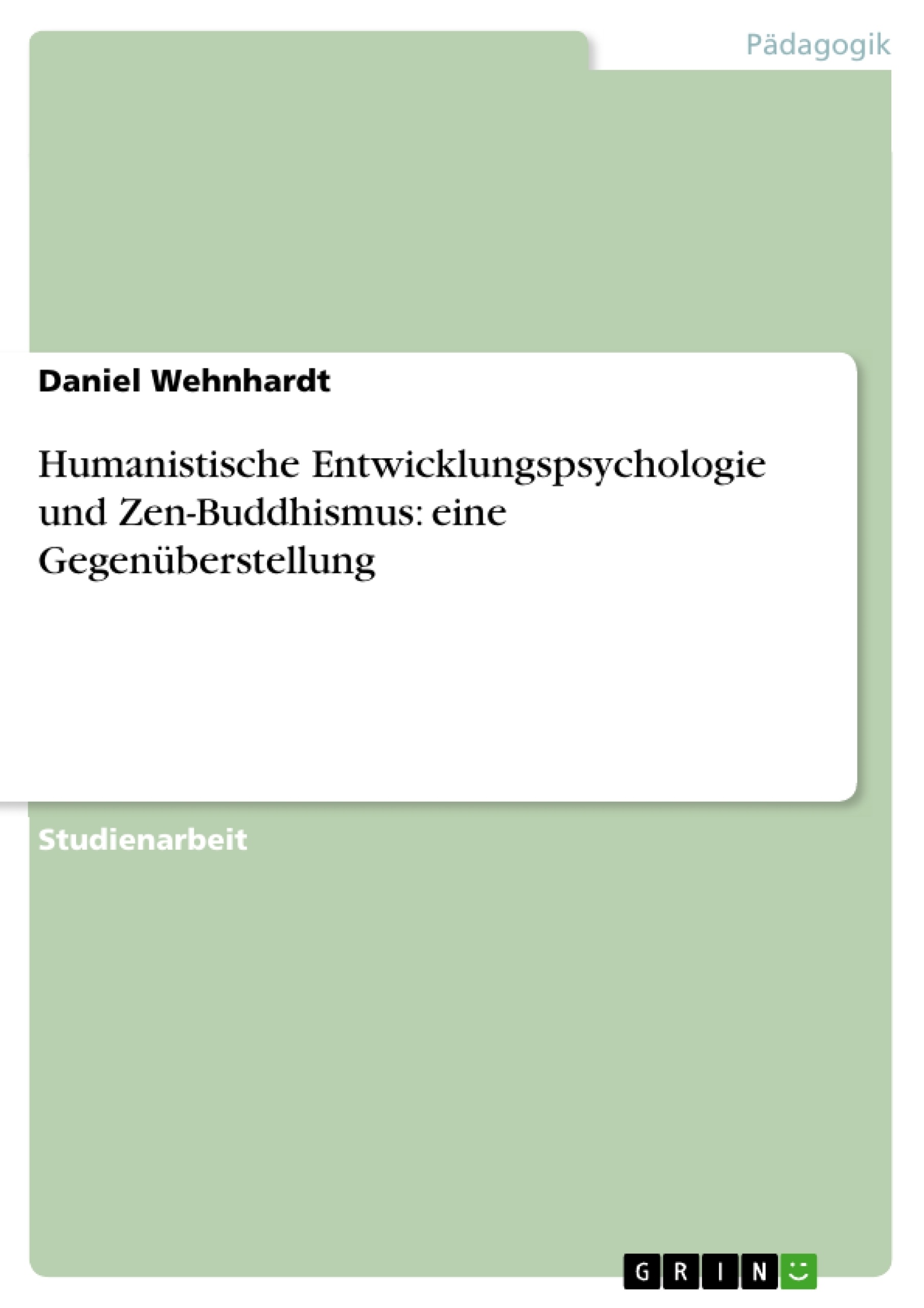Theorien, welche die menschlische Entwicklung aus psychologischer Sicht zu
beschreiben versuchen, gibt es viele. Die einen sehen das Leben eines Menschen in
mehrere Phasen der Entwicklung geteilt, während andere wiederum zum Beispiel das
ganze Leben als eine einzige Entwicklung betrachten. Es gibt eben jene Theorien, die
eher aus der psychoanalytischen Idee heraus entwachsen sind und ebenso solche
Theorien, die Entwicklung eng in einem Verbund mit dem verhaltensorientierten
Ansatz interpretieren. Als dritte Kraft sieht sich zwischen ihnen ein weiteres Modell,
das sich humanistische Entwicklungspsychologie nennt. Obwohl es die gleichen
Phänomene wie ihre „Mitspieler“ zu erklären versucht, grenzt sie sich doch ein Stück
weit von ihnen ab.
Demgegenüber entstand aus dem indischen Buddhismus eine Strömung, die sich kurz
„Zen“ nennt und ihre Wiege im feudalen Japan hat. Wenngleich es strittig ist und
bleibt, ob bei Zen-Buddhismus nun von einer Philosophie, einer Religion oder einfach
nur von einer Haltung gesprochen werden kann, liefert auch das Zen mehr oder
weniger „ungewollt“ Erklärungen und hauptsächlich Ratschläge, wie sich ein
menschliches Wesen ihrer Natur gemäß angemessen entwickeln kann, obwohl dies
absolut nicht der so genannte „Hintergedanke“ ist.
Aufgabe dieser Ausarbeitung soll es nun sein, die wissenschaftlich ausgelegte
humanistische Entwicklungspsychologie und die eher intuitive Anschauung des Zen-
Buddhismus als Weg der Selbsterfahrung gegenüberzustellen und so eventuelle
Gemeinsamkeiten oder Kontraste zu illustrieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die humanistische Entwicklungspsychologie
- Begriffsbestimmung, Geschichte und Vertreter
- Leitgedanken der humanistischen Psychologie
- Die humanistische Entwicklungstheorie
- Selbsthilfe zum Wachstum
- Zen-Buddhismus
- Begriffsbestimmung und Hintergrundgeschichte
- Leitgedanken des Zen-Buddhismus
- Gegenüberstellung / Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der humanistischen Entwicklungspsychologie und dem Zen-Buddhismus als zwei verschiedene Ansätze, die sich mit der menschlichen Entwicklung befassen. Ziel ist es, diese beiden Perspektiven gegenüberzustellen und Gemeinsamkeiten sowie Kontraste aufzuzeigen.
- Humanistische Entwicklungspsychologie: Definition, Geschichte, Vertreter und zentrale Leitgedanken
- Zentrale Konzepte der humanistischen Entwicklungstheorie: Selbstverwirklichung, Ganzheit und Subjektivität
- Wesentliche Aspekte des Zen-Buddhismus: Begriffsbestimmung, Geschichte und Leitgedanken
- Gegenüberstellung von humanistischer Entwicklungspsychologie und Zen-Buddhismus: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Selbsthilfe und Entwicklung im Kontext beider Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der menschlichen Entwicklung ein und stellt die humanistische Entwicklungspsychologie und den Zen-Buddhismus als zwei unterschiedliche Herangehensweisen vor. Kapitel 2 beleuchtet die humanistische Entwicklungspsychologie mit ihren zentralen Begriffen, ihren Begründern und ihren Leitgedanken. Hierbei werden die Themen Autonomie, Selbstverwirklichung und die Suche nach Sinn und Ziel im Leben sowie die zentrale Rolle der Ganzheit und der Subjektivität behandelt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Zen-Buddhismus. Es werden seine Grundprinzipien, seine Geschichte und seine zentrale Rolle bei der Selbstfindung und der Suche nach innerer Ruhe beleuchtet.
Schlüsselwörter
Humanistische Entwicklungspsychologie, Zen-Buddhismus, Selbstverwirklichung, Autonomie, Ganzheit, Subjektivität, innere Ruhe, Selbsterfahrung, Entwicklungspsychologie, Selbstfindung, Entwicklung, Philosophie, Religion, Lebensdeutung, Lebensgestaltung, Wachstum, Selbstorganisation, Selbstakzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen humanistischer Psychologie und Zen-Buddhismus?
Beide Ansätze betonen die menschliche Ganzheit, die Bedeutung der Subjektivität und das Streben nach Selbsterfahrung sowie persönlichem Wachstum.
Was versteht man unter „Selbstverwirklichung“ in der humanistischen Psychologie?
Es ist das angeborene Bestreben des Menschen, seine eigenen Potenziale und Fähigkeiten voll auszuschöpfen und ein autonomes, sinnvolles Leben zu führen.
Wie betrachtet der Zen-Buddhismus die menschliche Entwicklung?
Zen liefert eher intuitive Ratschläge zur Selbsterfahrung und zum Erreichen innerer Ruhe, wobei die Entwicklung der eigenen Natur gemäß im Vordergrund steht.
Welche Rolle spielt die Autonomie in diesen Konzepten?
Autonomie ist ein zentraler Leitgedanke, der besagt, dass der Mensch die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung besitzt.
Wie ergänzen sich wissenschaftliche Psychologie und intuitive Anschauung?
Während die Psychologie theoretische Modelle liefert, bietet Zen praktische Wege der Selbsterfahrung, die ähnliche Phänomene der menschlichen Reifung adressieren.
- Arbeit zitieren
- Daniel Wehnhardt (Autor:in), 2009, Humanistische Entwicklungspsychologie und Zen-Buddhismus: eine Gegenüberstellung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/152269