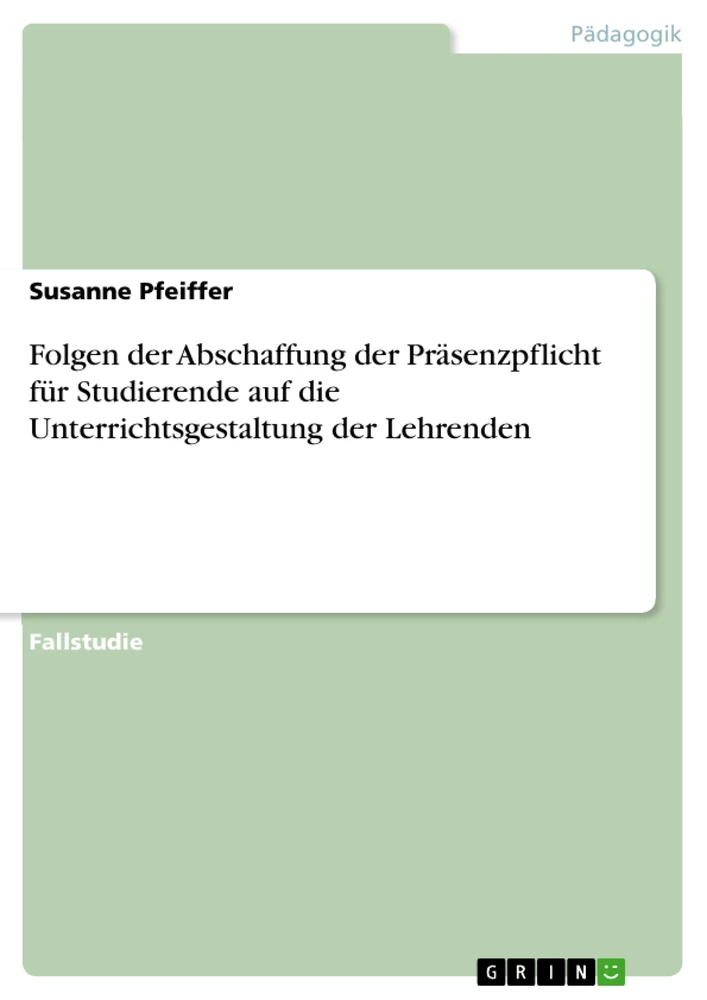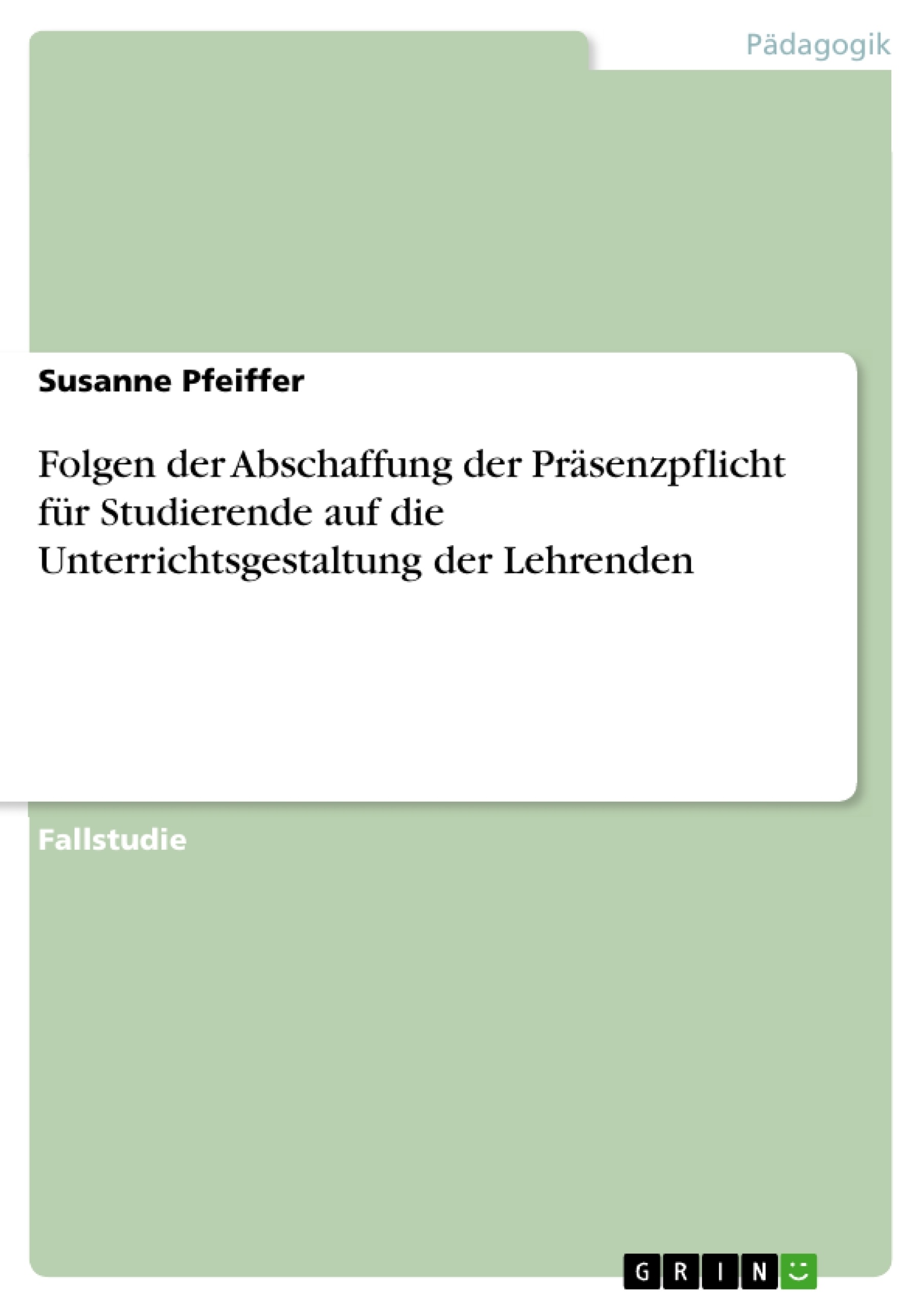Stellen Sie sich vor, der Hörsaal ist leer – oder zumindest deutlich leerer als erwartet. Was bedeutet das für die, die weiterhin lehren, forschen und Wissen vermitteln wollen? Diese Frage steht im Zentrum einer brisanten Auseinandersetzung, die sich an Hochschulen abspielt, seit die Präsenzpflicht vielerorts abgeschafft wurde. Diese Arbeit nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise hinter die Kulissen des universitären Alltags, um die oft übersehenen Auswirkungen dieser weitreichenden Entscheidung zu beleuchten. Im Fokus stehen die Erfahrungen, Herausforderungen und individuellen Strategien der Lehrenden, die sich plötzlich in einer veränderten Lehrlandschaft wiederfinden. Wie hat sich ihre Unterrichtsgestaltung gewandelt? Welche neuen didaktischen Konzepte sind entstanden, um Studierende auch ohne verpflichtende Anwesenheit zu motivieren und zu aktivieren? Welche Rolle spielen digitale Medien und innovative Lehrformate in diesem Transformationsprozess? Die Studie analysiert nicht nur die unmittelbaren Konsequenzen für die Lehrkräfte, sondern untersucht auch den tieferliegenden Zusammenhang zwischen der Abschaffung der Präsenzpflicht, der Qualität der Lehre und der Lernatmosphäre. Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser Entwicklung kritisch beleuchtet. Ziel ist es, auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse einen praxisorientierten Leitfaden zu entwickeln, der Hochschulen dabei unterstützt, einheitliche und effektive Maßnahmen zu implementieren, um den Herausforderungen der neuen Lernfreiheit zu begegnen. Die Untersuchung greift auf qualitative Forschungsmethoden zurück, um die vielschichtigen Perspektiven der Lehrenden zu erfassen und ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu zeichnen. Schlüsselwörter wie Präsenzpflicht, Online-Lehre, Hochschuldidaktik, Digitalisierung und Lernatmosphäre spiegeln die zentralen Themen wider, die in dieser Arbeit behandelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen und den Lehrevaluationen, die wichtige Eckpfeiler für die Analyse bilden. Diese Arbeit ist ein Muss für alle, die sich für die Zukunft der Hochschullehre interessieren und aktiv an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Lernkultur mitwirken wollen. Sie bietet wertvolle Einblicke, fundierte Analysen und konkrete Handlungsempfehlungen für Lehrende, Studierende, Hochschulleitungen und Bildungspolitiker. Entdecken Sie die verborgenen Dynamiken hinter der Abschaffung der Präsenzpflicht und erfahren Sie, wie Hochschulen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Abschaffung der Präsenzpflicht an einer Beispielhochschule auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrenden. Ziel ist es, die Herausforderungen, Veränderungen und individuellen Ansichten des Lehrpersonals bezüglich der Lehrveranstaltungs- und Klausurvorbereitung zu beleuchten. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für einen Leitfaden dienen, um einheitliche, unterrichtsübergreifende Maßnahmen zu ermöglichen.
- Auswirkungen der Abschaffung der Präsenzpflicht auf die Unterrichtsgestaltung.
- Herausforderungen und Veränderungen für das Lehrpersonal.
- Individuelle Ansichten und Besonderheiten der Lehrkräfte bei Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen und Klausurvorbereitung.
- Zusammenhang zwischen der Abschaffung der Präsenzpflicht und dem Wechsel von Lehrenden.
- Entwicklung eines Leitfadens für einheitliche Maßnahmen an Hochschulen.
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. Einleitung, Fallvorstellung und Zielsetzung:
- Die Einleitung beschreibt die Situation an einer Beispielhochschule, an der vor fünf Jahren die Präsenzpflicht abgeschafft wurde. Trotz unverändertem Notendurchschnitt wird die Maßnahme kontrovers diskutiert. Lehrende kritisieren die Schwierigkeit einer sinnvollen Auseinandersetzung mit den Inhalten, während Studierende eine beeinträchtigte Lernatmosphäre bemängeln. Einigkeit besteht jedoch darin, dass die Lernatmosphäre in den Vorlesungen durch die verbleibenden, interessierten Teilnehmer verbessert wurde. Die Studie untersucht die Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrenden und zielt auf einen Leitfaden für einheitliche Maßnahmen an Hochschulen ab. Die Forschungsfrage lautet: Inwiefern wirkt sich die Abschaffung der Präsenzpflicht auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrenden aus?
- 1.1 Grundlagentheoretische Einbettung:
- Dieser Abschnitt bettet die Forschungsfrage in den Kontext der zunehmenden Digitalisierung des Lernens und der damit verbundenen Herausforderungen ein. Er bezieht sich auf aktuelle Literatur, die die Bedeutung des Interesses der Lernenden und die Möglichkeiten digitaler Medien zur Gestaltung von Lernangeboten betont. Die Abschaffung der Präsenzpflicht wird als hoch relevantes Thema in Hochschulen im Kontext der fortschreitenden Technologisierung betrachtet, und es wird die Bedeutung der didaktischen Kompetenz der Lehrenden im Kontext der Lernfreiheit hervorgehoben. Die Änderung des Landeshochschulgesetzes in Nordrhein-Westfalen liefert einen weiteren wichtigen Kontext für die Forschungsfrage.
- 1.2 Methodologische Positionierung:
- Da bereits quantitative Daten (Durchschnittsnoten, Lehrevaluationen) vorliegen, wird hier die Notwendigkeit einer qualitativen Forschungsmethode begründet. Qualitative Forschung ermöglicht die Erfassung der individuellen Herausforderungen der Lehrkräfte, die mit quantitativen Methoden nicht erfassbar wären. Der Abschnitt betont den Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung und erklärt, warum eine qualitative Herangehensweise in diesem Fall angemessen ist, um tiefliegende Zusammenhänge zu erfassen, anstatt lediglich statistische Häufigkeiten.
- 2. Design und Umsetzung des Forschungsvorhabens:
- Dieses Kapitel beschreibt das Design der Studie, die auf Interviews mit Lehrenden basiert. Die Auswahl der Interviewpartner wird erläutert: Es sollen Lehrende befragt werden, die sowohl in Präsenz als auch im Online-Unterricht Erfahrungen gesammelt haben (mindestens 10 Jahre Erfahrung an der Hochschule). Der Aspekt der theoretischen Sättigung nach Lamnek (2005) wird erwähnt, um die Anzahl der benötigten Interviews zu bestimmen. Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Interviewpartnern, etwa aufgrund negativer Lehrevaluationen, werden angesprochen.
Schlüsselwörter
- Präsenzpflicht
- Online-Lehre
- Hochschuldidaktik
- Qualitative Forschung
- Unterrichtsgestaltung
- Lehrkräfte
- Herausforderungen
- Digitalisierung
- Lernatmosphäre
- Lehrevaluation
- Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Sprachevorschau?
Diese Sprachevorschau bietet einen umfassenden Überblick über eine akademische Arbeit. Sie enthält das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die Hauptpunkte des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in fünf Hauptpunkte: Einleitung, Fallvorstellung und Zielsetzung; Design und Umsetzung des Forschungsvorhabens; Erstellung und Durchführung eines Erhebungsinstrumentes; Auswahl und Durchführung des Auswertungsverfahrens; sowie Zusammenfassung, Fazit und Ausblick.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen der Abschaffung der Präsenzpflicht an einer Beispielhochschule auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrenden zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für einen Leitfaden für einheitliche, unterrichtsübergreifende Maßnahmen dienen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen Auswirkungen der Abschaffung der Präsenzpflicht, Herausforderungen für das Lehrpersonal, individuelle Ansichten der Lehrkräfte, Zusammenhang zwischen Abschaffung und Wechsel von Lehrenden sowie die Entwicklung eines Leitfadens für einheitliche Maßnahmen.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Situation an einer Beispielhochschule, an der die Präsenzpflicht abgeschafft wurde. Sie beleuchtet die kontroversen Diskussionen, die Schwierigkeiten der Lehrenden und die beeinträchtigte Lernatmosphäre.
Wie wird die Forschungsfrage theoretisch eingebettet?
Die Forschungsfrage wird in den Kontext der Digitalisierung des Lernens und der damit verbundenen Herausforderungen eingebettet. Es wird auf die Bedeutung des Interesses der Lernenden und die Möglichkeiten digitaler Medien Bezug genommen.
Warum wird eine qualitative Forschungsmethode gewählt?
Eine qualitative Forschungsmethode wird gewählt, um die individuellen Herausforderungen der Lehrkräfte zu erfassen, die mit quantitativen Methoden nicht erfassbar wären. Sie ermöglicht das Erfassen tiefliegender Zusammenhänge.
Wie ist das Design der Studie?
Das Design der Studie basiert auf Interviews mit Lehrenden, die sowohl in Präsenz als auch im Online-Unterricht Erfahrungen gesammelt haben (mindestens 10 Jahre Erfahrung an der Hochschule). Es wird auf die theoretische Sättigung nach Lamnek (2005) Bezug genommen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind Präsenzpflicht, Online-Lehre, Hochschuldidaktik, Qualitative Forschung, Unterrichtsgestaltung, Lehrkräfte, Herausforderungen, Digitalisierung, Lernatmosphäre, Lehrevaluation, Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen.
- Quote paper
- Susanne Pfeiffer (Author), 2023, Folgen der Abschaffung der Präsenzpflicht für Studierende auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1522674