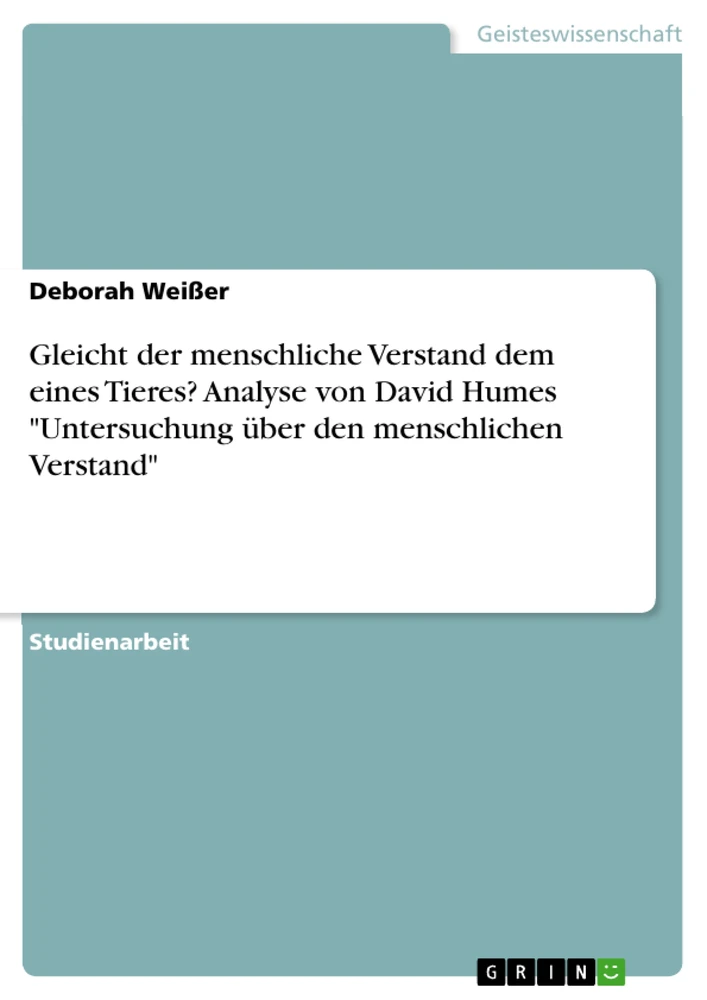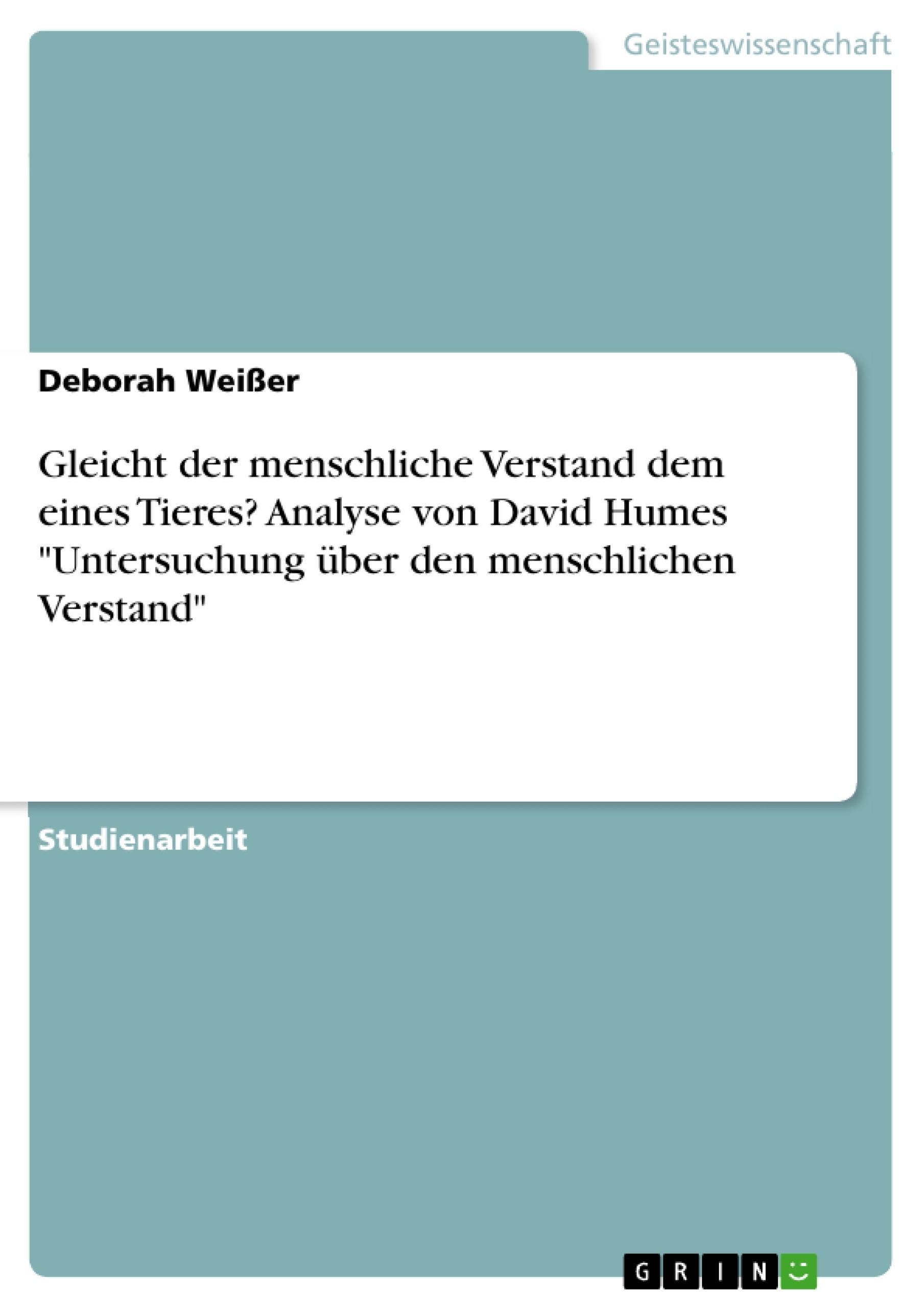Während René Descartes (1596-1650) den Menschen klar von den Tieren trennt und letztere sogar durch den Substanzendualismus als maschinenähnlich erscheinen lässt, postuliert nun David Hume (1711-1776), dass das Prinzip, durch welches alles Wissen über erfahrbare Gegenstände angeeignet wird, bei Menschen sowie Tieren das gleiche ist. Mit der Annäherung der Menschenwelt an die Tierwelt, ähnelt Hume bereits Charles Darwin (1809-1882). Doch durch welches theoretische Gerüst wird diese Hume'sche These gestützt? Das wird die zu behandelnde Frage der vorliegenden Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textdarstellung
- 2.1 Zusammenfassung der Abschnitte I bis VIII
- 2.2 Rekonstruktion des neunten Abschnitts
- 2.3 Einordnung des Textes in einen wissenschaftlichen Ansatz
- 3. Diskussion
- 3.1 Das Vermögen des Verstandes
- 3.2 Diskussion des neunten Abschnitts
- 3.3 Zusammenführung der Argumentationsschritte
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht David Humes These, dass das Prinzip des Wissensgewinns über erfahrbare Gegenstände bei Menschen und Tieren gleich ist. Ziel ist es, Humes Argumentation in seiner "Untersuchung über den menschlichen Verstand", insbesondere im neunten Abschnitt, zu rekonstruieren, zu analysieren und in einen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen. Die Arbeit verbindet Textdarstellung mit Diskussion und analysiert die Argumentationsstränge, um zu einer weiterführenden Interpretation zu gelangen.
- Vergleich des menschlichen und tierischen Verstandes nach Hume
- Analyse von Humes Erkenntnistheorie und seiner Kritik an der Metaphysik
- Die Rolle von Erfahrung, Gewohnheit und Analogie im Erkenntnisprozess
- Untersuchung der Grenzen des menschlichen Verstandes
- Einordnung von Humes Argumentation in einen wissenschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gemeinsamkeit des Wissensgewinns bei Mensch und Tier nach Hume gegenüber der traditionellen Trennung von Mensch und Tier, wie sie beispielsweise bei Descartes zu finden ist. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit: eine Darstellung der Abschnitte I-IX von Humes Werk, mit Schwerpunkt auf dem neunten Abschnitt, gefolgt von einer kommentierenden Diskussion und Einordnung in einen wissenschaftlichen Kontext. Die verwendeten Textausgaben werden genannt.
2. Textdarstellung: Dieses Kapitel fasst zunächst Humes zentrale Thesen bis zum neunten Abschnitt zusammen. Es wird die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen, die Prinzipien der Verknüpfung von Vorstellungen (Ähnlichkeit, Raum-Zeit, Ursache-Wirkung), und die Unterscheidung zwischen Relationsurteilen und Tatsachenurteilen erläutert. Die Bedeutung der Gewohnheit für den Glauben und die Wahrscheinlichkeit wird herausgestellt. Die Grenzen der menschlichen Freiheit und die Abhängigkeit von äußeren Umständen werden ebenfalls angesprochen. Schließlich wird der neunte Abschnitt detailliert rekonstruiert.
2.1 Zusammenfassung der Abschnitte I bis VIII: Diese Zusammenfassung erläutert Humes Kritik an falscher Metaphysik und sein wissenschaftstheoretisches Anliegen, die Grenzen des Verstandes zu untersuchen. Sie beschreibt die Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen, die Prinzipien der Assoziation von Ideen und die Rolle der Gewohnheit bei der Bildung von Glaubensvorstellungen. Die Kapitel fassen die Kernaussagen zu Ursache und Wirkung und der Wahrscheinlichkeit zusammen. Auch die Problematik der menschlichen Freiheit wird angerissen.
2.2 Rekonstruktion des neunten Abschnitts: Die Rekonstruktion des neunten Abschnitts konzentriert sich auf Humes These, dass alle Urteile über Tatsachen auf Analogieschlüssen beruhen. Es werden Humes Beispiele für perfekte und unvollkommene Analogien diskutiert und seine Argumentation dafür, dass dieses Prinzip sowohl für Menschen als auch für Tiere gilt, detailliert dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beweisführung, dass das Schließen von Ursache auf Wirkung nicht auf Vernunft, sondern auf Instinkt und Gewohnheit beruht.
3. Diskussion: Die Diskussion verknüpft die Ergebnisse der Textdarstellung und analysiert Humes Argumentation umfassend. Sie vertieft die Analyse der zentralen Begriffe und Konzepte und bewertet die Stärke und Schwächen der Argumentation. Zusammenfassend wird die Argumentation zu einer weiterführenden Interpretation zusammengeführt.
Schlüsselwörter
David Hume, Untersuchung über den menschlichen Verstand, Erkenntnistheorie, Empirismus, Verstand, Erfahrung, Gewohnheit, Analogie, Ursache und Wirkung, Glaube, Tier, Mensch, Instinkt, Freiheit, Wissenschaftstheorie, Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen zur David Humes "Untersuchung über den menschlichen Verstand" Analyse
Worum geht es in dieser Analyse von David Humes "Untersuchung über den menschlichen Verstand"?
Diese Analyse untersucht David Humes These, dass das Prinzip des Wissensgewinns über erfahrbare Gegenstände bei Menschen und Tieren gleich ist. Sie zielt darauf ab, Humes Argumentation in seiner "Untersuchung über den menschlichen Verstand", insbesondere im neunten Abschnitt, zu rekonstruieren, zu analysieren und in einen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen den Vergleich des menschlichen und tierischen Verstandes nach Hume, die Analyse von Humes Erkenntnistheorie und seiner Kritik an der Metaphysik, die Rolle von Erfahrung, Gewohnheit und Analogie im Erkenntnisprozess, die Untersuchung der Grenzen des menschlichen Verstandes sowie die Einordnung von Humes Argumentation in einen wissenschaftlichen Kontext.
Wie ist die Analyse aufgebaut?
Die Analyse ist in vier Hauptkapitel unterteilt: Einleitung, Textdarstellung, Diskussion und Schluss. Die Textdarstellung fasst Humes zentrale Thesen zusammen und rekonstruiert den neunten Abschnitt detailliert. Die Diskussion verknüpft die Ergebnisse der Textdarstellung und analysiert Humes Argumentation umfassend.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gemeinsamkeit des Wissensgewinns bei Mensch und Tier nach Hume gegenüber der traditionellen Trennung von Mensch und Tier dar. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Was beinhaltet die Textdarstellung?
Die Textdarstellung fasst Humes zentrale Thesen bis zum neunten Abschnitt zusammen, einschliesslich der Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen, den Prinzipien der Verknüpfung von Vorstellungen, und der Unterscheidung zwischen Relationsurteilen und Tatsachenurteilen. Die Bedeutung der Gewohnheit für den Glauben und die Wahrscheinlichkeit wird herausgestellt. Der neunte Abschnitt wird detailliert rekonstruiert.
Was ist der Fokus der Rekonstruktion des neunten Abschnitts?
Die Rekonstruktion des neunten Abschnitts konzentriert sich auf Humes These, dass alle Urteile über Tatsachen auf Analogieschlüssen beruhen. Es werden Humes Beispiele für perfekte und unvollkommene Analogien diskutiert und seine Argumentation dafür, dass dieses Prinzip sowohl für Menschen als auch für Tiere gilt, detailliert dargestellt.
Was beinhaltet die Diskussion?
Die Diskussion verknüpft die Ergebnisse der Textdarstellung und analysiert Humes Argumentation umfassend. Sie vertieft die Analyse der zentralen Begriffe und Konzepte und bewertet die Stärke und Schwächen der Argumentation.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Analyse?
Relevante Schlüsselwörter sind David Hume, Untersuchung über den menschlichen Verstand, Erkenntnistheorie, Empirismus, Verstand, Erfahrung, Gewohnheit, Analogie, Ursache und Wirkung, Glaube, Tier, Mensch, Instinkt, Freiheit, Wissenschaftstheorie, Metaphysik.
- Arbeit zitieren
- Deborah Weißer (Autor:in), 2011, Gleicht der menschliche Verstand dem eines Tieres? Analyse von David Humes "Untersuchung über den menschlichen Verstand", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1520127