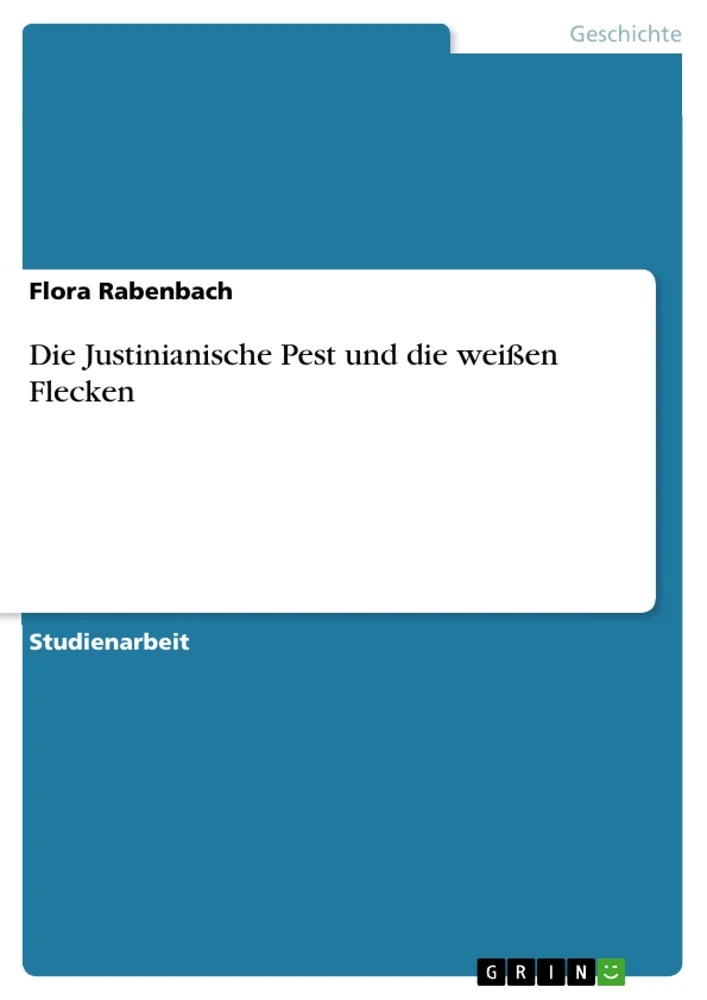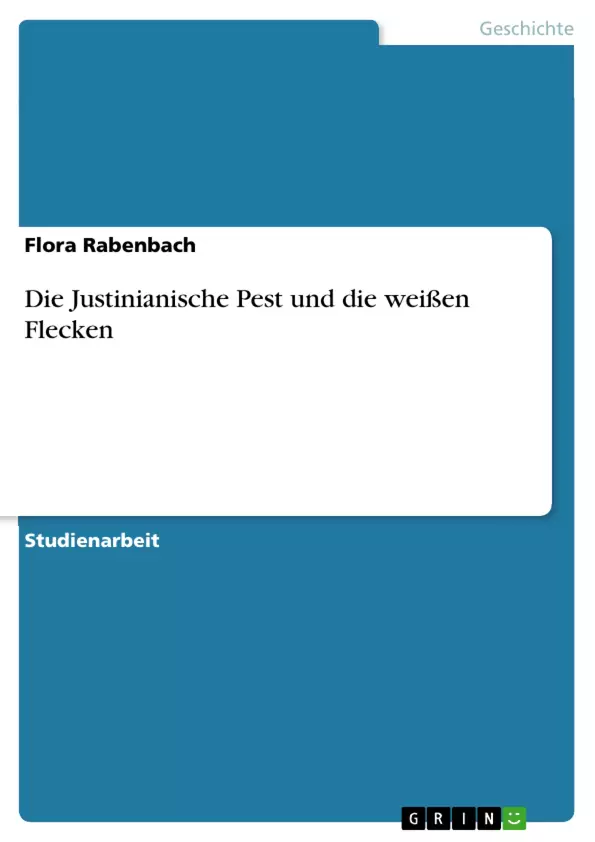Die Arbeit untersucht die sogenannte Justinianische Pest (541–750 n. Chr.) mit einem Fokus auf „weiße Flecken“, d. h. Orte, die von der Pandemie verschont blieben. Durch eine Analyse historischer Quellen wie Prokop, Johannes von Ephesos und anderen wird hinterfragt, ob und warum solche pestfreien Regionen existierten und wie sie in der modernen Forschung, insbesondere durch Paläogenetik, überprüft werden können. Dabei werden unterschiedliche historische Perspektiven (Maximalismus vs. Minimalismus) sowie deren politische und religiöse Konnotationen beleuchtet. Die Untersuchung zeigt, dass „weiße Flecken“ eher ein literarisches als ein empirisch belegbares Phänomen darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Perspektivität in der Geschichte
- „Weiße Flecken“ in den literarischen Quellen
- Die Perserkriege bei Prokop
- Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesos
- Die Weltchronik des Johannes Malalas
- Die Kirchengeschichte von Evagrius Scholasticus
- Ein Quellenvergleich zwischen Prokop und Johannes von Ephesos
- Ein Abgleich mit der modernen Forschung
- Zusammenführende Ergebnisse
- Eine Bewertung Prokops
- Die weißen Flecken als Nährboden für weitere Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die „weißen Flecken“, also Orte ohne Pestbefall, während der Justinianischen Pest (541-558 n. Chr.) im oströmischen Reich. Ziel ist die Klärung der Frage nach dem tatsächlichen Auftreten solcher Flecken, ihrer Lage, der Berichterstattung und möglichen Erklärungen. Die Quellenlage ist dürftig, daher wird ein hermeneutischer Ansatz mit Quellenvergleich und Einbezug moderner Forschung (Paläogenetik) gewählt.
- Analyse der Berichterstattung über die Pest in ausgewählten spätantiken Quellen.
- Identifizierung potentieller „weißer Flecken“ anhand literarischer Quellen.
- Vergleich der Quellenbefunde mit Erkenntnissen der modernen Paläogenetik.
- Untersuchung unterschiedlicher Perspektiven auf das Phänomen der Pest.
- Bewertung der Aussagekraft der Quellen zur Frage nach „weißen Flecken“.
Zusammenfassung der Kapitel
Perspektivität in der Geschichte: Der einleitende Abschnitt vergleicht die Wahrnehmung der Justinianischen Pest mit der aktuellen Covid-19-Pandemie und verdeutlicht die Perspektivität in der Geschichtsbetrachtung. Er führt in das Thema der „weißen Flecken“ ein – Orte, an denen die Pest nicht ausbrach – und definiert den Fokus der Arbeit auf das oströmische Reich während der ersten beiden Pestwellen (541-558 n. Chr.). Die methodische Vorgehensweise, basierend auf einem hermeneutischen Ansatz und dem Vergleich verschiedener Quellen wie Prokop und Johannes von Ephesos, wird erläutert. Die Herausforderungen einer unzureichenden Quellenlage und des Forschungsstandes werden angesprochen.
„Weiße Flecken“ in den literarischen Quellen: Dieses Kapitel analysiert die Quellenlage zu den „weißen Flecken“ der Pest. Es beginnt mit einer Untersuchung der Perserkriege von Prokop, wobei festgestellt wird, dass Prokop keine pestfreien Orte erwähnt, sondern die Pest als allgegenwärtig beschreibt. Die Analyse der Kirchengeschichte des Johannes von Ephesos führt zu einem ähnlichen Ergebnis: Die Pest wird als weitverbreitetes Phänomen dargestellt. Der Abschnitt legt die Schwierigkeit dar, in den bestehenden Quellen eindeutige Belege für „weiße Flecken“ zu finden, obwohl einige Anekdoten Hinweise auf potenzielle Erklärungen liefern könnten (z.B. die vermeintliche Schutzwirkung des Feuerheiligtums in Adarbiganon).
Schlüsselwörter
Justinianische Pest, „weiße Flecken“, Quellenkritik, Prokop, Johannes von Ephesos, Paläogenetik, Spätantike, Oströmisches Reich, Perspektivität, Geschichtswissenschaft, Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Themenschwerpunkte der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die „weißen Flecken“, also Orte ohne Pestbefall, während der Justinianischen Pest (541-558 n. Chr.) im oströmischen Reich. Ziel ist es, das tatsächliche Auftreten solcher Flecken, ihre Lage, die Berichterstattung darüber und mögliche Erklärungen zu klären. Es werden die Berichterstattung über die Pest analysiert, potentielle „weiße Flecken“ anhand literarischer Quellen identifiziert, Quellenbefunde mit der modernen Paläogenetik verglichen, unterschiedliche Perspektiven auf die Pest untersucht und die Aussagekraft der Quellen bewertet.
Welche Quellen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Quellen, darunter die Werke von Prokop (Perserkriege), Johannes von Ephesos (Kirchengeschichte), Johannes Malalas (Weltchronik) und Evagrius Scholasticus (Kirchengeschichte). Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Berichte von Prokop und Johannes von Ephesos.
Was ist die methodische Vorgehensweise?
Die Arbeit basiert auf einem hermeneutischen Ansatz, der Quellenvergleich und den Einbezug moderner Forschung (insbesondere Paläogenetik) kombiniert. Die Herausforderungen einer unzureichenden Quellenlage und des Forschungsstandes werden berücksichtigt.
Was wird unter "weißen Flecken" verstanden?
Unter "weißen Flecken" werden Orte verstanden, an denen die Justinianische Pest (541-558 n. Chr.) im oströmischen Reich nicht ausbrach.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse der literarischen Quellen?
Die Analyse der Quellen von Prokop und Johannes von Ephesos zeigt, dass die Pest als weitverbreitetes Phänomen dargestellt wird. Eindeutige Belege für "weiße Flecken" sind in den Quellen schwer zu finden, obwohl einige Anekdoten Hinweise auf mögliche Erklärungen liefern könnten.
Welche Schlüsselwörter sind für die Arbeit relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Justinianische Pest, „weiße Flecken“, Quellenkritik, Prokop, Johannes von Ephesos, Paläogenetik, Spätantike, Oströmisches Reich, Perspektivität, Geschichtswissenschaft und Hermeneutik.
Welche Perspektivität wird in der Geschichtsbetrachtung verdeutlicht?
Der einleitende Abschnitt vergleicht die Wahrnehmung der Justinianischen Pest mit der aktuellen Covid-19-Pandemie und verdeutlicht so, wie die Perspektive die Geschichtsbetrachtung beeinflusst. Dies dient zur Einführung in das Thema der "weißen Flecken".
- Arbeit zitieren
- Flora Rabenbach (Autor:in), 2021, Die Justinianische Pest und die weißen Flecken, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1520020