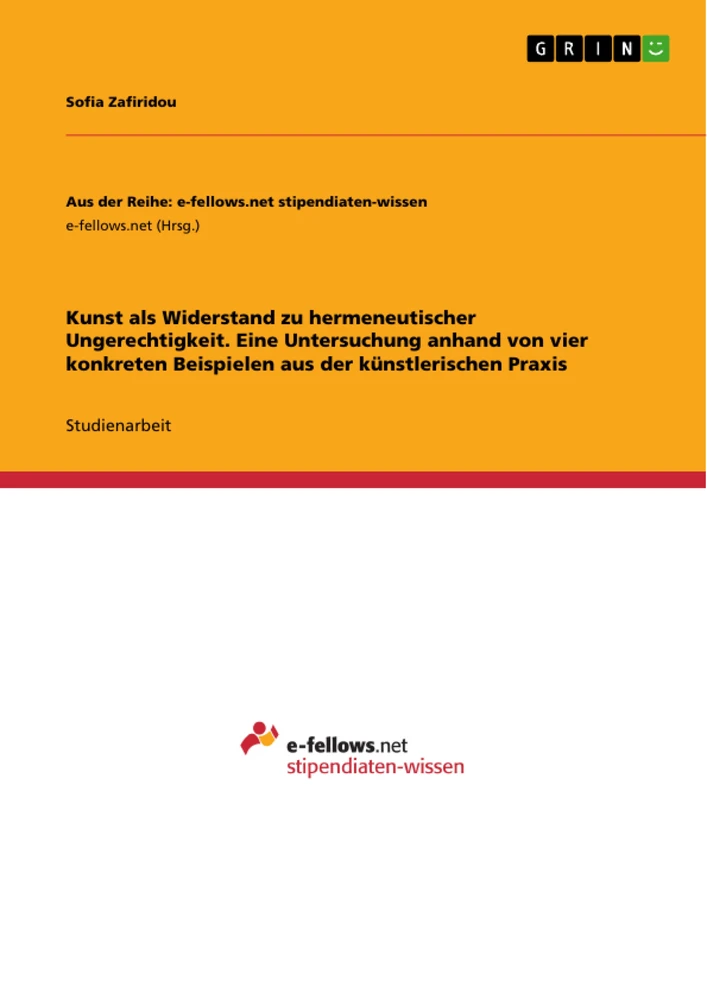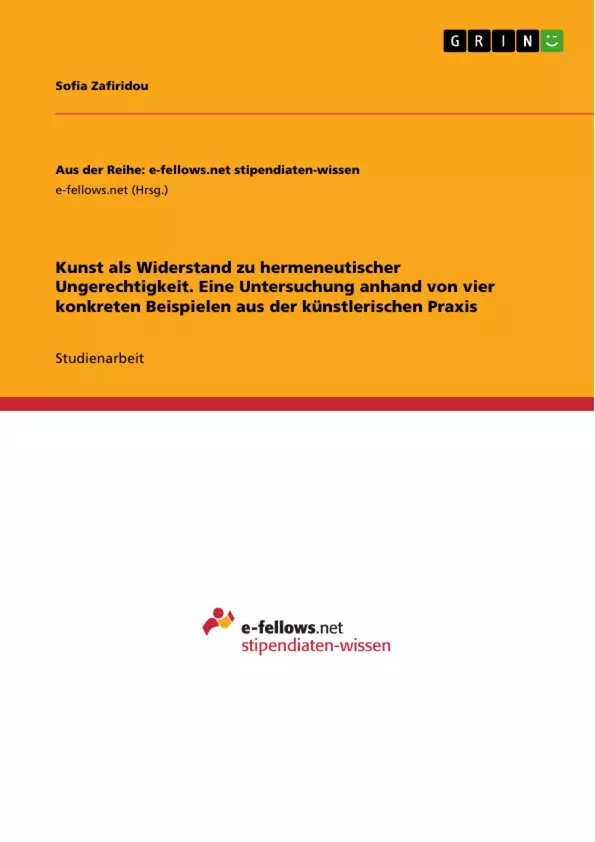Die folgende Arbeit setzt sich mit dem Werk "Epistemische Ungerechtigkeit – Macht und die Ethik des Wissens" (2023) von Miranda Fricker auseinander, welches einen wichtigen Beitrag zur sozialen Erkenntnistheorie darstellt. Es geht um eine lange unbemerkt gebliebene, spezifische Art von Ungerechtigkeit, die Fricker als „epistemische Ungerechtigkeit“ bezeichnet. Fricker unterscheidet zwei Formen dieser Ungerechtigkeit. Die erste Form, die „Zeugnisungerechtigkeit“, tritt auf, wenn einem Subjekt, das eine Zeugenaussage tätigt, aufgrund negativer Identitätsvorurteile fälschlicherweise eine geringere oder gar keine Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Fricker deckt mit der zweiten Form der epistemischen Ungerechtigkeit, der „hermeneutischen Ungerechtigkeit“ (von nun an als „hU“ abgekürzt) auf, dass die vorhandenen, teilweise verzerrten Wissensbestände und Deutungsressourcen – und ganz besonders das spezifische Nichtvorhandensein dieser – in unserer Gesellschaft als Ergebnisse von strukturellen Machtungleichheitsverhältnissen untersucht werden müssen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf ihrem Konzept der hU; anhand Frickers Definition von hU, die sie mithilfe mehrerer Beispiele erstellt, sollen alternative Möglichkeiten zu der von ihr vorgeschlagenen Tugend der hermeneutischen Gerechtigkeit als Beitrag zur Beseitigung einer hU entwickelt werden. Dabei steht die Frage im Zentrum, inwiefern zeitgenössische bildende und performative Kunst diese alternativen Möglichkeiten bedienen kann. Hierzu wird konkret nach entsprechenden Beispielen aus der künstlerischen Praxis gesucht, und untersucht, inwiefern diese als Medien zur Beseitigung von hU fungieren. Dabei werden ausschließlich Beispiele aus der Kunst angeführt, die hermeneutisch Marginalisierte als epistemische Akteur*innen berücksichtigt und ihnen im Sinne der Selbstermächtigung und des Widerstands als Medium zu mehr epistemischer Handlungsfähigkeit dient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frickers drei Beispiele hermeneutischer Ungerechtigkeit
- Kollektiver epistemischer Widerstand und die Rolle der hermeneutisch Marginalisierten
- Kunst als Ort und Medium für epistemischen Widerstand
- Die Bekämpfung von hermeneutischer Ungerechtigkeit
- Die Tugend der hermeneutischen Gerechtigkeit
- Mögliche Ansatzstellen zur Bekämpfung von hU und Herangehensweisen aus der künstlerischen Praxis
- Kunst zur unmittelbaren Förderung der Tugend der hermeneutischen Gerechtigkeit
- Kunst gegen vorurteilsbehaftete Stereotype und deren Eingriff in das Selbstbild
- Kunst zur Identifizierung und Schließung einer hermeneutischen Lücke
- Kunst zur gesellschaftlichen Verbreitung eines bestimmten Phänomens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der hermeneutischen Ungerechtigkeit nach Miranda Fricker und erörtert, wie zeitgenössische Kunst als Mittel zur Bekämpfung dieser Ungerechtigkeit dienen kann. Der Fokus liegt auf der Analyse künstlerischer Praktiken, die hermeneutisch marginalisierte Gruppen als epistemische Akteur*innen in den Mittelpunkt stellen und ihnen zu mehr epistemischer Handlungsfähigkeit verhelfen.
- Hermeneutische Ungerechtigkeit nach Fricker
- Künstlerischer Widerstand gegen hermeneutische Ungerechtigkeit
- Die Rolle hermeneutisch marginalisierter Gruppen in der Kunst
- Alternative Strategien zur Bekämpfung hermeneutischer Ungerechtigkeit
- Analyse konkreter Beispiele aus der künstlerischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung führt in das Thema der epistemischen Ungerechtigkeit nach Miranda Fricker ein und fokussiert auf das Konzept der hermeneutischen Ungerechtigkeit (hU). Die Arbeit untersucht Möglichkeiten, die über Frickers vorgeschlagene Tugend der hermeneutischen Gerechtigkeit hinausgehen, und analysiert, wie zeitgenössische Kunst dazu beitragen kann, hU zu beseitigen.
Kapitel 2 (Frickers drei Beispiele hermeneutischer Ungerechtigkeit): Dieses Kapitel präsentiert drei Beispiele aus Frickers Werk, die verschiedene Facetten hermeneutischer Ungerechtigkeit veranschaulichen: den Fall von Carmita Wood (sexuelle Belästigung), die Erfahrung von E. White (falsche hermeneutische Rahmung von Homosexualität) und den Fall von Wendy Stanford (postnatale Depression). Diese Beispiele illustrieren, wie gesellschaftliche Machtstrukturen zu einer Verzerrung des Verständnisses sozialer Erfahrungen führen können.
Kapitel 3 (Kollektiver epistemischer Widerstand und die Rolle der hermeneutisch Marginalisierten): (Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext)
Kapitel 4 (Kunst als Ort und Medium für epistemischen Widerstand): (Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext)
Kapitel 5 (Die Bekämpfung von hermeneutischer Ungerechtigkeit): Dieses Kapitel beginnt mit einer Erörterung der Tugend der hermeneutischen Gerechtigkeit. Es untersucht anschließend verschiedene Ansatzpunkte, wie Kunst zur Bekämpfung von hU beitragen kann, und skizziert vier mögliche Strategien: die direkte Förderung der hermeneutischen Gerechtigkeit, die Auseinandersetzung mit vorurteilsbehafteten Stereotypen, die Identifizierung und Schließung hermeneutischer Lücken, sowie die gesellschaftliche Verbreitung bestimmter Phänomene.
Schlüsselwörter
Hermeneutische Ungerechtigkeit, epistemische Ungerechtigkeit, künstlerischer Widerstand, epistemischer Widerstand, hermeneutische Marginalisierung, Identitätsvorurteile, soziale Gerechtigkeit, zeitgenössische Kunst, bildende Kunst, performative Kunst, Selbstermächtigung.
- Arbeit zitieren
- 1. Staatsexamen Sofia Zafiridou (Autor:in), 2023, Kunst als Widerstand zu hermeneutischer Ungerechtigkeit. Eine Untersuchung anhand von vier konkreten Beispielen aus der künstlerischen Praxis, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1507449