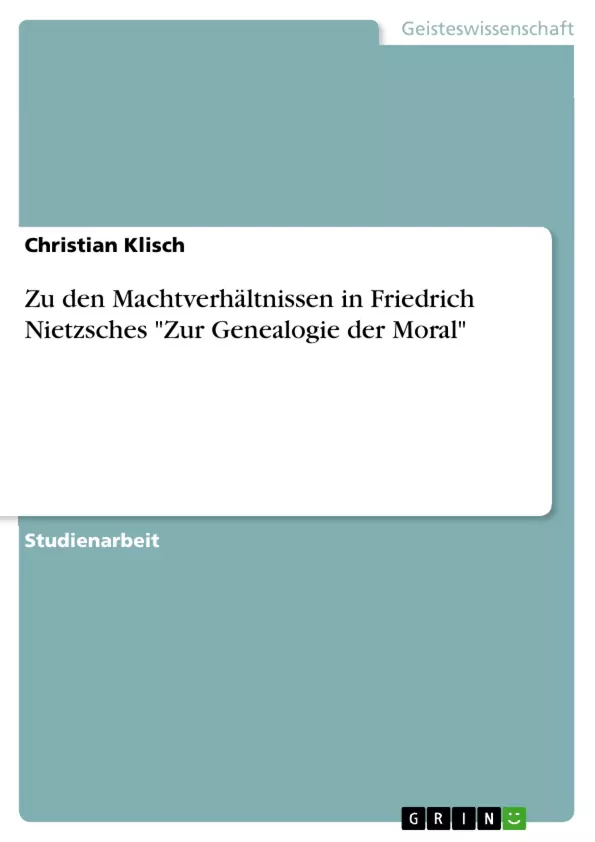Diese Seminararbeit untersucht die Machtverhältnisse in der Genealogie der Moral Friedrich Nietzsches. Der Aspekt der Macht zeigt sich in verschiedenen Qualitäten wie individueller Fähigkeit, politischer Kontrolle, brutaler Überwältigung, ästhetischer Schöpferkraft, Durchsetzungsvermögen und Perspektivenreichtum. Daher werden in der Arbeit Nietzsches Gedanken zu Themen wie der Rolle des Priesters, dem Ressentiment, Idealen, Schuld und Sühne sowie dem Aristokratischen analysiert und veranschaulicht. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und Nietzsches Werk sowie seine Persönlichkeit reflektiert.
Inhalt
Einleitung
Der Priester
Das Ressentiment
Die Ideale
Schuld und Strafe
Die Strafe
Die Schuld
Vornehme versus Unvornehme, Starke versus Schwache
Abschließende Bemerkungen
Literaturverzeichnis
Einleitung:
Bei der vorliegenden Seminararbeit steht der Inhalt des gesamten Buches „Zur Genealogie der Moral“ von Friedrich Nietzsche im Vordergrund. Die Arbeit stützt sich vor allem auf die wissenschaftlichen Interpretationen von Stegmeier, Raffnsoe, Safranski, und auf den von Höffe herausgegebenen Sammelband. Natürlich lasse ich auch Nietzsche selber immer wieder ausreichend im Original zu Wort kommen. Das Ziel der Arbeit ist es, die Machtverhältnisse, die Nietzsche in der GdM beschreibt, möglichst genau zu veranschaulichen. Dennoch tue ich mir selber schwer damit, den Begriff der Macht bei Nietzsche einheitlich zu definieren. Er schillert zwischen individueller Fähigkeit und politischer Kontrolle, brutaler Überwältigung und ästhetischer Schöpferkraft, Durchsetzungsfähigkeit und Perspektivenreichtum, um nur Wesentliches zu nennen. [1] Beim Lesen wird direkt oder indirekt hervortreten, was Nietzsches eigener Ansatz einer Moral sein könnte, ohne dass ich groß wertend Stellung dazu nehme.
Der Priester:
Der soziale Träger der Übernahme der Macht durch die Moral sei die priesterliche Kaste (v.a. der Juden). Das Judentum steht am Anfang der abendländisch christlichen Moral, um die es ihm allein geht. Dabei wird offengelassen, wie denn nun genau die Priesterkaste die Macht überhaupt von der Kriegerkaste und von der bisherigen Aristokratie übernehmen konnte, und, nun selber zu einer Art Aristokratie geworden, wen sie sozial einschließt. [2]
Nietzsche schreibt dem Priester besondere Funktionen zu. Er meint, dass durch ihn „eben alles gefährlicher [wird], nicht nur Kurmittel und Heilkünste, sondern auch Hochmuth, Rache, Scharfsinn, Ausschweifung, Liebe, Herrschsucht, Tugend, Krankheit“, aber auch, dass der Mensch eben dadurch „ein interessantes Thier“ geworden ist, „dass erst hier die menschliche Seele in einem höheren Sinne Tiefe bekommen hat und böse geworden ist“. [3] Er meint ferner, dass die Priester die bösesten Feinde seien, weil sie zugleich die ohnmächtigsten sind. Dadurch wachse in ihnen der Hass ins Ungeheure und Unheimliche, ins Geistigste und Giftigste. „Die ganz großen Hasser in der Weltgeschichte sind immer Priester gewesen, auch die geistreichsten Hasser: - gegen den Geist der priesterlichen Rache kommt überhaupt aller übrige Geist kaum in Betracht.“ [4]
Damit Priester überlebensfähig bleiben, muss zum einen an die absolute Überlegenheit ihres Gottes geglaubt werden, und zum anderen kann nur über sie der Zugang zu Gott stattfinden; dadurch machen sie sich der Gesellschaft unentbehrlich. [5]
Jedenfalls war, wie Werner Stegmeier ausbuchstabiert, die Voraussetzung dafür, dass die Priester zur Macht kommen konnten, die Ausbildung des Monotheismus. Im Vergleich dazu war der Polytheismus eine Religion für Individuen. Der Einzelne gewann dadurch sein eigenes Ideal, dadurch sein Gesetz, seine Freude und seine Rechte. Dadurch war auch eine Mehrzahl von Normen möglich, das Individuum hat die ihm zustehende Ehre erfahren. Der Monotheismus sei dagegen die Lehre von einem Normalmenschen. Ein Ideal für alle, dem sich jeder zu unterwerfen hat, ein Normalgott, ein normales Dasein, kaum unterscheidbar von den vielen anderen. Es gibt dadurch einen Sinn des Lebens für alle und für alle Zeit. [6]
Das Ideal jenseits des Lebens sollte ablenken von einem Leben, das nicht zu ertragen war, und zwar die ablenken, für die es nicht zu ertragen war, die „Schwachen, Schlechtweggekommenen, Ohnmächtigen“. Die Ablenkung aber war, so Nietzsche, das Werk des sogenannten „asketischen Priesters“. [7]
Den Priester muss man moderner gedacht nicht mehr nur theologisch ausdeuten. Ein moderner Priester wäre damit jeder, der über Definitionsmacht in öffentlichen Belangen verfügt und über die entsprechenden Kanäle und Medien, diese durchzusetzen; jeder der auf diese Weise die Werte einer Gesellschaft mitbestimmt, denen sie ihre Anstrengungen widmen soll. [8]
Das Ressentiment:
Nietzsche führt nun einen neuen Terminus ein.
„Vielmehr frage man sich doch, wer eigentlich ‚böse‘ ist, im Sinne der Moral des Ressentiment. In aller Strenge geantwortet: eben der ‚Gute‘ der andren Moral, eben der Vornehme, der Mächtige, der Herrschende, nur umgefärbt, nur umgedeutet, nur umgesehen durch das Giftauge des Ressentiment.“[9] [10]
Nietzsche gebraucht für die unvornehme Wertungsweise nun den Begriff des Ressentiments. Er ist wohl der prominenteste Begriff der GdM, und Nietzsche verwendet ihn ab hier zum ersten Mal in seinem veröffentlichten Werk. Doch er führt auch ihn nicht durch eine Definition ein, er vermeidet auch jetzt noch fertige Begriffe. [11]
Das Ressentiment entstehe dadurch, dass die Gemeinen und Schwachen in einer aristokratischen Welt sich nicht frei entfalten können, und dadurch ihr Leben vergiftet wird, was schließlich in Bitterkeit und Hass mündet. [12]
Raffnsoe beschreibt die Umwertung der Werte durch das Ressentiment in einem Drei-Stufen-Modell: [13]
- Es wird eine ‚wahrere‘ Parallel-Welt zur Bestehenden geschaffen
- Die Stärke der bestehenden Welt wird zu einer Schwäche in der ‚wahreren‘ Welt umgedeutet (oder umgelogen)
- Damit vermag man somit seinen neuen Werten einen höheren Rang zu geben, ‚wahrer und beständiger‘ als die des Wertsystems der (ehemals) bestehenden Welt
Raffnsoe meint, dass erst das Ressentiment (für Nietzsche) den Menschen zu einem „interessanten Tier“ gemacht hat, das seine Menschlichkeit erlangt, indem es sich radikal von anderen Tieren unterscheidet. Aber das Raffinement und die Verfeinerung, die das Ressentiment dem menschlichen Leben hinzufügt, seien zugleich äußerst gefährliche Zutaten, die das Risiko erheblichen Scheiterns beinhalten, das Menschsein habe dadurch mehr Tiefe und Bösartigkeit hinzugewonnen. [14]
Raffnsoe interpretiert Nietzsche ferner, dass wo das Ressentiment das Leben verleugnet, es auf jeden Fall als ein Tonikum, als ein Gift, das, in der rechten Dosierung, belebend und stärkend auf die Lebenskraft wirke – wie man es auch von Alkohol, Koffein und Drogen kennt; ein starkes Stimulanz, sich für Jahrhunderte Geltung verschaffend, so erfolgreich, dass es sich nahezu zu Tode gesiegt habe. [15]
Stegmeier untersucht, wie Nietzsche die Organisation des asketischen Priesters der Kultur des Ressentiments beschreibt. Günstige Bedingungen einer breiten Machtausübung des Priesters sind, so Nietzsche, epidemische Depressionen, etwa in Folge von starken Rassenmischungen, Wechseln des Klimas, Defiziten der Ernährung etc... Da man die Ursachen aber nicht hier suchte, griff man zu moralpsychologischen Mitteln der Bekämpfung. Er versucht im Zusammenspiel der psychologischen und auch physiologischen Perspektive ein Proto-Stück von dem, was heute als Zivilisations-, Alltags-, und Mentalitäten-Geschichte bekannt ist. Die wichtigsten moralpsychologischen Mittel zur Erleichterung der (physiologischen) Depressionen breiter Massen lassen sich in folgender Dreiteilung darstellen: [16]
- Erlösung von Leiden durch Ruhigstellung: Förderung pessimistischer Religionen
- Ablenkung von Leiden durch mechanische Arbeit und gegenseitige Wohltaten: Förderung der Herdenbildung
- Anregung zu Gefühls-Ausschweifungen: das asketische Ideal als Verhängnis des europäischen Menschen
„Alle Kranken, Krankhaften streben instinktiv […] nach einer Heerden-Organisation: der asketische Priester erräth diesen Instinkt und fördert ihn. […] Denn man übersehe dies nicht: die Starken streben ebenso naturnothwendig auseinander, als die Schwachen zueinander; wenn erstere sich verbinden, so geschieht es nur in der Aussicht auf eine aggressive Gesammt-Aktion und Gesammt-Befriedigung ihres Willens zur Macht, mit vielem Widerstande des Einzelgewissens.“ [17]
Die Ideale:
Nietzsche vertritt die bezweifelnswerte Meinung, dass gerade die Juden – ein Volk von Priestern – die Umwerthung aller Werte vor über 2000 Jahren (bewusst) gestartet haben, angefangen mit „[d]iese[m] Jesus von Nazareth, als das leibhafte Evangelium der Liebe, dieser den Armen, den Kranken, den Sündern die Seligkeit und den Sieg bringende[n] ‚Erlöser‘ – war er nicht gerade die Verführung in ihrer unheimlichsten und unwiderstehlichsten Form […]?“ [18] „Gewiss ist wenigstens, dass sub hoc signo [19] Israel mit seiner Rache und Umwertung aller Werthe bisher über alle anderen Ideale, über alle vornehmen Ideale immer wieder triumphirt hat“. [20]
„Europa ist heute reich und erfinderisch vor Allem in Erregungsmitteln, es scheint Nichts nöthiger zu haben als Stimulantia und gebrannte Wasser: daher auch die ungeheure Fälscherei in Idealen, diesen gebranntesten Wassern des Geistes, daher auch die widrige, übelriechende, verlogne, pseudoalkoholische Luft überall.“ [21]
Dass Nietzsche gegen die Gefühlsverweichlichung (v.a. der Europäer) anwettert, zeigt sich immer wieder nur allzu deutlich.
„Gesetzt, dass es wahr wäre, was jetzt jedenfalls als ‚Wahrheit‘ geglaubt wird, dass es eben der Sinn aller Cultur sei, aus dem Raubthiere ‚Mensch‘ ein zahmes und civilisirtes Thier, ein Hausthier herauszuzüchten, so müsste man unzweifelhaft alle jene Reaktions- und Ressentiments-Instinkte, mit deren Hülfe die vornehmen Geschlechter sammt ihren Idealen schließlich zu Schanden gemacht und überwältigt worden sind, als die eigentlichen Werkzeuge der Cultur betrachten; womit allerdings noch nicht gesagt wäre, dass deren Träger zugleich auch selber die Cultur darstellten.“ [22]
Wir finden bei Nietzsche die Behauptung, dass alles, was mit sogenannter höherer Kultur, künstlerischer Kreativität und intellektueller Integrität zu tun hat, seine Wurzeln in der Grausamkeit hat – Grausamkeit gegen sich selber an erster Stelle, aber auch Grausamkeit gegen andere. Ist man nicht bereit und fähig genug, grausam mit sich selber zu sein, so wird man auch nicht fähig sein, so zu handeln, dass man seiner eigenen Unzufriedenheit mit sich selber begegnen kann, und diese Unzufriedenheit werde nur Selbsthass und Ressentiment erzeugen. Nietzsches Sorge ist, dass uns dieser Elan abhanden kommen wird, und wir damit die Fähigkeit verlieren, mit uns selber hart umzuspringen, was der Schlüssel für alle „Selbstüberwindung“ und alle schöpferische Verklärung des menschlichen Lebens sei, die es von der (angeblichen) Sinnlosigkeit erlösen könnte. [23]
„[D]enn wir experimentieren mit uns, wie wir es uns mit keinem Thiere erlauben würden, und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf: was liegt uns noch am ‚Heil‘ der Seele!“ [24]
„Diese ‚guten Menschen‘, - sie sind allesammt jetzt in Grund und Boden vermoralisirt und in Hinsicht auf Ehrlichkeit zu Schanden gemacht und verhunzt für alle Ewigkeit: wer von ihnen hielte noch eine Wahrheit ‚über den Menschen‘ aus!“ [25]
Schuld und Strafe:
Die Strafe:
Die „englischen Moralpsychologen“ werden von Nietzsche teils scharf angegriffen. Diese meinen, dass die Herkunft der Strafe aus ihrem Zweck abgeleitet werden muss. Die Herkunft wird aus der Abschreckung oder der Linderung des Rachebedürfnis interpoliert. Nietzsche fordert dagegen eine Trennung von Ursprung und Zweck. Zwar kann ein Zusammenhang bestehen, es kann aber später auch eine Umdeutung stattgefunden haben, um wiederum anderen Zwecken angegliedert zu werden. [26]
Nietzsche hat im Grunde nur Verachtung für alle nachträglichen rationellen Zurechtlegungsversuche übrig. Verantwortung und Gewissen seien stattdessen verhältnismäßig früh unter Drohung und durch eine bestimmte Dressur entstanden, die darauf abzielten, uns zu verpflichten, und die schließlich das bestimmte und kontingente Verhalten der Verpflichtung natürlich erscheinen ließ. [27]
Geradezu prophetisch lästert Nietzsche immer wieder über die Deutschen in seinen Werken.
„Das tiefe, eisige Misstrauen, das der Deutsche erregt, sobald er zur Macht kommt, auch jetzt wieder – ist immer noch ein Nachschlag jenes unauslöschlichen Entsetzens, mit dem Jahrhunderte lang Europa dem Wüthen der blonden germanischen Bestie zugesehen hat (obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen kaum eine Begriffs-, geschweige eine Blutsverwandtschaft besteht.)“ [28]
„Wir Deutschen betrachten uns gewiss nicht als ein besonders grausames und hartherziges Volk, noch weniger als besonders leichtfertig und in-den-Tag-hineinleberisch; aber man sehe nur unsre alten Strafordnungen an, um dahinter zu kommen, was es auf Erden für Mühe hat, ein ‚Volk von Denkern‘ heranzuzüchten.“ [29]
In diesem Zusammenhang nennt Nietzsche eine Reihe harter Strafen, die in Deutschland noch relativ spät Brauch waren. Um sozusagen das Tier im Zaun zu halten, musste eben desto eine entsprechende Gegen-Bestialität ins Werk gesetzt werden. [30]
Nietzsche bedauert die Schablonisierung des Menschengeschlechts aufrichtig, und bringt dies auch immer wieder klar zum Ausdruck.
„[D]er Mensch wurde mit Hülfe der Sittlichkeit der Sitte und der socialen Zwangsjacke wirklich berechenbar gemacht.“ [31]
„Ah, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heisst, alle diese Vorrechte Prunkstücke des Menschen: wie theuer haben sie sich bezahlt gemacht! Wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller ‚guten Dinge‘!“ [32]
Die Schuld:
Das Verständnis des Machtverhältnisses von Schuld und Strafe ist bei Nietzsche besonders drastisch.
„Vermittelst der ‚Strafe‘ am Schuldner nimmt der Gläubiger an einem Herren-Rechte theil: endlich kommt auch er ein mal zu dem erhebenden Gefühle, ein Wesen als ein ‚Unter-sich‘ verachten und misshandeln zu dürfen – oder wenigstens, im Falle die eigentliche Strafgewalt, der Strafvollzug schon an die Obrigkeit übergangen ist, es verachtet und misshandelt zu sehen. Der Ausgleich besteht also in einem Anweis und Anrecht auf Grausamkeit.“ [33]
Vornehme versus Unvornehme, Starke versus Schwache:
Nietzsche nimmt an, dass das Wort ‚gut‘ in seiner ursprünglichen Bedeutung in einer auf Auszeichnung oder Distinktion gegründeten Gesellschaft Verwendung gefunden haben muss. Eine solche Gesellschaft sei eine aristokratische Gesellschaft, in der sich einige ganz umstandslos als die Optimaten, die sich vor anderen auszeichnen, erleben, und für sich selbstredend beanspruchen, die Anführer darzustellen. Die Besten nehmen sich dabei das Recht heraus, den guten Geschmack zu definieren und die Werte der Gesellschaft zu schaffen. [34]
Nach Nietzsche ist der vornehm, wer stark entschlossen und angstfrei genug ist, um Vergeltung zu üben, wenn ihm etwas angetan wurde; wer für sich einstehen kann und sich selbst zu schützen und zu rächen weiß. Was der Vornehme tut, ist gut, eben weil er selbst von guter Art ist. Schlecht ist der Niedrige, weil er für sich selbst nicht genügend Wertschätzung empfindet, um sich wehren zu wollen. Mit welchen beschränkten Mitteln auch immer. Vornehm und Niedrig seien also Bezeichnungen für das unterschiedliche Maß der Selbstachtung. Aus Nietzsches Perspektive des Vornehmen ist der schlechte Mensch der nichtige Mensch, von dem man nichts zu befürchten hat, weil er noch nicht einmal sich selbst achtet. Aber die nichtigen Menschen können für die Vornehmen doch gefährlich werden, wenn sie als Massenphänomen ihre Schwäche herunterstufend, zum Angriff übergehen, im physischen Sklavenaufstand, oder geistig, indem sie die Rangordnungen der Werte und Tugenden umkehren, und die vorherrschenden Tugenden durch eine Moral des Ertragens und der Demütigkeit ersetzen. [35]
Nietzsche gibt in einigen Variationen uns folgende Erklärung mit auf den Weg, nämlich, dass das Christentum ursprünglich eine Religion von Leuten sei, die gedrückt und elend lebten, die nicht vornehm waren und deshalb auch nicht vornehm von sich dachten. Das Christentum als Allegorie der geringen Selbstachtung. Es versenkte die Menschen vollends in dem tiefen Schlamm, worin sie bereits steckten. [36]
„Wer nicht nur seine Nase zum riechen hat, sondern auch seine Augen und Ohren, der spürt fast überall, wohin er heute auch nur tritt, etwas wie Irrenhaus-, wie Krankenhausluft, - ich rede, wie billig, von den Culturgebieten des Menschen, von jeder Art ‚Europa‘, das es nachgerade auf Erden giebt. Die Krankhaften sind des Menschen grosse Gefahr: nicht die Bösen, nicht die ‚Raubthiere‘. Die von vornherein Verunglückten, Niedergeworfenen, Zerbrochenen – sie sind es, die Schwächsten sind es, welche am meisten das Leben unter Menschen unterminiren, welche unser Vertrauen zum Leben, zum Menschen, zu uns am gefährlichsten vergiften und in Frage stellen.“ [37]
„Sie wandeln unter uns als leibhafte Vorwürfe, als Warnungen an uns, - wie als ob Gesundheit, Wohlgeratenheit, Stärke, Stolz, Machtgefühl an sich schon lasterhafte Dinge seien, für die man einst büssen, bitter büssen müsse: oh wie sie im Grunde dazu selbst bereit sind, büssen zu machen, wie sie darnach dürsten, Henker zu sein! Unter ihnen giebt es in Fülle die zu Richtern verkleideten Rachsüchtigen, welche beständig das Wort „Gerechtigkeit“ wie einen giftigen Speichel im Munde tragen, immer gespitzten Mundes, immer bereit, Alles anzuspeien, was nicht unzufrieden blickt und guten Muths seine Strasse zieht.“ [38]
Es ist also letzten Endes zu einer Tyrannei über und gegen die (körperlich und geistig) Gesunden gekommen, so Nietzsche. Die Gesunden sollen (wegen der Scham) am Recht auf ihr zustehendes Glück zweifeln.
Die Aufgabe, die Nietzsche seiner (oder vielleicht der Zukünftigen) Zeit gestellt sieht, ist für ihn, eine erneuerte, höhere Kultur zu schaffen, die den Rang der (griechischen) Antike wieder erreichen kann. Als Bedingung dafür stellt er deutlich das große Individuum heraus. [39]
Nietzsche geht bei seiner Unterweisung, was freie Geister seien, auf den syrischen Assasinenorden des 11.-13 Jahrhunderts ein. Erst Menschen wie die höheren Assassinen, deren Credo es war ‚Nichts ist wahr, alles ist erlaubt‘, können wirklich freie Geister genannt werden. Sie verlangten von den unteren Kasten Gehorsam, indem sie sie im Glauben ließen, substantiellen religiösen Wahrheiten gehorsam und verpflichtet zu sein. Aber solche Wahrheiten hatten sie überhaupt nicht, selbst wenn es welche gegeben hätte. Die höhere Hierarchie hatte nur ihren eigenen Wunsch und Willen, den sie als Wahrheit erscheinen ließen, und als solche ausgaben. Wirklich freie Geister sind also für Nietzsche Menschen, die nichts Bestimmten unterworfen sind, die keine unbedingten Verpflichtungen haben. Dadurch sind sie imstande, sich angeblicher Wahrheiten und des Glaubens anderer an solche zu bedienen, ohne selbst auf irgendeine Weise verpflichtet zu sein. [40]
Abschließende Bemerkungen:
Nietzsche entfaltet in seinem Werk einen (im Vergleich zu seinen früheren Werken) noch polemischer zugespitzten Stil, der zwischen dem Wissenschaftlich kühlen und persönlich passionierten Ton hin und herspringt, um auf unerhörte und provokante Wahrheiten aufmerksam zu machen. [41] Er nennt die GdM deshalb eine Streitschrift, weil einem so komplexen Gebilde wie der Moral Unrecht geschehe, wenn man vorgäbe, sie vollständig begreifen zu können; und dabei war Nietzsche bisher noch der mutigste Kritiker des moralischen Denkens und Erkennens.
Nach ihm liegt der Ursprung des Bösen in der Welt, bzw. den Werturteilen der Menschen. [42] In der Auseinandersetzung mit Schopenhauer, der, so meint Nietzsche, zum Leben und zu sich selbst Nein sagte, entwickelt Nietzsche eine tiefgreifende Skepsis. Er sehe hier eine große Gefahr für die Menschheit, eine nicht zu tolerierende „Mitleids-Moral“ „welche selbst die Philosophen ergriff und krank machte, als das unheimlichste Symptom unsrer unheimlich gewordenen europäischen Cultur“. [43] Denn die Philosophen bis einschließlich Kant glaubten an das Credo des „Unwerth[es] des Mitleidens“. [44] Sich der „modernen Gefühlsverweichlichung“ entgegensetzend, leitet Nietzsche zu seiner Kritik der moralischen Werthe über. [45] Er rekonstruiert das Werden der Moral v.a. historisch.
Wenn man wissen will wie die Zukunft aussieht, schaue man in die Vergangenheit. Deshalb sehe ich vieles, was Nietzsche schreibt, vor allem als Prophezeiung an. Wie er es vorausgesehen hat, war das 20. Jhd. (und einiges trifft auch und vor allem auf das 21. Jhd. zu) ein moralisches Jahrhundert, das sowohl gute als auch schlechte Moral ins Extreme gesteigert hat. Jede Moral ist versucht, sich für die bessere zu halten, und das schlägt sich auch bei Nietzsche selbst nieder. Die GdM ist weniger ein Werk der Ethik, sie hält vielmehr der Ethik wie eine Art von Anti-Meta-Ethik den Spiegel vor. Wie einige Menschen Spott und Lästerungen seitens Nietzsche gegen diverse Subjekte und Objekte (auch metaphysisch gedacht) als Huldigungen missverstehen konnten und können, ist mir jedoch sehr schleierhaft.
Literaturverzeichnis:
Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral, in: Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Band 5, Colli, Giorgio (Hg.), Montinari, Mazzino (Hg.), München, 1980, Walter de Gruyter, S. 245 – 412
Raffnsoe, Sverre: Nietzsches „Genealogie der Moral“, Paderborn, 2007, Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG
Safranski, Rüdiger: Nietzsche. Biographie seines Denkens, Frankfurt am Main, 2002, Fischer Taschenbuch Verlag
Schacht, Richard: Moral und Mensch, in: Klassiker Auslegen. Friedrich Nietzsche. Zur Genealogie der Moral, Höffe, Otfried (Hg.), Berlin, 2004, Akademie Verlag, S. 115 – 132
Stegmeier, Werner: Nietzsches >Genealogie der Moral<, Darmstadt, 1994, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Stegmeier, Werner: Die Bedeutung des Priesters für das asketische Ideal. Nietzsches ‚Theorie‘ der Kultur Europas, in: Klassiker Auslegen. Friedrich Nietzsche. Zur Genealogie der Moral, Höffe, Otfried (Hg.), Berlin, 2004, Akademie Verlag, S. 149 – 162
Wolf, Jean-Claude: Exposition von These und Gegenthese: Die bisherige „englische“ und Nietzsches Genealogie der Moral, in: Klassiker Auslegen. Friedrich Nietzsche. Zur Genealogie der Moral, Höffe, Otfried (Hg.), Berlin, 2004, Akademie Verlag, S. 31 – 46
[1]Vgl. Wolf, 2004, S. 35
[2]Vgl. Stegmeier, 1994, S. 106
[3]Nietzsche, 1980, S. 266
[4]Ebd. S. 266f
[5]Vgl. Stegmeier, 1994, S. 108
[6]Ebd. S. 107
[7]Vgl. Stegmeier, 2004, S. 156
[8]Ebd. S. 158
[9]Nietzsche, 1980, S. 274
[10]Meines Erachtens wird nicht immer trennscharf zwischen Subjekt und Eigenschaft unterschieden, wenn Nietzsche von „Ressentiment“ spricht.
[11]Vgl. Stegmeier, 1994, S. 118
[12]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 49
[13]Ebd. S. 51f.
[14]Ebd. S. 57
[15]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 58
[16]Vgl. Stegmeier, 1994, S. 191f.
[17]Nietzsche, 1980, S. 384
[18]Nietzsche, 1980, S. 268
[19]Gemeint ist Gott bzw. Jesus am Kreuz
[20]Nietzsche, 1980, S. 269
[21]Ebd. S. 408
[22]Ebd. S. 276
[23]Vgl. Schacht, 2004, S. 124f.
[24]Nietzsche, 1980, S. 357
[25]Ebd. S. 386
[26]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 70f.
[27]Ebd. S. 70
[28]Nietzsche, 1980, S. 275f
[29]Ebd. S. 296
[30]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 71
[31]Nietzsche, 1980, S. 293
[32]Ebd. S. 297
[33]Ebd. S. 300
[34]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 37f.
[35] Vgl. Safranski, 1994, S.188f.
[36] Ebd. S. 196
[37]Nietzsche, 1980, S. 368
[38]Ebd. S. 369
[39]Vgl. Stegmeier, 1994, S. 28
[40]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 134
[41]Vgl. Raffnsoe, 2007, S. 8
[42]Vgl. Nietzsche, 1980, S. 249f.
[43]Ebd. S. 252
[44]Ebd.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Analyse von Nietzsches "Zur Genealogie der Moral"?
Diese Analyse bietet eine umfassende Übersicht über Friedrich Nietzsches Buch "Zur Genealogie der Moral". Sie behandelt Themen wie die Rolle des Priesters, das Ressentiment, Ideale, Schuld und Strafe sowie die Dichotomie zwischen Vornehmen und Unvornehmen. Ziel ist es, die Machtverhältnisse, die Nietzsche beschreibt, zu veranschaulichen und Nietzsches eigenen Moralansatz zu beleuchten.
Welche Rolle spielt der Priester in Nietzsches Analyse?
Nietzsche sieht die priesterliche Kaste, insbesondere die Juden, als soziale Träger der Machtübernahme durch die Moral. Er schreibt dem Priester besondere Funktionen zu, wie die Vertiefung der menschlichen Seele und die Entwicklung von Hass. Die Priester machen sich unentbehrlich, indem sie den Zugang zu Gott kontrollieren.
Was versteht Nietzsche unter dem Begriff "Ressentiment"?
Das Ressentiment entsteht, wenn sich Gemeine und Schwache in einer aristokratischen Welt nicht frei entfalten können, was zu Bitterkeit und Hass führt. Es beinhaltet die Umwertung der Werte, indem eine Parallelwelt geschaffen wird, die Stärken der bestehenden Welt in Schwächen umdeutet und neuen Werten einen höheren Rang verleiht.
Wie beschreibt Nietzsche die Umwertung der Werte durch das Ressentiment?
Die Umwertung erfolgt in drei Stufen: Schaffung einer Parallelwelt, Umdeutung von Stärke in Schwäche und die Erhebung neuer Werte über die des bestehenden Systems.
Welche Ideale kritisiert Nietzsche?
Nietzsche kritisiert die Verweichlichung durch Ideale, insbesondere die der Europäer. Er behauptet, dass höhere Kultur und Kreativität ihre Wurzeln in Grausamkeit haben und dass die Unfähigkeit, grausam zu sich selbst zu sein, zu Selbsthass und Ressentiment führt.
Wie interpretiert Nietzsche das Verhältnis von Schuld und Strafe?
Nietzsche lehnt die Ableitung der Strafe aus ihrem Zweck ab und fordert eine Trennung von Ursprung und Zweck. Er sieht Strafe als Möglichkeit für den Gläubiger, an einem Herren-Recht teilzunehmen und den Schuldner zu verachten.
Was bedeutet die Unterscheidung zwischen Vornehmen und Unvornehmen bei Nietzsche?
Vornehm ist, wer stark, entschlossen und angstfrei genug ist, um Vergeltung zu üben. Gut ist, was der Vornehme tut, weil er von guter Art ist. Schlecht ist der Niedrige, der sich selbst nicht achtet. Nietzsche sieht das Christentum als Allegorie der geringen Selbstachtung.
Was sind die abschließenden Bemerkungen zur Interpretation Nietzsches?
Die Interpretation schließt mit der Feststellung, dass Nietzsche einen polemischen Stil verwendet, um auf provokante Wahrheiten aufmerksam zu machen. Er rekonstruiert das Werden der Moral historisch und sieht in der "Mitleids-Moral" eine Gefahr für die Menschheit. Viele seiner Ansichten, einschließlich über die Bedeutung des Priesters, werden als Vorhersagen über moralische Jahrhunderte angesehen, während er Ethik eher als Spiegel vorhält.
- Arbeit zitieren
- Christian Klisch (Autor:in), 2024, Zu den Machtverhältnissen in Friedrich Nietzsches "Zur Genealogie der Moral", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1504492