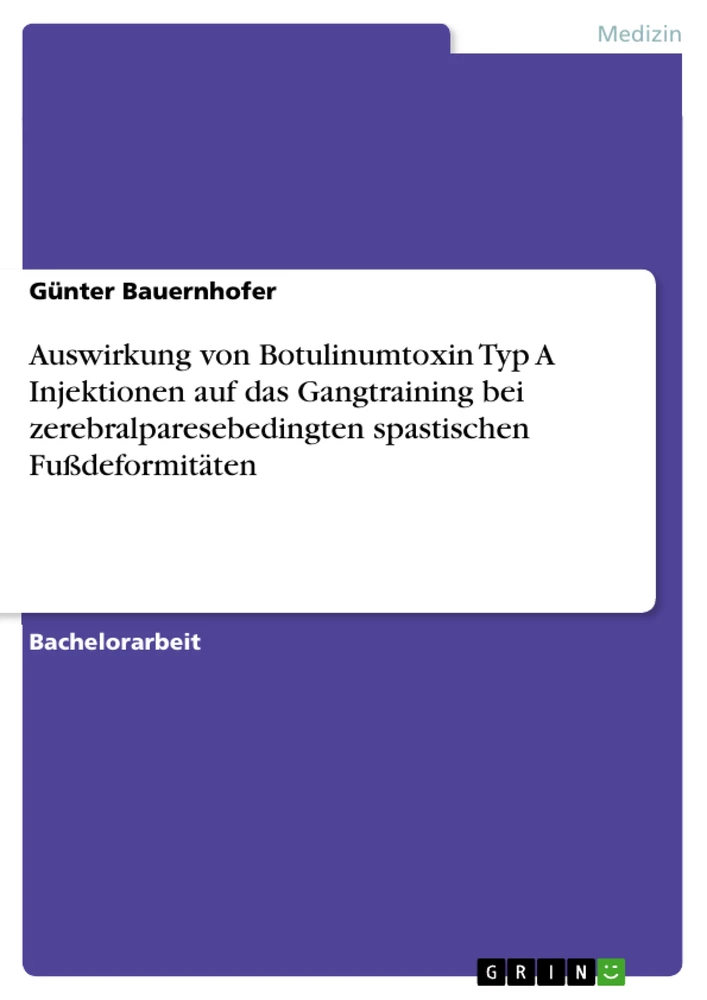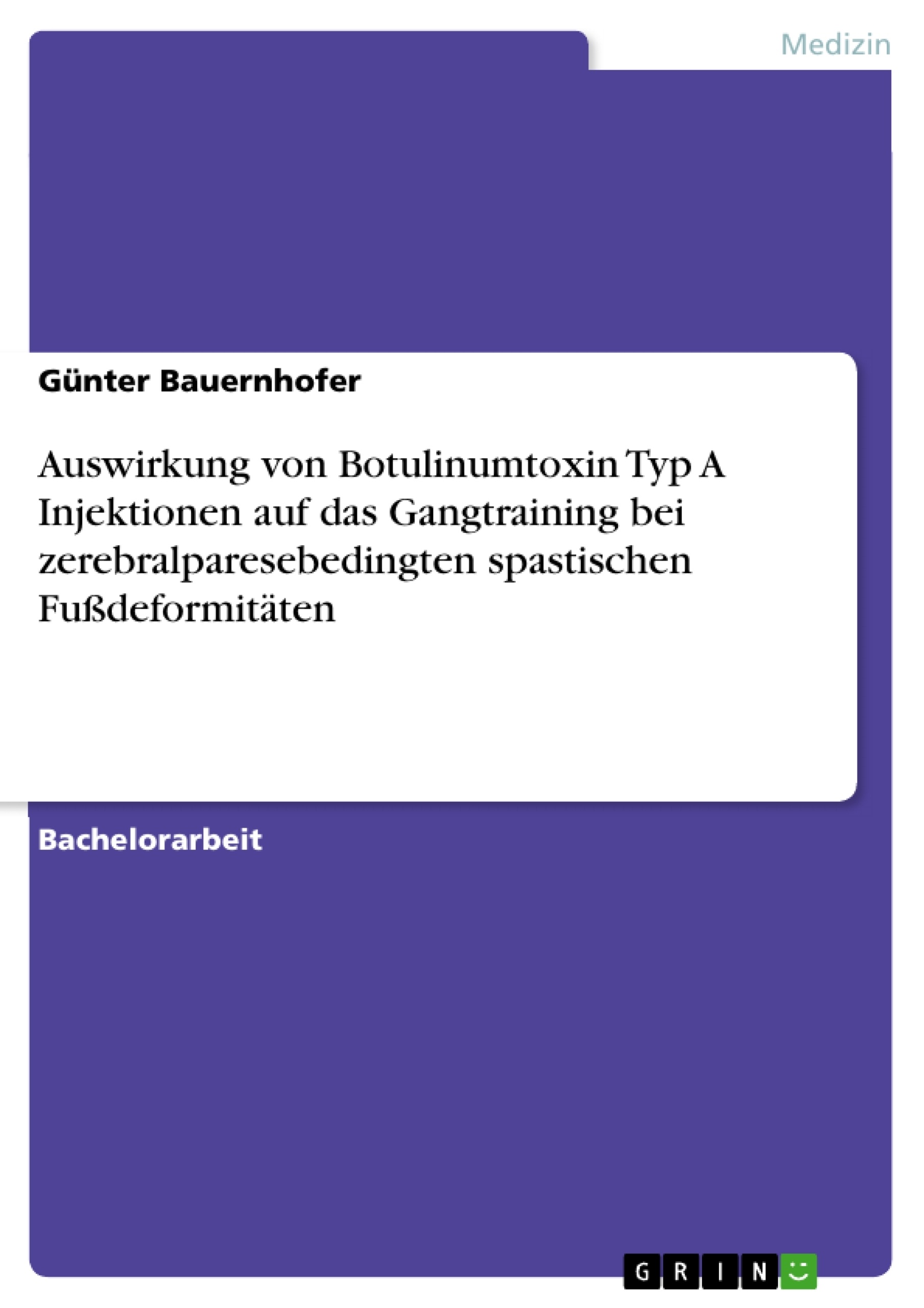Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob durch Botulinumtoxin Typ A Injektionen Auswirkungen auf das Gangtraining bei Kindern mit zerebralparesebedingten spastischen Fußdeformitäten zu erwarten sind. Sie basiert auf dem fiktiven Patientenbeispiel eines siebenjährigen Kindes mit der Diagnose ‚Infatile Zerebralparese‘ und dadurch bedingter spastischer Spitzfußstellung beider Beine.
Botulinumtoxin Typ A ist das Toxin eines Bakteriums, welches nach Injektion in den Muskel die Acetylcholinfreisetzung und somit eine Erregungsübertragung hemmt. Diese Methode wird daher auch zur Senkung der Spastizität, welche ein Leitsymptom der infantilen Zerebralparese darstellt, angewandt. Durch zerebralparesebedingte Muskeldysbalancen können auch verschiedene Fußdeformitäten entstehen, welche das Kind wesentlich in seiner Gangaktivität einschränken.
Die Arbeit behandelt Studien, in welchen die Wirkungsweise von Botulinumtoxin Typ A Injektionen in den Musculus gastrocnemius bei spastischem Spitzfuß untersucht wurde. Hierbei zeigen sich Verbesserungen auf struktureller Ebene. Auf Funktionsebene erkennt man kaum signifikante Unterschiede im Vergleich zu der Placebogruppe.
Der / die PhysiotherapeutIn nimmt in dem Prozess der Botulinumtoxintherapie einen wichtigen Platz in der interdisziplinären Zusammenarbeit ein. Dieses Aufgabengebiet reicht von der Unterstützung bei der Patientenauswahl bis zur anschließenden Physiotherapie nach der Injektion. Diese physiotherapeutische Behandlung beginnt mit der Unterstützung des Kindes bei der Anpassung an die geänderte muskuläre Situation. Der Zeitraum, in dem Botulinumtoxin Typ A seine größte Wirkung zeigt, soll für Dehnung der spastischen Muskulatur und Kräftigung der antagonistischen Muskulatur verwendet werden. Die zukünftige Therapie zielt auf ein funktionelles, spielerisches, dynamisches und aktives Training ab. Weiters zeigt eine Einzelfallstudie, dass dynamische Therapie möglicherweise eine Alternative zur Botulinumtoxinbehandlung darstellen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fiktives Patientenbeispiel
- 1. Botulinumtoxin
- 1.2 Allgemeine Wirkungsweise von Botulinumtoxin Typ A
- 1.2.1 Wirkungsweise auf verschiedenen Ebenen
- 1.3 Anwendungsgebiete
- 2. Zerebralparesebedingte, spastische Fußdeformitäten
- 2.1 Zerebralparese
- 2.2 Spastizität
- 2.2.1 Spastische Tetraplegie, Diplegie und Hemiplegie
- 2.3 Fußdeformitäten
- 2.3.1 Allgemein
- 2.3.2 Der Spitzfuß (Pes equinus)
- 2.3.3 Der Plattfuß (Pes planovalgus)
- 2.3.4 Der Klumpfuß (Pes equinovarus)
- 3. Die Ganganalyse vor und nach Botulinumtoxininjektion
- 4. Der / die Physiotherapeutin in der Botulinumtoxintherapie
- 4.1 Faktoren des Gangtrainings
- 5. Dynamische Therapie als Alternative zu Botulinumtoxin
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Botulinumtoxin Typ A Injektionen einen positiven Einfluss auf das Gangtraining bei Kindern mit zerebral paresebedingten spastischen Fußdeformitäten haben. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung von Botulinumtoxin Typ A bei einem fiktiven Patientenbeispiel eines siebenjährigen Kindes mit infantiler Zerebralparese und spastischem Spitzfuß.
- Wirkungsweise von Botulinumtoxin Typ A bei spastischer Fußdeformität
- Bedeutung der Physiotherapie in der Botulinumtoxintherapie
- Ganganalyse vor und nach Botulinumtoxininjektion
- Dynamische Therapie als Alternative zur Botulinumtoxinbehandlung
- Studienlage und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und präsentiert das fiktive Patientenbeispiel. Kapitel 1 behandelt die Wirkungsweise von Botulinumtoxin Typ A und seine Anwendungsmöglichkeiten. Kapitel 2 beschäftigt sich mit zerebral paresebedingten, spastischen Fußdeformitäten, einschließlich der Definition der Zerebralparese, der Spastizität und der verschiedenen Fußdeformitäten. Kapitel 3 beleuchtet die Ganganalyse vor und nach Botulinumtoxininjektion. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Rolle der Physiotherapeutin in der Botulinumtoxintherapie und die verschiedenen Faktoren des Gangtrainings. Kapitel 5 präsentiert die dynamische Therapie als alternative Behandlungsmethode. Das Kapitel "Diskussion" bietet eine umfassende Analyse der Ergebnisse und stellt die Relevanz der Ergebnisse in den Kontext der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Botulinumtoxin Typ A, Zerebralparese, spastische Fußdeformitäten, Ganganalyse, Physiotherapie, Gangtraining, dynamische Therapie, Spastizität, Spitzfuß, Plattfuß, Klumpfuß.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt Botulinumtoxin Typ A bei spastischen Fußdeformitäten?
Es hemmt die Erregungsübertragung zum Muskel, senkt so die Spastizität und ermöglicht eine bessere Anpassung der muskulären Situation.
Was ist ein spastischer Spitzfuß (Pes equinus)?
Eine durch Zerebralparese bedingte Fehlstellung, bei der die Ferse den Boden beim Gehen nicht berührt, was die Mobilität stark einschränkt.
Welche Rolle spielt die Physiotherapie nach der Injektion?
Der Physiotherapeut nutzt den Zeitraum der maximalen Toxinwirkung für Dehnungen der spastischen und Kräftigung der antagonistischen Muskulatur.
Verbessert Botulinumtoxin das Gangbild signifikant?
Studien zeigen Verbesserungen auf struktureller Ebene, während signifikante Unterschiede auf funktioneller Ebene im Vergleich zu Placebogruppen seltener sind.
Gibt es Alternativen zur Botulinumtoxin-Behandlung?
Die Arbeit erwähnt eine Einzelfallstudie, wonach eine dynamische Therapie möglicherweise eine Alternative darstellen kann.
- Arbeit zitieren
- Günter Bauernhofer (Autor:in), 2009, Auswirkung von Botulinumtoxin Typ A Injektionen auf das Gangtraining bei zerebralparesebedingten spastischen Fußdeformitäten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/150131