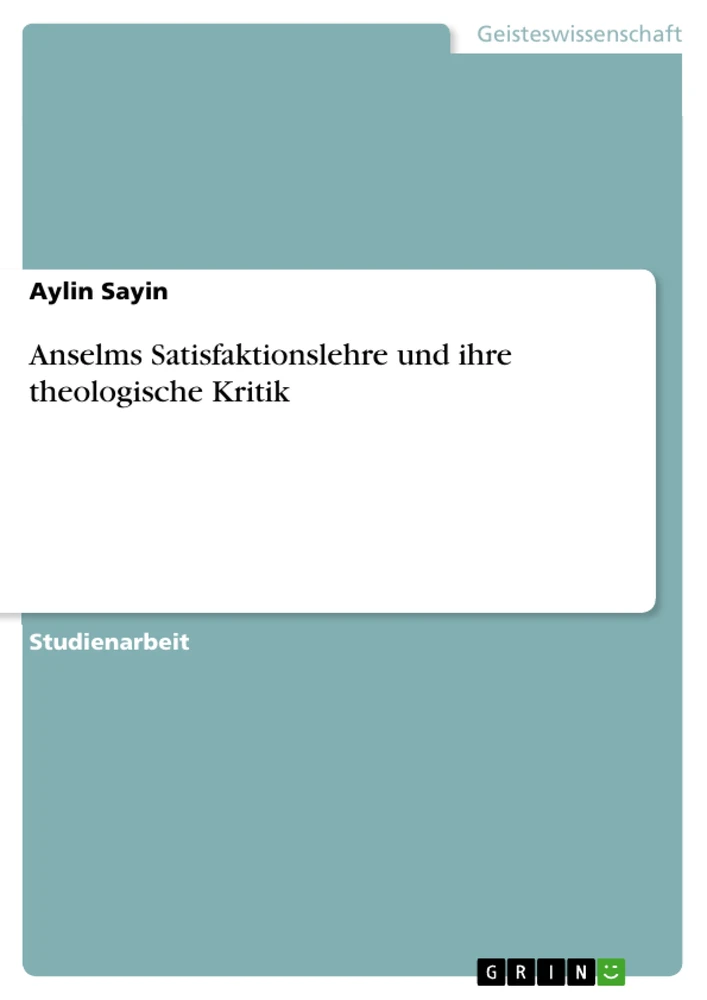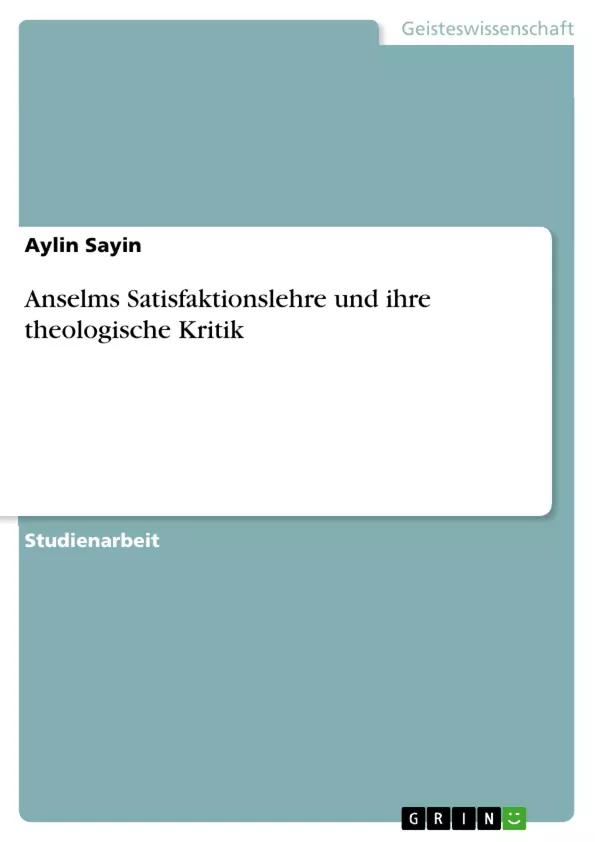Diese Proseminararbeit beschäftigt sich mit dem Werk „Cur Deus homo“, welches Anselm von Canterbury (1033–1109) wahrscheinlich in der Zeit von 1093 bis zur Vollendung im Sommer 1098 geschrieben hat. Seine Ausführungen und die damit verbundene Satisfaktionslehre sollen dargestellt, die Kritik in der Sekundärliteratur analysiert und folgend eine eigene Stellung bezogen werden. Jene Satisfaktionslehre versucht das theologische Problem zu erklären, warum Gott Mensch werden musste und inwiefern dies mit der Genugtuung der Sünden der Menschen zutun hat. Die These, dass Anselms Satisfaktionslehre zwar in Bezug auf seinen soziologischen Hintergrund wertzuschätzen sei, da er sich von den vorherigen Versöhnungslehren loslöste, jedoch mit dem sich verändernden geistlichen und gesellschaftlichen Kontext mehrere theologische Kritikpunkte auftreten, soll untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Thema
- Einordnung in die Tradition
- Definitionen
- Quelle: Anselms Satisfaktionslehre – „Cur Deus homo❝
- Historische Einordnung
- Gliederung
- Argumentationsverlauf
- Kap. 1–3: Anthropologie / Über die Beschaffenheit des Menschen
- Kap. 4–5: Vollendung der Menschenschöpfung und Gottes Gnade
- Kap. 6–13: Christologie / Über die Beschaffenheit des Gottmenschen
- Kap. 14-16: Soteriologie
- Kap. 17-20: Unterscheidung Wille und Notwendigkeit und deren Konsequenzen
- Kap. 21–22: Abschließende Bemerkungen
- Sekundärliteratur
- Gerechtigkeit vs. Barmherzigkeit / Notwendigkeit vs. Freiheit
- Aut poena aut satisfactio
- Christi Person und Werk
- Kritik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit analysiert Anselm von Canterbury's Werk „Cur Deus homo“, welches die Satisfaktionslehre beleuchtet. Ziel ist es, Anselms Argumentation darzustellen, die Kritik in der Sekundärliteratur zu untersuchen und eine eigene Stellungnahme zu formulieren. Die Arbeit betrachtet die Satisfaktionslehre als eine Antwort auf das theologische Problem der Menschwerdung Gottes und deren Zusammenhang mit der Genugtuung der menschlichen Sünden. Die These ist, dass Anselms Satisfaktionslehre, trotz ihrer soziologischen Bedeutung im Kontext ihrer Entstehung, mit dem Wandel von Geist und Gesellschaft mehrere theologische Kritikpunkte aufwirft.
- Anselms Satisfaktionslehre in „Cur Deus homo“
- Kritik an der Satisfaktionslehre
- Theologische Relevanz der Menschwerdung Gottes
- Sündenvergebung und Genugtuung
- Soziologische und theologische Aspekte der Satisfaktionslehre
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Das Kapitel bietet eine Einordnung des Werkes „Cur Deus homo“ in die erste Periode der Scholastik und erklärt wichtige Begriffe wie Sünde, Auferstehung und Satisfaktion.
- Kapitel 2: Das Kapitel stellt Anselms Werk „Cur Deus homo“ historisch und inhaltlich vor. Es werden die zentralen Argumente und die Struktur des Textes erörtert, um die wichtigsten Thesen zu beleuchten.
- Kapitel 3: Dieser Teil analysiert relevante Sekundärliteratur zur Satisfaktionslehre. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Kritik an Anselms Argumenten untersucht.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Satisfaktionslehre, „Cur Deus homo“, Anselm von Canterbury, Menschwerdung Gottes, Sündenvergebung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Theologie, Scholastik, Kritik, Sünde, Auferstehung, Erbsünde, Historische Einordnung, Soziologische und theologische Aspekte.
- Quote paper
- Aylin Sayin (Author), 2021, Anselms Satisfaktionslehre und ihre theologische Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1500758