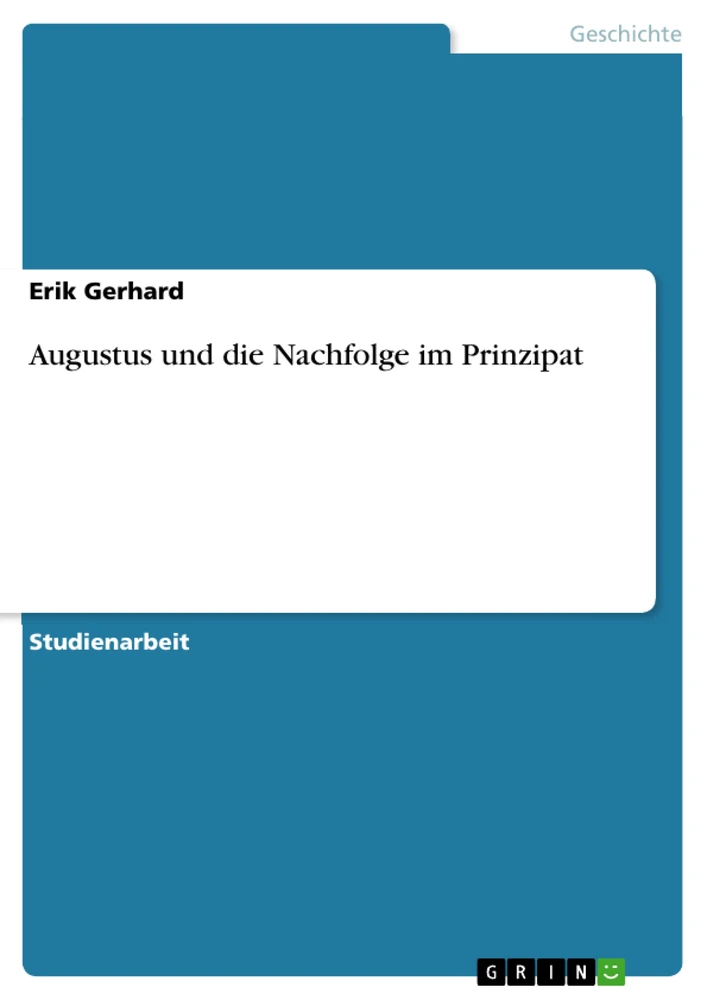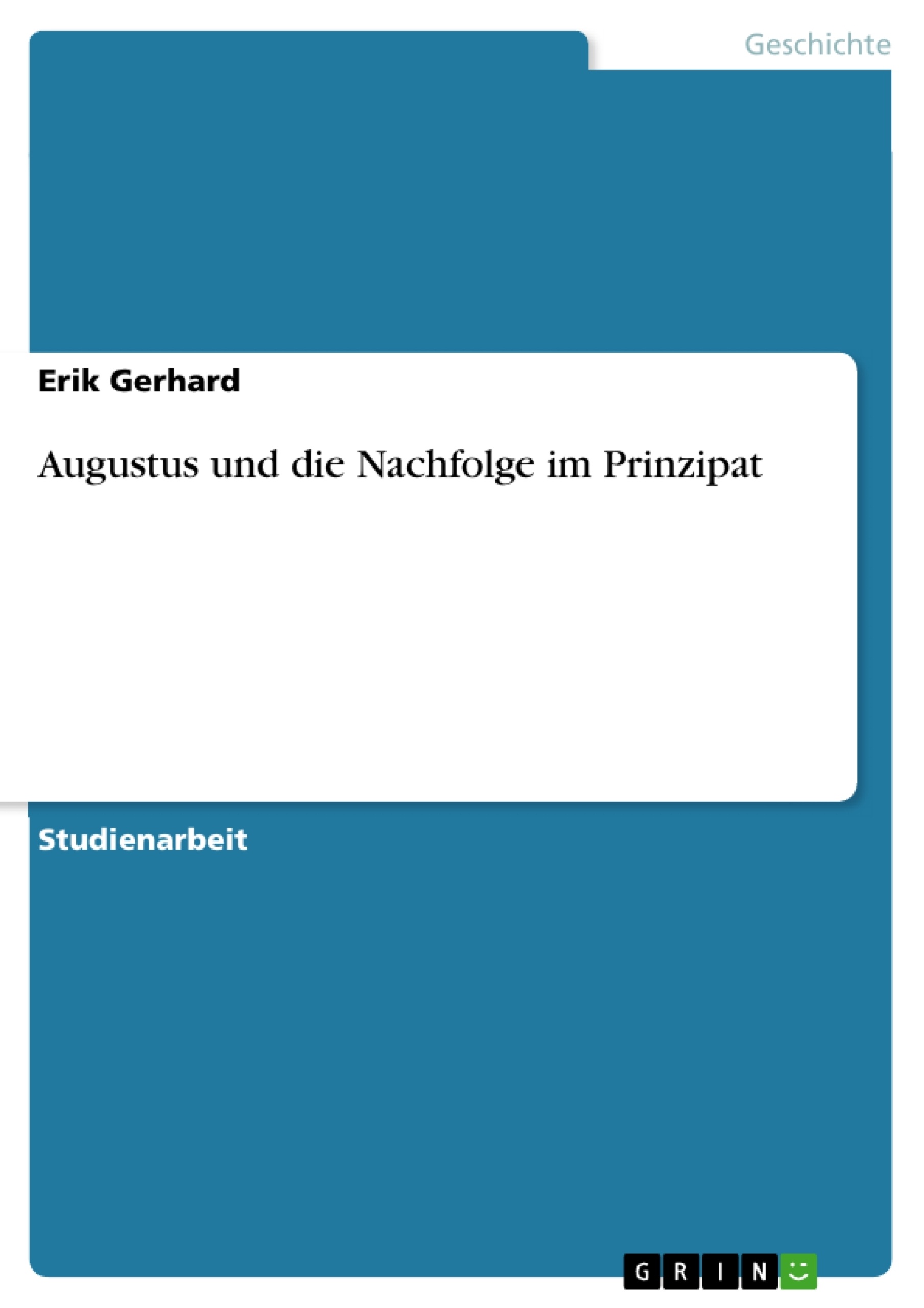Octavian, der Adoptivsohn Iulius Caesars, wurde in Rom als großer Friedensbringer gefeiert, da er die auf Caesars Ermordung (44 v. Chr.) folgenden Bürgerkriege beenden konnte. 27 v. Chr. gab Octavian die ihm vom Senat übertragenen Vollmachten zurück. Diese Handlung der demonstrativen Machtrückgabe würdigte der Senat, indem er dem siegreichen Feldherrn den Ehrennamen Augustus (der Erhabene) verlieh.
Theoretisch lag nun die Herrschaft über die von Augustus demonstrativ wiederhergestellte res publica wieder bei Senat und römischem Volk. Doch in der Folge wurden Augustus erneut eine Fülle von Ausnahmegewalten durch den Senat übertragen, die ihm zusammen mit zahlreichen Sonderregelungen eine Ausnahmestellung an der Spitze des Staates verschafften. [...] Das sogenannte Prinzipat bestand innerhalb der res publica restituta, denn Augustus' Ziel musste es sein, stets den Anschein der Republik zu wahren, die er sich ja rühmte wiederhergestellt zu haben.
Augustus lebte stark in aristokratischer Familientradition. [...] Er wollte, dass das von ihm geschaffene Prinzipat weiterhin Bestand haben würde, und zwar innerhalb seiner Familie, den Iuliern. Der Princeps beabsichtigte, die ihm ad personam verliehene Ausnahmestellung an einen Kandidaten aus seiner Familie weiterzugeben. Doch sein Bestreben war mit großen Schwierigkeiten verbunden, war doch das Prinzipat eine Ausnahmeregelung, die de iure nicht erblich, also nicht übertragbar war.
Die vorliegende Hausarbeit macht es sich zur Aufgabe, aufzuzeigen, wie Augustus dennoch versuchte, in seinem Sinne eine Nachfolgeregelung zu treffen. [...] Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beantwortung folgender Frage: Nach welchen Kriterien wählte Augustus seine Nachfolgekandidaten aus, und mit welchen Methoden versuchte er jeweils, eine reibungslose Machtübergabe zu ermöglichen?
Dazu wird zunächst knapp das Wesen des Prinzipats dargestellt und seine Besonderheit im Hinblick auf die Nachfolgeproblematik herausgearbeitet. Es folgt ein kurzes Kapitel über die Optionen, die dem Princeps offenstanden, um seine Macht an einen Nachfolger weiterzugeben. Der letzte Abschnitt widmet sich dann ausführlich der Nachfolgepolitik des Augustus und der Beantwortung oben genannter Fragestellung. Abschließend wird ein Fazit nochmals die wesentlichen Aspekte der Hausarbeit resümieren. Als zentrale Quellen dient die Historia Romana von Velleius Paterculus, die Kaiserviten Suetons, die Annalen von Tacitus und das Geschichtswerk des Cassius Dio.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wesen des Prinzipats – Augustus' Ausnahmestellung
- Die Schwierigkeit der Nachfolgegestaltung - Augustus' Optionen
- Die Nachfolgepolitik des Augustus
- Marcellus, Agrippa und die Krise des Jahres 23 v. Chr.
- Gaius und Lucius – Das Prinzipat den Iuliern
- Die Adoption des Tiberius: Ein Claudier soll die Nachfolge antreten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Nachfolgepolitik des römischen Kaisers Augustus und untersucht, wie er versuchte, das von ihm geschaffene Prinzipat innerhalb seiner Familie zu festigen.
- Die Besonderheiten des Prinzipats und seine Herausforderungen in Bezug auf die Nachfolge
- Die verschiedenen Optionen, die Augustus zur Weitergabe seiner Macht hatte
- Die Kriterien, nach denen Augustus seine Nachfolgekandidaten auswählte
- Die Methoden, mit denen er eine reibungslose Machtübergabe zu ermöglichen suchte
- Die Rolle von Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius und Tiberius als potentielle Nachfolger
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Wesen des Prinzipats und zeigt die besondere Position von Augustus als Princeps auf. Es wird deutlich gemacht, dass die vom Senat verliehenen Ausnahmegewalten und die öffentliche Anerkennung seiner Verdienste, seine auctoritas, Augustus eine einzigartige Stellung an der Spitze des Staates verschafften.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, die Augustus bei der Gestaltung der Nachfolge hatte, da das Prinzipat zwar faktisch, aber nicht rechtlich erblich war. Es werden die Optionen erörtert, die ihm offenstanden, um seine Macht weiterzugeben.
Der dritte Teil widmet sich ausführlich der Nachfolgepolitik des Augustus. Es werden die verschiedenen Kandidaten, wie Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius und Tiberius, vorgestellt und deren Rolle als potentielle Nachfolger beleuchtet. Die Analyse der Nachfolgepolitik konzentriert sich auf die Kriterien und Methoden, die Augustus bei der Auswahl und Etablierung seiner Nachfolger anwendete.
Schlüsselwörter
Prinzipat, Augustus, Nachfolge, Erblichkeit, Machtübergabe, Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius, Tiberius, auctoritas, res publica, imperium proconsulare, tribunicia potestas.
- Quote paper
- Erik Gerhard (Author), 2010, Augustus und die Nachfolge im Prinzipat, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/150065