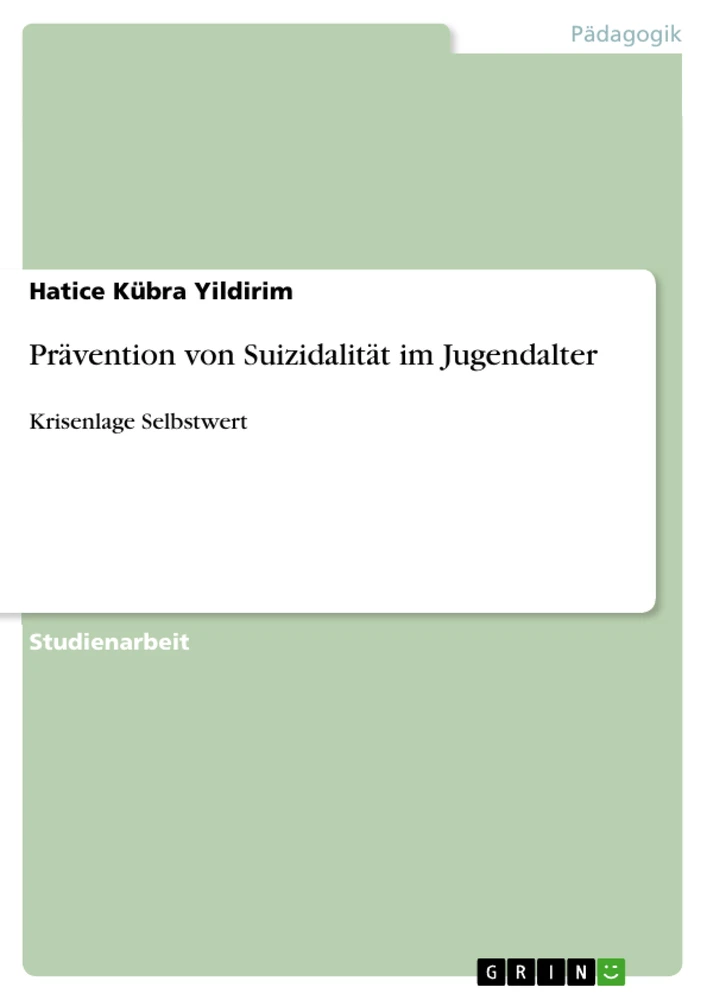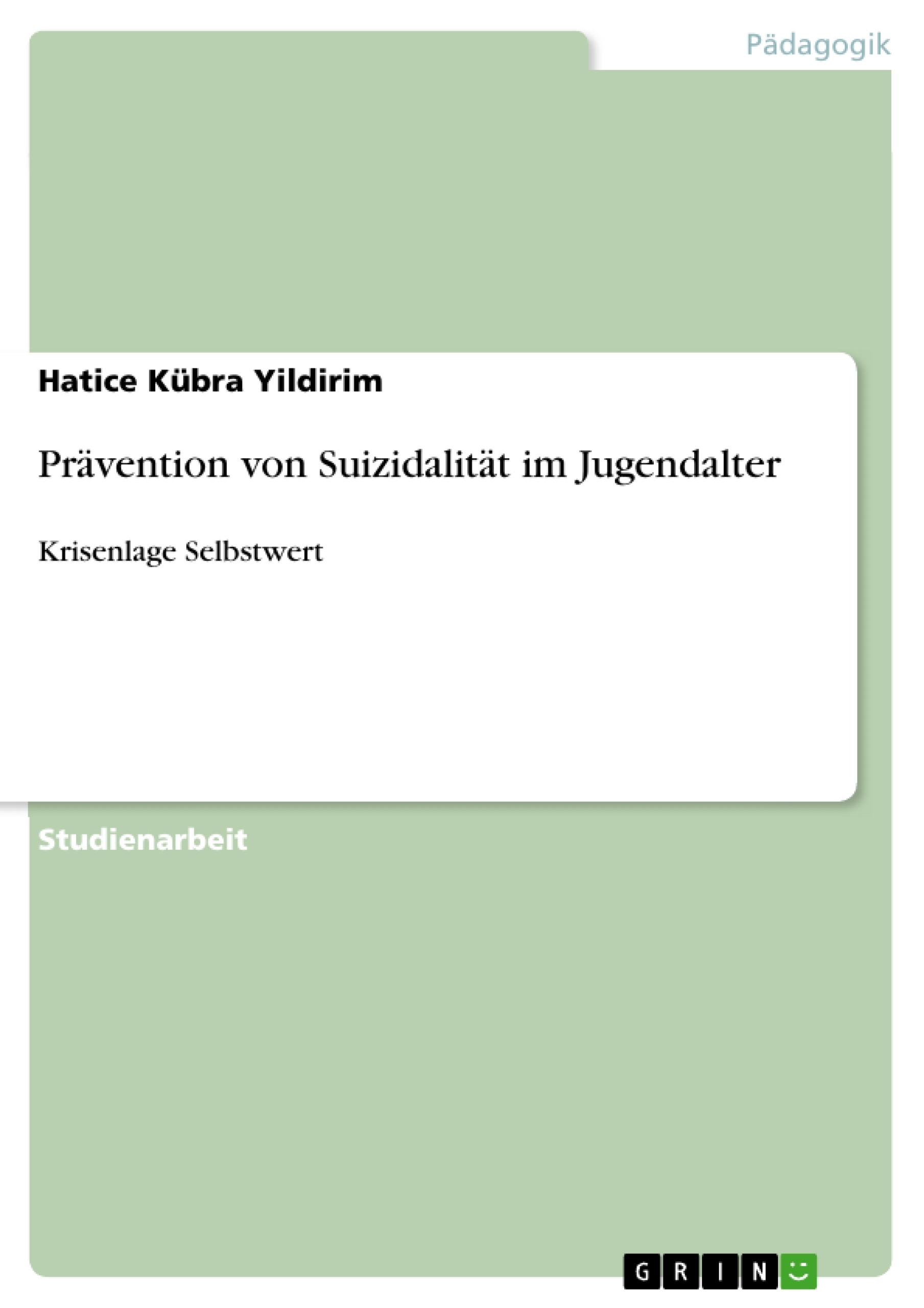Ziel dieser Arbeit ist es, ein Bewusstsein für die vulnerable Lebensphase der Adoleszenz zu gewinnen und im Umgang mit ihr eine gewisse Aufmerksamkeit und Sensibilität im sozialen Leben zu zeigen. Der Grund dafür ist unter anderem, die Ursachen einer Suizidalität sowie Ursachen der Defizite des Selbstwertgefühls zu kennen und bei Gelegenheit entsprechend zu intervenieren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Adoleszenz
2.2 Suizidalität
3 Suizidalität bei Adoleszenz: Ursachen und Risikofaktoren
4 Prävention von Suizidalität
4.1 Hinweise aufAdoleszenzkrise
4.2 Krisenintervention: „ BELLA -System“
4.3 Selbstwertgefühl
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Der Adoleszenz ist eine besondere Phase des Menschen, in der er sich auf das Erwach-senwerden vorbereitet. In dieser neuen Phase des Lebensabschnitts steigen daher die Er-wartungen und Verantwortungen an diesen. Diese Erwartungen der Gesellschaft können von den jungen Menschen als etwas herausfordernd empfunden werden, die sogar für manche etwas mehr belastend werden, wodurch ein Versagen unausweichlich werden kann (vgl. Bründel 2004, 21). Darüber hinaus ist diese als eine vulnerable Phase be-kannt, in der die Adoleszenz für unterschiedliche psychische Probleme tendiert sei (vgl. Groen/Petermann 2002, 87). Hinzu kommt, dass Jugendliche oft verunsichert und mit ihrem gegenwärtigen Leben nicht zufrieden sind. In dieser schwierigen Entwicklungs-phase begegnen Jugendliche zudem durch mediale Vermittlung, dass das Leben in ihren Händen liegt und freiwillig beendet werden kann (vgl. Bründel 2004, 33). Aus diesem Grund erscheine die Selbsttötung als eine mögliche Alternative, die freiwillig entschie-den werden kann. Damit Jugendliche nicht so weit kommen und den Suizid als best-mögliche oder einzige Alternative für die Befreiung der individuellen Konflikte, Belas-tungen oder Krisen betrachten, ist es notwendig, dass sie lernen, wie sie mit eventuellem Versagen umgehen können.
Zudem zeigen Studien der World Health Organization (WHO), die Anfang des 21. Jahrhunderts durchgeführt wurden auf, dass früher Suizide bei älteren Menschen am häufigsten vorkamen (vgl. ebd., 46). Jedoch stellt die Studie beim Vergleich der Suizid-raten bei Altersgruppen fest, dass die Tendenz der jüngeren Menschen, die sich das Le-ben nehmen, im Vergleich zu frühen Suizidstatistiken, die Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden, immer weiter steigt (vgl. ebd.). Es stellt sich hieraus zunächst die Frage, weshalb Jugendliche nun häufiger Suizid begehen als früher. Außerdem ist auch erforschungswert, wie dies vorgebeugt werden kann.
Laut Bründel (ebd., 37) erfolgt ein Suizid nicht aus vollkommener Lebensunlust, son-dern aus Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation und vor allem fehlender Zuver-sicht, diese zu ändern. Diese Erkenntnis von Bründel hat mich in unserer Gruppenarbeit über Suizidalität im Jugendalter besonders interessiert.
Daraus hat sich für mich die Frage gestellt, weshalb es suizidalen Jugendlichen nicht ge-lingt, sich aus der gegenwärtigen negativen Situation und Trauer zu befreien. Was fehlt diesen jungen Menschen, die noch am Anfang ihres Lebens sind und ob und wie ihnen geholfen werden kann.
Es ergibt sich hinsichtlich der Thematik folgende Forschungsfrage, die von Bedeutung ist: Wie kann Jugendlichen das Selbstwertgefühl vermitteln werden, damit sie nicht in eine Krisensituation geraten und wie kann ihnen geholfen werden, wenn sie sich in ei-ner solchen Krise befinden und nicht mehr leben wollen? Zunächst werden wesentliche Begriffe definiert, als Nächstes werden die Ursachen und Risikofaktoren für Suizide bei Jugendlichen dargestellt. Anschließend wird untersucht, welche Präventions- und Inter-ventionsmöglichkeiten es gibt, um sie aus dieser Krise zu befreien. Letztendlich wird das Selbstwertgefühl der Adoleszenz thematisiert, um zu erkennen, inwiefern ein Ver-hältnis zwischen Selbstwertgefühl und Suizidalität besteht. Zudem wird auch dargelegt, wie das Selbstwertgefühl der Adoleszenz gestärkt werden kann, um einer Suizidalität möglichst vorzubeugen.
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Bewusstsein für die vulnerable Lebensphase der Adoles-zenz zu gewinnen und demnach im Umgang mit ihr eine gewisse Aufmerksamkeit und Sensibilität im sozialen Leben zu zeigen. Der Grund dafür ist unter anderem, die Ursa-chen einer Suizidalität sowie Ursachen der Defizite des Selbstwertgefühls zu kennen und bei Gelegenheit entsprechend erfolgreich zu intervenieren.
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Adoleszenz
Der Fachausdruck Adoleszenz wird in der internationalen Jugendforschung verwendet und bezieht sich insbesondere auf entwicklungspsychologische Veränderungen in der Jugendphase (vgl. Bründel 2004, 18). Die Psychologen Rolf Oerter und Leo Montada teilen diese Phase in drei Zeitabschnitte ein: die frühe Adoleszenz zwischen 11 und 14 Jahren, die mittlere Adoleszenz zwischen 15 und 17 Jahren und die späte Adoleszenz zwischen 18 und 21 Jahren (vgl. ebd.).
Nichtsdestotrotz sei nach Bründel (2004, 18.) eine pauschale Abgrenzung zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenalter nicht klar definierbar, da der Beginn des Erwachse-nenalters individuell sei und daher variiere. Er meint also mit dem Beginn des Erwach-senwerdens nicht das Alter, sondern die Übernahme der großen Verantwortungen im Leben, wie der Beginn der beruflichen Tätigkeit oder die Eheschließung. Dies könne nach Bründel (ebd.) bereits mit achtzehn, zwanzig, fünfundzwanzig oder sogar später erworben werden.
Darüber hinaus wird die Jugendzeit auch biologisch definiert, die als Pubertät mit der Erreichung der Geschlechtsreife bekannt ist. Bei den Mädchen beginnt die Pubertät be-ziehungsweise die biologische Jugendzeit mit der ersten Menstruation und bei den Jun-gen mit der ersten Pollution. Des Weiteren wird die Jugendzeit auch durch soziale und kulturelle Gesichtspunkte beeinträchtigt, wodurch eine weitere Definition abgeleitet werden kann (vgl. ebd.).
In der vorliegenden Arbeit wird die Jugendzeit auf die sogenannte Adoleszenz nach Oerter und Montada beschränkt. Es wird aber nicht nur ein Zeitabschnitt ihrer Abgren-zung behandelt, sondern die drei Abschnitte werden als ein Ganzes betrachtet. Die Be-griffe Adoleszenz und Jugendliche werden in dieser Arbeit kontinuierlich als Synonym verwendet.
2.2 Suizidalität
Der Begriff „Suizid“ wird aus dem lateinischen Wort „ sui cadere “ (sich töten) und „ sui cidium “ (Selbsttötung) hergeleitet (vgl. ebd., 37). In der deutschen Literatur wurden im 20. Jahrhundert verschiedene Begriffe wie „Selbstvernichtung“, „Selbsttötung“, „Selbst-mord“ oder „Freitod“ für den Suizid verwendet (vgl. ebd.). Diese und weitere Begriffe, die für den Suizid gebraucht wurden, haben nach Bründel (ebd., 38) Interpretationsmög-lichkeiten. Er meint, dass jeder dieser Ausdrücke unterschiedliche Wahrnehmungen er-zeugt; sie seien entweder verurteilend, wie der „Selbstmord“ verbietend, wie die „Selbstvernichtung“, glorifizierend, wie der „Freitod“ oder neutral, wie der „Suizid“.
Es gibt auch unterschiedliche Suizidarten und dementsprechend verschiedene Motivati-onen und Ziele, welche in Bründels Werk präzise definiert werden. Auf die Suizidarten wirdjedoch nicht eingegangen, da dieses den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
In diesem Kapitel wurde der Ausdruck „Suizid“ erläutert, nun wird im nächsten Kapitel die Suizidalität in der Adoleszenz untersucht.
3 Suizidalität bei Adoleszenz: Ursachen und Risikofaktoren
Es kann vielerlei Gründe geben, weshalb eine Person suizidal ist oder sein kann und welche durchaus ganz verschieden und individuell sein können. Nichtsdestotrotz wäre es an dieser Stelle erforderlich, eine Feststellung von Helga Käsler und Brigitte Niko- dem (1996, 77) hervorzuheben, und zwar dass die meisten Suizide nicht per se aus Ver-langen nach dem Tode zustande kommen, sondern den Tod als Zuflucht betrachten, um nicht mehr in dem augenblicklichen Zustand leben zu müssen. In diesem Kapitel wer-den folglich die grundsätzlichen Feststellungen der Ursachen angesprochen, die bei Adoleszenz zu der Zuflucht vor sich führen und mit einer Suizidhandlung enden kön-nen. Für diese Untersuchung werden hauptsächlich Bründels Werk Jugendsuizidalität und kalutogenese und Gernot Sonnecks Werk Krisenintervention und duizidverhülung zugrunde liegen.
Bründel (2004, 36) unterscheidet im Grunde bei Suizidhandlungen zwischen Ursache und Anlass. Er stellt die These auf, dass die Ursachen für einen Suizid weiter zurücklie-gende Einflussfaktoren seien, wobei sich der Anlass der Handlung auf aktuelle Ereignis-se beziehe. Um die Ursache näher zu beleuchten, geht er in die Entwicklungsphase der Adoleszenz zurück. An dieser Stelle erwähnt er Hillavi Aro, Vilma Häninnen und Olavi Paronen, die darin übereinstimmen, dass die fehlende soziale und emotionale Beziehung den größten Risikofaktor für die Entwicklung der Adoleszenz bildet. Dies führe auch dazu, dass die Adoleszenz bei der Bewältigung von Belastungen erhebliche Schwierig-keiten bekomme und zu psychosomatischen Symptomen tendiere (vgl. ebd., 57). Daraus lässt sich verstehen, dass nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche für ihre mentale Gesundheit, soziale und emotionale Nähe bedürfen.
Diese fehlenden sozialen und emotionalen Beziehungen bei der Entwicklung der Ado-leszenz sind nach Bründel (ebd.) auch Risikofaktoren für die Entwicklung von Suizida-lität. Als weitere mögliche Risikofaktoren erwähnt er die vielfältigen Belastungen, wel-che durch Schule, Familie und im Freizeitbereich verursacht werden (vgl. ebd., 93).
In dieser Hinsicht betont Bründel die Belastungen, die durch die Familie hervorgerufen werden. Hierzu weist er auf die dauerhaften gestörten Beziehungsstrukturen und Kom-munikationsmuster ebenso wie die negativ geprägte Familienatmosphäre hin. Zu der ne-gativ geprägten Familienatmosphäre zählt er die Gleichgültigkeit, Ablehnung, Vernach-lässigung und Feindseligkeit. Ferner seien der Missbrauch und die Misshandlung von Jugendlichen in der Familie eine Triebfeder, die die Zuversicht, Hoffnung sowie den Lebenswillen der jungen Menschen zerstöre (vgl. Bründel 2004, 93). Außerdem können diese Faktoren der gestörten Beziehungsstruktur zu Stress führen, die schulische Versa-gen und Überforderungen hervorrufe, welche das Selbstwertgefühl der Betroffenen be-einflusse. Dementsprechend ist das Selbstwertgefühl des Individuums deutlich hervor-zuheben, da nach Bründel (ebd.) ein negatives Selbstbild Flucht von sich selbst verlan-ge. Es könne ergo der Auslöser einer Suizidhandlung sein, wenn der Jugendliche über keine Kommunikationsmöglichkeiten verfüge. Infolgedessen lässt sich schlussfolgern, dass ein gesundes Selbstwertgefühl des Individuums, in diesem Fall die der Adoleszenz essenziell ist, um sich vor selbstschädigenden Trieben beziehungsweise vor der Suizida-lität zu schützen.
Im folgenden Kapitel wird deshalb auf diesen Aspekt genauer im Detail eingegangen, wie das Selbstwertgefühl der Adoleszenz gestärkt werden kann, um Suizidalität vorzu-beugen. Zudem wird noch untersucht, welche Präventions- und Interventionsmöglich-keiten für eine Suizidalität erforscht wurden und inwiefern diese in der Praxis Erfolge erzielen.
4 Prävention von Suizidalität
4.1 Hinweise aufAdoleszenzkrise
Im vorherigen Kapitel wurden die grundsätzlichen Ursachen und Risikofaktoren anhand Bründels Werk zusammenfassend angesprochen. Nachdem ein Blick auf die wichtigsten Ursachen der Suizidalität geworfen wurde, werden in diesem Kapitel bedeutende Rat-schläge der Psychologinnen herangeführt, um ein suizidales Handeln möglichst vorzu-beugen. Zunächst sollte eine Feststellung der Psychologinnen betont werden, dass es keineswegs möglich sein wird, Suizide uneingeschränkt zu verhindern. Jedoch gebe es die Gelegenheit, sie möglichst zu reduzieren.
Das erfordere dabei die Voraussetzung, die Suizidalität des Betroffenen frühzeitig zu er-kennen (vgl. Berger [et al.] 2012, 61). Doch um einen Suizid möglichst vorzubeugen, muss zunächst erkannt werden, dass eine Gefährdung vorhanden ist. Die Gefährdung ist erkennbar, wenn man auf gewisse Anzeichen aufmerksam wird. Psychotherapeutinnen, wie Gernot Sonneck besagen, dass einer der gefährdendsten Hinweise die Suizidankün-digungen sind (vgl. Sonneck 2016, 160). Zudem zählt er weitere Personengruppen auf, die ebenfalls als gefährdet eingestuft werden. Diese benennt er der Reihenfolge nach als Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängige, Depressive, Vereinsamte, Suizidan-kündigende und solche, die einen Parasuizid1 begangen haben (vgl. ebd., 161). Diese sind äußerliche Merkmale, die auf eine Suizidalität hinweisen können. Ebenso ist es es-senziell auf Hinweise achtsam zu werden, die nicht unmittelbar auf eine Gefährdung hindeuten. Der Grund dafür ist, dass es zahlreiche Suizidfälle gibt, die nicht von den vorher benannten, markanten Anzeichen betroffen sind. Laut Sonneck (ebd., 230) steht nämlich die Suizidgefährdung in einem engen Zusammenhang mit psychosozialen Kri-sen. Außerdem seien Krisen einer der Hauptgründe für den Anstieg der Suizidraten im Jugendalter, die mit den psychischen und physischen Veränderungen in dieser Lebens-phase in Verbindung stehe (vgl. Käsler/Nikodem 1996, 112). Daraus lässt sich unter an-derem verstehen, dass diese Krise nicht umgehend erkennbar ist, wenn der Betroffene nicht mit den oben erwähnten Personengruppen in Verbindung steht. Das heißt, eine Person kann unter einer psychosozialen Krise leiden, die zum Beispiel von jeglichem Suchtkonsum weitgehend entfernt liegt. Die Folgenden können weitere Anzeichen für eine Suizidalität sein: Plötzlicher Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten, Schulverweigerung, schlechte psychische Verfassung, Niedergeschlagenheit, Gereizt-heit, Lustlosigkeit, Energieverlust, Rückzug, Abbruch von Freundschaften, Rückzug in virtuelle Welt, Äußerungen über Gefühle der Ausweglosigkeit, Häufung von Unfällen und risikoreichem Verhalten, Selbstverletzung (vgl. Berger [et al.] 2020, 10). Darüber hinaus gebe es weitere Anzeichen, die als Warnsignal eingestuft werden. Diese sind, wenn der Betroffene viele Recherchen über den Tod macht und darüber nachdenkt. Dazu gehört auch das Verfassen von Texten und Gedichten sowie Zeichnungen zum Thema Tod. Daneben können Äußerungen von Suizidgedanken als Warnsignal erkannt werden. Ein weiteres Merkmal, welches als Alarmzeichen eingestuft wird, ist die ,,[p]lötzliche Ruhe oder Gelöstheit nach einer Krisenphase, ohne dass sich die Situation erkennbar verändert hätte, [könne] darauf hinweisen, dass jemand kurz vor dem Suizid-versuch steht“ (ebd.).
Daraus folgt, dass es sehr voneinander variierende Anzeichen gibt, die auf eine Adoles-zenzkrise hindeuten. Krisensituationen zu erkennen und sie zu bewältigen, ist in diesem Zusammenhang obligatorisch, da Krisen laut Bründel (2004, 122) meistens in Suizid-versuchen oder vollendeten Suiziden enden.
4.2 Krisenintervention: ,, BELLA -System“
Es gibt verschiedene Alternativen, bei einem möglichen Suizid zu intervenieren, um ihn zu verhindern. In diesem Kapitel wird ein bestimmtes Konzept beschrieben, wie bei ei-ner Krise interveniert werden kann. Dieses beschreibt Sonneck (2016, 105 f.) in seinem bereits erwähnten Werk als das sogenannte „ BELLA -System“. Dieses Interventionskon-zept dient als ein Erstkontakt mit einer Person, die sich in einer akuten Krise befindet. Jeder einzelne Buchstabe des Wortes „ BELLA “ steht für eine Anleitung, wie mit dem Betroffenen umzugehen ist. Der erste Buchstabe ,,B“ steht für „ Beziehung aufbauen “ (ebd., 106). Es sei ratsam, mit dem Betroffenen ins Gespräch zu kommen und ihm auf-merksam sowie empathisch zuzuhören. Dabei sei es wichtig, der Person zu zeigen, dass man sie ernst nimmt und ihre Schwierigkeit nachvollziehen kann. Der nächste Buchsta-be „E“ steht für „ Erfasse die Situation “ (ebd., 107). Damit werden die Gründe für die Krise erfragt und inwiefern diese die momentane Lebenssituation beeinträchtigen. Fol-gend beschreibt der Buchstabe „L“ die „ Linderung der schweren Symptomatik “ (ebd.). An dieser Stelle wird auf den emotionalen Zustand des Betroffenen eingegangen. Es soll dabei die Lage verstanden und versucht werden, die Schmerzen zu lindern. Zudem werden Entspannungsübungen durchgeführt, um ihn zusätzlich entlasten zu können. Anschließend steht das nächste „L“ für „ Leute ein [zu] beziehen, die unterstützen “ (ebd., 108). Die Betroffenen werden gefragt, welche Bezugsperson(en) sie einbeziehen möch-ten. Bei Bedarf können auch Selbsthilfegruppen oder Hilfsinstitutionen angeboten wer-den. Abschließend steht der letzte Buchstabe „A“ dafür, den Ansatz zur Problembewäl-tigung zu finden (vgl. ebd.). Hier wird versucht, das tatsächliche Problem zu definieren und die Widersprüchlichkeiten zu erkennen. Es sollen auch das Problem an sich und sei-ne emotionale Bedeutung aufgegriffen werden. Darüber hinaus soll sich für eine Ände-rung entschieden werden.
Dieses Interventionskonzept soll unmittelbar als erste Maßnahme bei einer akuten Krise angewendet werden.
Nachdem dieser Schritt getroffen ist, können im nächsten Schritt die Entwicklung des Selbstwertgefühls sowie des Selbstvertrauens ermöglicht werden (vgl. Sonneck 2016, 109). Darauf wird im folgenden Kapitel eingegangen.
4.3 Selbstwertgefühl
Die Adoleszenz wird als die „wesentlichste und sensibelste Phase“ (Groen/Petermann 2002, 91) eingestuft, in der sich die Identität entwickle und konsolidiere. Für die Bil-dung der Identität sei das Selbstwertgefühl der wesentlichste Bestandteil (vgl. ebd.). Das positive Selbstwertgefühl sei laut Psychotherapeutinnen für die mentale Gesundheit und die allgemeine Zufriedenheit des Menschen unerlässlich, da sämtliche Probleme oder Störungen der Klientinnen mit dem Mangel an Selbstwert in Verbindung stehen (vgl. Potreck-Rose/Jacob 2013, 11; Prandini 2001, 205). Das negative Selbstbild stellt nicht nur ein Problem für das psychische Wohlbefinden dar, sondern könne zum Anlass des Suizids werden (vgl. Lemper-Pychlau 2015, 12). An dieser Stelle lässt sich die Fra-ge stellen, wie sich das Selbstwertgefühl des Menschen überhaupt bildet und ob er selbst einen Einfluss auf die Bewertung des Selbst hat. Im Folgenden wird dies näher beleuchtet.
Nach der Psychologin Marion Lemper-Pychlau (ebd.) bildet sich das Selbstbild durch die Rückmeldungen aus dem Umfeld. Daraus kann entnommen werden, dass die Fami-lie diesbezüglich im Vordergrund steht, da die ersten Rückmeldungen durch die Familie erhalten werden, woraus das Selbstbild entsteht. Dies bestätigt auch Markus Prandini (2001, 206), denn er erklärt, dass das Selbstwertgefühl sich bereits im frühsten Kind-heitsalter entwickle, welches durch den Umgang der Eltern geprägt sei. Laut Lemper- Pychlau (2015, 12) können Eltern unbewusst den Selbstwert des Kindes senken, indem sie ihren Kindern mit negativen Kommentaren entgegnen. Daraus lässt sich die Schluss-folgerung ziehen, dass die Eltern für einen gesunden Selbstwert ihres Kindes in Verant-wortung stehen und daher bei ihren Aussagen und Kommentaren sensibler und ver-ständlicher sein müssen.
Darüber hinaus erwähnt Matthias Jerusalem die Schule sowie die Verhaltensweise und den Umgang der Lehrkräfte ebenfalls als einen Faktor, der den Selbstwert von Jugendli-chen beeinflusst (vgl. Merkens [et al.] 1997, 96). Auch Prandini (2001, 209) deutet auf die Relevanz der wertschätzenden Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen für das positive Selbstbild des Jugendlichen hin.
Aus diesen Erkenntnissen lässt sich deduzieren, dass der Aufbau des Selbstwerts zu-nächst als Kleinkind in der Familie durch die Eltern beginnt und sich später in der Schu-le durch Lehrkräfte mit dem bisher geprägten Selbstwert weiterentwickelt.
Zusammengefasst bildet sich das Selbstbild aus sämtlichen Rückmeldungen durch das Umfeld. Jedoch fallen diese Rückmeldungen oder Meinungen nicht immer positiv aus (vgl. Lemper-Pychlau 2015, 12), sodass sich ohne weiteres ein positives Selbstbild ent-wickelt. Nichtsdestotrotz sind negative Meinungen aus dem Umfeld nicht vermeidbar, welches zu Selbstzweifeln führen kann. Lemper-Pychlau (ebd., 14) ist der Ansicht, dass der Selbstzweifel nicht das eigentliche Problem sei, sondern der Umgang damit. Außer-dem behauptet sie, dass es anderen Menschen nicht möglich sei, das Selbstwertgefühl des anderen zu stärken (vgl. ebd.). Hieraus lässt sich resultieren, dass man in der Ado-leszenz selbstständig lernen muss, wie man mit seinem Selbstbild umgeht. Auch Lem-per-Pychlau (ebd., 15) erklärt, dass für die Stärkung des Selbstwertgefühls Eigenleis-tung erforderlich sei, zu der sie Hinweise gibt. Diese Eigenleistung zur Stärkung des Selbstwertgefühls sei möglich, wenn bewusst mit der eigenen Emotionalität umgegan-gen wird (vgl. Prandini 2001, 214). Jedoch muss wiederum erlernt werden, wie man ein Bewusstsein für die eigene Emotionalität entwickelt. Nach Prandini (ebd., 212-216) kann dies in der Schule durch die Lehrkräfte gefördert werden. Er beschreibt Methoden und erklärt gewisse Konzepte, welche Lehrkräfte in ihren Lehrplänen für ein positives Klassenklima nutzen können, welches für die Stärkung des Selbstwertgefühls des Ju-gendlichen erforderlich sei. Demnach seien durch die Lehrkräfte „Risikofaktoren wie übermäßig hoher Leistungsdruck, ungesundes Konkurrenzverhalten zwischen den Schü-lern, Mangel an sozialer Geborgenheit und hohe Regellosigkeit“ (ebd., 265) zu mini-mieren, um für ein positives Arbeitsklima zu sorgen und damit auch zum Selbstwertge-fühl beizutragen (vgl. ebd.). Hieraus folgt, dass Lehrkräfte ebenfalls eine gewisse Ver-antwortung für die Selbstwertbildung des Schülers tragen, da sie diese durch den Unter-richt und das Arbeitsklima wesentlich beeinflussen können.
Darüber hinaus fördern die Rückmeldungen der Lehrkräfte ebenfalls den Selbstwert des Jugendlichen. Prandini (ebd., 215) zufolge seien hierbei wertschätzende Rückmeldung auf die Leistungen oder die Person2 wirksam. Die Bedingung sei, dass sie auch wahr und evident sein müsse, andernfalls verliere die Rückmeldung an Bedeutung und sei nicht fördernd. An dieser Stelle ist ein weiteres Mal anzumerken, dass Lehrkräfte das Selbstwertgefühl ihrer Schülerinnen mit ihren Rückmeldungen prägen können.
Des Weiteren beschreibt Prandini prägnante Methoden, die im Unterricht verwendet werden können, um das Selbstwertgefühl zu steigern. Einige dieser Methoden sind Un-terrichtskontexte, die eine gewisse Emotionalität beinhalten, wie zum Beispiel, (1.) das Lesen von emotionalen Texten und anschließend, die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. (2.) Zu einer bestimmten Thematik im Unterrichtskontext die eigenen Erlebnis-se, die die Schülerinnen emotional betreffen, zu erzählen. Auch Psychologinnen gehen davon aus, dass das Erzählen der eigenen Lebensgeschichten jedem guttun (vgl. Hesse/Schrader 2005, 36). (3.) Sie notieren ihre Sorgen und Ängste zu einer bestimmten Unterrichtsthematik und tauschen sich anschließend in Kleingruppen aus und suchen nach Lösungsansätzen (vgl. Prandini 2001, 216). Zudem entwirft er Fragen, welche an die Gefühle und Emotionen gerichtet sind, die Schülerinnen in Unterrichtskontexten für sich selbst beantworten sollen. Dies seien Übungen, um sich bewusst mit ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und damit ein vertieftes Verständnis für den eigenen Selbstwert zu erwerben.
5 Fazit
In dieser Arbeit wurde nachgewiesen, dass die Suizidalität der Adoleszenz in einem kausalen Zusammenhang mit Krisen und dem geringen Selbstwertgefühl steht. Der Grund dafür ist, dass Bründel von der Tatsache ausgeht, dass ein geringes Selbstwertge-fühl Flucht von sich selbst verlange und ergo der Auslöser einer Suizidhandlung sein könne. Aus diesem Grund wurde untersucht, welche Faktoren ein geringes Selbstwert-gefühl verursachen. Anhand dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass das Selbst-wertgefühl bereits im frühsten Kindesalter durch den Umgang der Eltern geprägt wird. In der späteren Lebensphase entwickle sich das Selbstwertgefühl mit dem bisher ge-prägten Selbstwert, in der Schule insbesondere durch Lehrkräfte, weiter. Dieser Er-kenntnis zufolge lässt sich sagen, dass Eltern und Lehrkräfte eine wesentliche Rolle bei der Prägung des Selbstwertgefühls spielen und demnach acht auf ihren Umgang geben müssen. Lemper-Pychlau betrachtet jedoch das Ganze aus einem anderen Blickwinkel und behauptet, dass der Selbstzweifel oder das geringe Selbstwertgefühl nicht das ei-gentliche Problem seien, sondern der Umgang damit. Außerdem sei es unmöglich, das Selbstwertgefühl des anderen zu stärken.
Es ist zunächst auffallend, dass die obige Auffassung, mit der von Lemper-Pychlau im Gegensatz steht. Jedoch ist es auch möglich, diese beiden Ansichten als eine gegenseiti-ge Ergänzung zu betrachten. Die beiden Meinungen können zueinander ergänzend sein, wenn die Eltern und die Lehrkräfte als Unterstützer der Jugendlichen im Umgang mit dem eigenen Selbstwertgefühl betrachtet werden. Dass dies auch möglich ist, konnte an-hand der Untersuchung nachgewiesen werden.
Um auf die Forschungsfrage zurückzukommen, wie ein Jugendlicher aus seiner Krise befreit werden kann, wurde ein bestimmtes Konzept, das sogenannte „ BELLA -System“ vorgestellt. Dieses kurzgefasste Kriseninterventionskonzept richtet sich vielmehr an Therapeutinnen, jedoch stellt sich hier die Frage, ob Fachleute es empfehlen würden, dass eine Bezugsperson des Betroffenen nach diesem Konzept handelt. Es wäre folglich keine professionelle Hilfe oder desgleichen, aber es könnte den Betroffenen möglicher-weise etwas unterstützen. Denn in diesem Konzept geht es lediglich darum, die erste Maßnahme zu ergreifen und zu zeigen, dass jemand an seiner Seite steht, ihn versteht und Hilfe gewähren möchte.
Die Untersuchung, wie Jugendlichen das Selbstwertgefühl vermittelt werden kann, zeig-te, dass für die Stärkung des Selbstwertgefühls Eigenleistung erforderlich ist, indem sie bewusst mit der eigenen Emotionalität umgehen. Jedoch zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit auch, dass Schule eine Initiative ist, welche das Selbstwertgefühl der Jugendli-chen sowohl beeinflussen als auch fördern kann. Es wurden Methoden vorgestellt, die Lehrkräfte ihn ihren Unterrichtskontexten einbauen können, um das Selbstwertgefühl der Schülerinnen zu stärken. Diese Methoden, auf die Prandini in seinem Werk im De-tail genauer eingeht, sind sehr hilfreiche Ansätze. Dabei stellt sich allerdings die Frage, inwiefern solche Methoden tatsächlich in der Praxis angewendet werden oder ob sie le-diglich als Theorie in der Wissenschaft verborgen bleiben.
Diese Arbeit kann keine endgültigen Antworten finden, daher bedarf es weiterer Unter-suchungen, wie innerhalb der Adoleszenz vermittelt werden kann, das Selbstwertgefühl zu stärken und wie Krisen bewältigt werden können. Es wäre auch nicht möglich, an-hand dieser Arbeit umfangreiche oder endgültige Antworten zu geben, da es unter ande-rem den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Ergebnisse dieser Arbeit beantwor-ten daher die Fragen ansatzweise im Kontext der Therapie, Schule und Familie.
Eine Fragestellung, die noch weiterer Untersuchungen bedarf ist, weshalb Jugendliche heutzutage häufiger Suizid begehen als früher.
Anhand der Feststellung Bründels, dass heutzutage Jugendliche medialen Einfluss ha-ben und dass es etwas Positives sei, das eigene Leben aus freier Entscheidung beenden zu können, lässt vermuten, dass es einen kausalen Zusammenhang geben könnte, wes-halb die Suizide nun einen Anstieg verzeichnen. Dies wäre ein interessantes Thema, welches zunächst für weitere Forschungen offenbleibt.
6 Literaturverzeichnis
Berger, GregorE. [etal.] (2012): Suizidprävention. Suizidalitätin derAdoleszenz. Warnzeichen erkennen und früh intervenieren, in: Pädiatrie, Jg. 3, Nr. 12, 57-62, [online] https://www.rosenfluh.ch/paediatrie-2012-03/suizidalitac2a4t-in-der-adoleszenz.
Berger, Gregor [et al.] (2020): Suizidalität im Jugendalter. Leitfaden für Schulen, in: Prävention von Gesundheitsförderung. Kanton Zürich, [online] https://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/_Resources/Persistent/ 1/5/2/8/152876e9cb917532f6f1d565b0198cefa72e1232/Suizidalita%CC%88t %20im%20Jugendalter_2021.pdf [abgerufen am 14.10.2021].
Bründel, Heidrun (2004): Jugendsuizidalität undSalutogenese. Hilfe und Unterstützung fürsuizidgefährdete Jugendliche, Stuttgart: VerlagW. Kohlhammer GmbH, 18-122.
Groen, Gunter/ Franz Petermann (2002): Depressive Kinder undJugendliche, in: Peter- mann, Franz (Hrsg.), Klinische Kinderpsychologie, Bd. 6, Göttingen [et al.]: Ho- grefe-Verlag GmbH & Co. KG, 87-91.
Hesse, Jürgen/ Hans Christian Schrader (2005): Selbstbewusstsein. Woher es kommt- wie man es stärkt und erfolgreich einsetzt, Frankfurt am Main: Eichborn AG.
Käsler, Helga/ Brigitte Nikodem (1996): Bitte hört, was ich nicht sage. Signale von Kin-dern und Jugendlichen verstehen, die nicht mehr leben wollen,, München: Kösel- Verlag GmbH & Co, 77-112.
Lemper-Pychlau, Marion (2015): Erfolgsfaktor gesunder Stolz. Wie Sie Ihre Selbstzwei- felloswerdenundlhrLebengenießen,Wiesbaden: Springer Gabler, 12-15.
Merkens, Hans [et al.] (1997): Familiale und schulische Einflüsse auf die Konstituie-rung des Selbst in der Jugendarbeit, in: Zeitschriftfür Pädagogik, 93-110.
Prandini, Markus (2001): Persönlichkeitserziehung und Persönlichkeitsbildung von Ju-gendlichen. Ein Rahmenmodell zur Förderung von Selbst-, Sozial- und Fach-kompetenz, in: Euler, Dieter/ PeterF. E. Sloane (Hrsg.), Wirtschaftspädagogi-sches Forum, Bd. 18, Paderborn: Eusl- Verlagsgesellschaft mbH, 205-2016.
Potreck-Rose, Friederike/ Gitta Jacob (2013): Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen. Psychotherapeutische Interventionen zumAufbau von Selbst-wertgefühl, 11. Aufl., Bd. 163, Stuttgart: Klett-Cotta.
Sonneck, Gernot [et al.] (2016): Krisenintervention undSuizidverhütung, 3. Aufl.,
Wien: Facultas Universitätsverlag, 105-230.
[...]
1 Unter dem Begriff Parasuizid wird der Suizidversuch verstanden (vgl. Sonneck 2016, 212).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text behandelt das Thema Suizidalität bei Adoleszenten. Er untersucht die Ursachen und Risikofaktoren, mögliche Präventions- und Interventionsmaßnahmen sowie die Bedeutung des Selbstwertgefühls.
Was versteht man unter Adoleszenz im Kontext dieses Textes?
Adoleszenz bezieht sich auf die Jugendphase, insbesondere auf entwicklungspsychologische Veränderungen. Der Text orientiert sich an der Einteilung von Oerter und Montada in frühe, mittlere und späte Adoleszenz, betrachtet diese jedoch als ein Ganzes.
Wie definiert der Text Suizidalität?
Der Begriff "Suizid" wird vom lateinischen "sui cadere" (sich töten) und "sui cidium" (Selbsttötung) abgeleitet. Der Text erwähnt verschiedene Begriffe wie "Selbstvernichtung", "Selbsttötung", "Selbstmord" oder "Freitod" und betont, dass jeder Ausdruck unterschiedliche Wahrnehmungen erzeugt.
Welche Ursachen und Risikofaktoren für Suizidalität bei Adoleszenten werden im Text genannt?
Der Text unterscheidet zwischen Ursache und Anlass. Zu den Ursachen zählen fehlende soziale und emotionale Beziehungen, Belastungen durch Schule, Familie und Freizeit. Insbesondere werden gestörte Beziehungsstrukturen, negative Familienatmosphäre, Missbrauch und Misshandlung als Risikofaktoren hervorgehoben.
Welche Präventionsmaßnahmen werden im Text diskutiert?
Der Text betont die Notwendigkeit, Suizidalität frühzeitig zu erkennen. Erwähnt werden Suizidankündigungen und Zugehörigkeit zu Risikogruppen (Alkohol-, Medikamenten-, Drogenabhängige, Depressive, Vereinsamte, Suizidankündigende, Parasuizid-Begangene). Auch psychosoziale Krisen, Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten, Schulverweigerung, Niedergeschlagenheit, Rückzug und Selbstverletzung werden als Warnsignale genannt.
Was ist das "BELLA-System" und wie funktioniert es?
Das "BELLA-System" ist ein Interventionskonzept für den Erstkontakt mit Personen in akuten Krisen. Jeder Buchstabe steht für eine Handlungsanweisung: Beziehung aufbauen, Situation erfassen, Linderung der schweren Symptomatik, Leute einbeziehen, die unterstützen, Ansatz zur Problembewältigung finden.
Welche Rolle spielt das Selbstwertgefühl bei Suizidalität?
Der Text betont die Bedeutung des Selbstwertgefühls für die Identitätsentwicklung und mentale Gesundheit. Ein negatives Selbstbild kann zu Flucht von sich selbst und somit zum Auslöser einer Suizidhandlung werden.
Wie wird das Selbstwertgefühl beeinflusst und wie kann es gestärkt werden?
Das Selbstbild wird durch Rückmeldungen aus dem Umfeld geprägt, insbesondere durch Familie und Schule. Eltern und Lehrkräfte spielen eine wichtige Rolle. Eigenleistung ist erforderlich, um bewusst mit der eigenen Emotionalität umzugehen. Schulen können durch ein positives Klassenklima und wertschätzende Rückmeldungen den Selbstwert der Jugendlichen fördern.
Welche Methoden können im Unterricht eingesetzt werden, um das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken?
Im Unterricht können Unterrichtskontexte, die eine gewisse Emotionalität beinhalten, wie zum Beispiel das Lesen von emotionalen Texten und anschließend, die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen; Zu einer bestimmten Thematik im Unterrichtskontext die eigenen Erlebnisse, die die Schülerinnen emotional betreffen, zu erzählen. Auch Psychologinnen gehen davon aus, dass das Erzählen der eigenen Lebensgeschichten jedem guttun (vgl. Hesse/Schrader 2005, 36). Sie notieren ihre Sorgen und Ängste zu einer bestimmten Unterrichtsthematik und tauschen sich anschließend in Kleingruppen aus und suchen nach Lösungsansätzen (vgl. Prandini 2001, 216). Zudem entwirft er Fragen, welche an die Gefühle und Emotionen gerichtet sind, die Schülerinnen in Unterrichtskontexten für sich selbst beantworten sollen. Dies seien Übungen, um sich bewusst mit ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und damit ein vertieftes Verständnis für den eigenen Selbstwert zu erwerben.
- Arbeit zitieren
- Hatice Kübra Yildirim (Autor:in), 2021, Prävention von Suizidalität im Jugendalter, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1488359