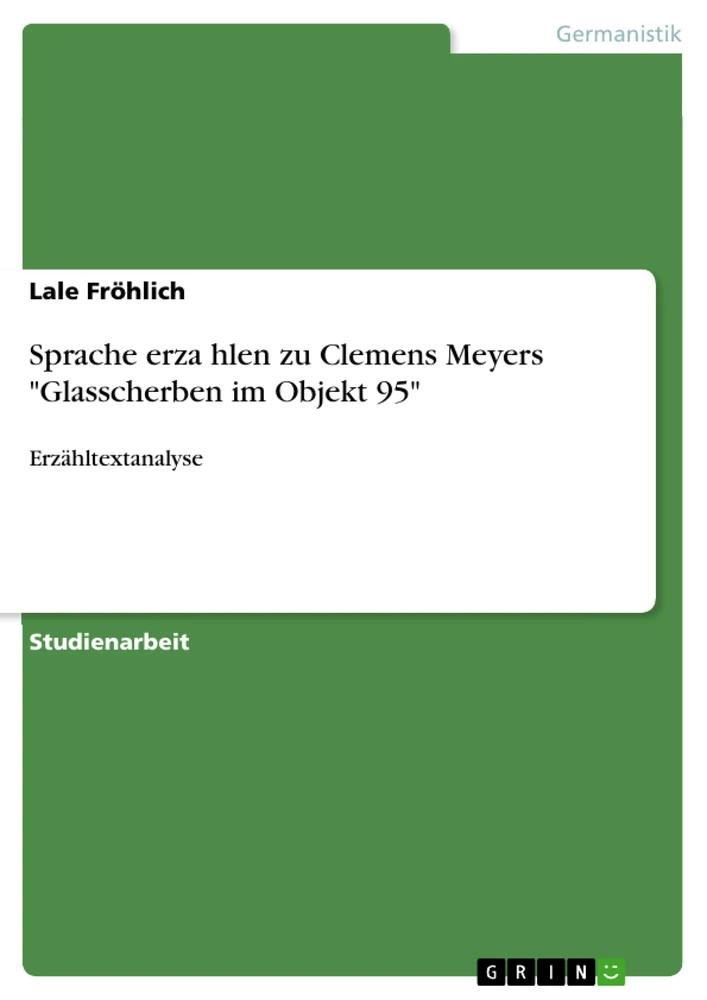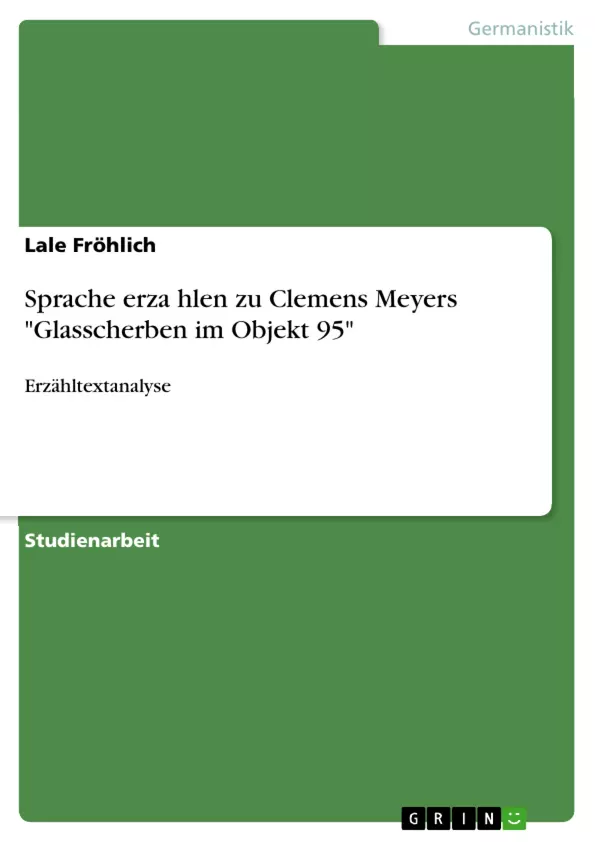Diese Erzähltextanalyse aus dem Seminar "Gegenwartsliteratur" untersucht das Werk „Glasscherben im Objekt 95“ von Clemens Meyer in Hinblick auf die Fokalisierung, Satzbau und Sprache sowie den Aspekt der interkulturellen Kommunikation. Außerdem werden Aspekte der sog. "Gegenwartsliteratur" herausgearbeitet und in die Analyse mit einbezogen.
Die besondere Sprache Clemens Meyers in seinem Werk Glasscherben im Objekt 95, eine Erzählung, die 2017 in dem Buch Die stillen Trabanten erschienen ist, bildet das Zentrum dieser Arbeit. Meyer schafft es, wie kaum ein anderer Autor der Gegenwart, dem Leser durch seine Sprache intensive Emotionen und Stimmungen zu vermitteln, und diesen somit seine Erzählungen nicht vergessen zu lassen. Ganz gleich welches seiner Werke man liest, sei es Die stillen Trabanten oder Glasscherben im Objekt 95, noch lange nach dem Ende der Erzählung lässt die behandelt Thematik einen nicht los, sodass die Geschehnisse noch lange nachhallen. Fakt ist, dass Clemens Meyers Erzählungen den interessierten Leser nicht unberührt lassen können. Mit dieser besonderen Erzählweise gehen sicherlich auch Probleme einher, welche es genauer zu beleuchten gilt. Durch Meyers komplexe Erzähltechniken gewinnen seine Werke zwar an Gehalt und Qualität, doch zeitgleich wird auch bei so manchem Leser für Irritationen gesorgt, welche beispielhaft an der zu untersuchenden Kurzgeschichte veranschaulicht werden können: Gerade im Hinblick auf die variierenden Zeitdimensionen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, welche innerhalb der Erzählung für den Leser schwer voneinander zu differenzieren sind, bietet die vorliegende Kurzgeschichte eine interessante Basis für Interpretationsansätze. Auch die Dialoge zwischen den beiden Protagonisten sind auf eine besondere Art und Weise dargestellt, was vor allem daher rührt, dass es sich bei diesen um eine Form der interkulturellen Kommunikation handelt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse und Interpretation
- Grundlegendes - Profilierung des Erzählers (Fokalisierung)
- Spezifika der Erzählweise Clemens Meyers - Satzbau und Sprache
- die Figurenrede - der Aspekt der interkulturellen Kommunikation
- Vergangenheit und Gegenwart
- Gegenwärtigkeit in der Gegenwartsliteratur
- Die Wirkung der Zeitdimensionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse und Interpretation der Sprache Clemens Meyers in seiner Erzählung „Glasscherben im Objekt 95“, die 2017 im Buch „Die stillen Trabanten“ erschien. Die Arbeit untersucht, wie Meyer durch seinen sprachlichen Stil intensive Emotionen und Stimmungen beim Leser erzeugt, die die Erzählung nachhaltig prägen.
- Spezifika von Clemens Meyers Erzählweise und deren Wirkung auf den Leser
- Der Einfluss von Satzbau und Sprache auf die Vermittlung von Emotionen und Stimmungen
- Die Rolle der Figurenrede in der interkulturellen Kommunikation
- Das Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart in der Erzählung
- Die Bedeutung der Zeitdimensionen für die Interpretation des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Erzählung „Glasscherben im Objekt 95“ von Clemens Meyer vor und erläutert die Besonderheiten seiner Sprache, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Im zweiten Kapitel wird die Erzählweise Meyers anhand von Satzbau und Sprache analysiert. Dabei wird besonders auf die Funktion der Figurenrede im Kontext der interkulturellen Kommunikation eingegangen. Kapitel 3 befasst sich mit der Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart in der Erzählung und untersucht die Wirkung dieser Zeitdimensionen auf die Interpretation.
Schlüsselwörter
Clemens Meyer, Glasscherben im Objekt 95, Erzählweise, Sprache, Satzbau, Figurenrede, interkulturelle Kommunikation, Zeitdimensionen, Vergangenheit, Gegenwart.
- Arbeit zitieren
- Lale Fröhlich (Autor:in), 2021, Sprache erzählen zu Clemens Meyers "Glasscherben im Objekt 95", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1485048