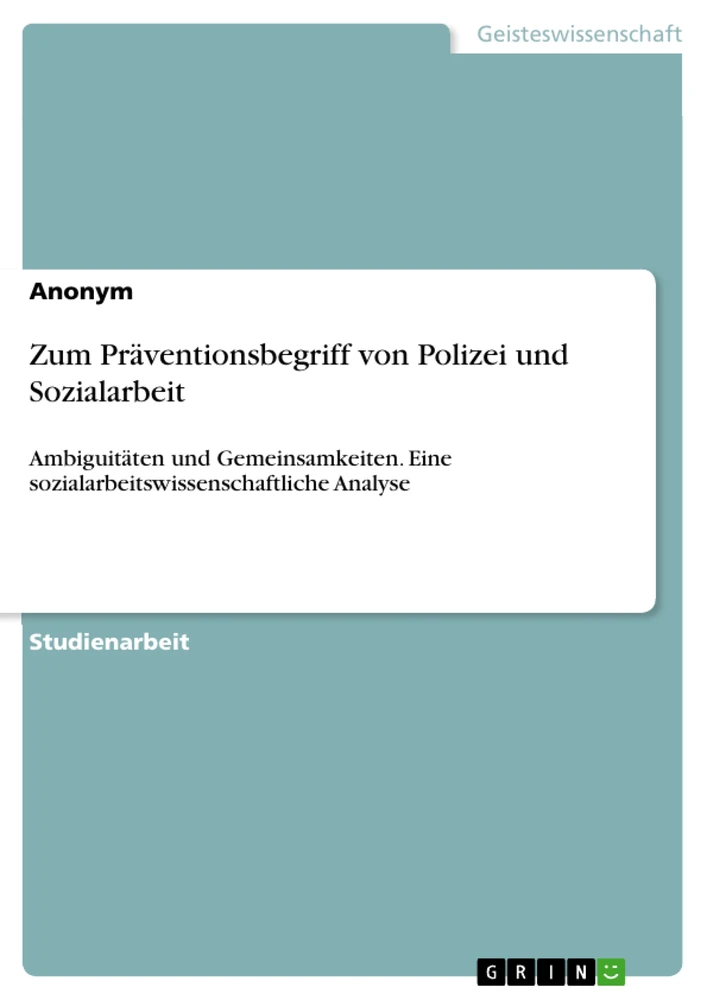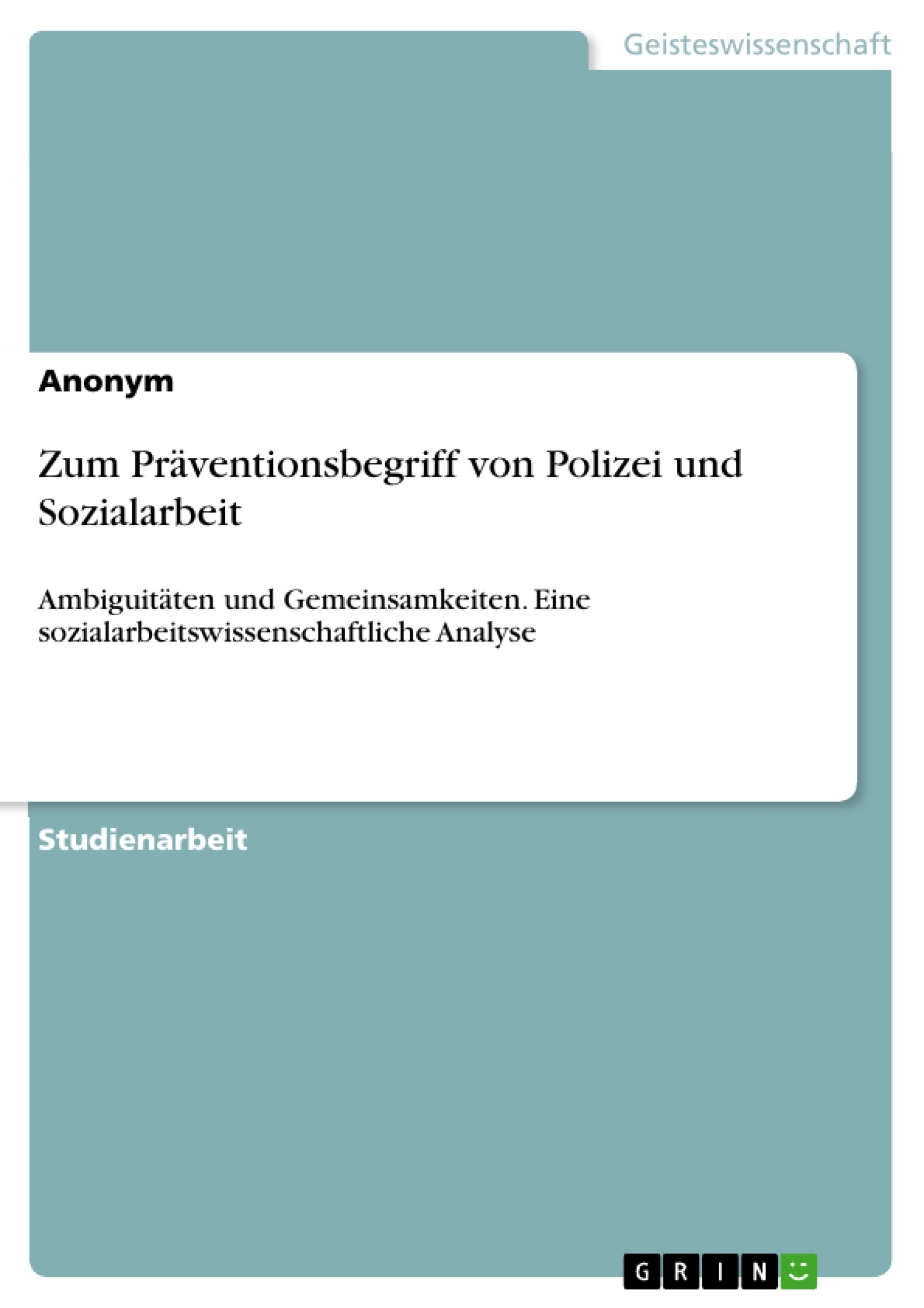Aus der Feststellung, dass die Funktionsbedingungen des Zusammenwirkens von Sozialarbeit und Polizei nicht konkret benannt und konzeptioniert sind, leitet sich die Frage ab, wie denn die strukturellen Bedingungen dieser Kooperation ausgestaltet sein müssen, um eine für beide Akteure zufriedenstellende und erfolgreiche Zusammenarbeit gewährleisten zu können, die darüber hinaus noch den in § 2 SGB VIII formulierten Aufgabenstellungen der Jugendhilfe gerecht wird. Um eine professionelle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Sozialarbeit umzusetzen, bedarf es neben der klaren Hervorhebung der Differenzen notwendigerweise einer gemeinsam entwickelten Konzeption.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Forschungsgegenstand
- 1.2 Begriffsklärungen
- 1.2.1 Polizei
- 1.2.2 Gewalt und Staatsgewalt
- 2 Polizei und Soziale Arbeit
- 2.1 Spezifika der Sozialarbeit
- 2.2 Spezifika der Polizeiarbeit
- 2.3 Jugendhilfe
- 2.4 Polizeiarbeit mit Kindern und Jugendlichen
- 3 Jugendstrafrecht und Erziehung
- 4 Exkurs: Jugendkriminalität
- 5 Prävention
- 5.1 Zum Begriff
- 5.2 Prävention aus Sicht der Polizei
- 5.3 Kritik an der polizeilichen Präventionsauffassung
- 5.4 Prävention aus Sicht der Jugendhilfe
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Polizei und Jugendhilfe am Beispiel eines konkreten Falles. Die Zielsetzung besteht darin, das Verständnis von Präventionsarbeit in beiden Bereichen zu vertiefen und die unterschiedlichen Perspektiven und Begrifflichkeiten zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Herausforderungen der Zusammenarbeit und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Verständnisses zentraler Begriffe.
- Das Verhältnis von Polizei und Jugendhilfe
- Präventionsarbeit in der Polizei und Sozialarbeit
- Begriffsbestimmungen von Polizei, Gewalt und Staatsgewalt
- Die Rolle der Jugendhilfe im Schutz von Jugendlichen
- Die Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die angespannte Beziehung zwischen Polizei und Jugendhilfe anhand des Falles eines getöteten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings. Dieser tragische Vorfall verdeutlicht die Herausforderungen der Zusammenarbeit und den möglichen Konflikt zwischen dem Schutzauftrag der Jugendhilfe und dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft. Die Arbeit fokussiert auf den Präventionsbegriff und dessen unterschiedliche Konnotationen in beiden Bereichen, wobei die unterschiedliche Verwendung von Begriffen wie "Sozialraum" ein zentrales Problem darstellt. Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit der Frage nach der Verhinderung solcher Ereignisse und der jeweiligen Verantwortung von Polizei und Jugendhilfe.
1.2 Begriffsklärungen: Dieses Kapitel widmet sich der Klärung zentraler Begriffe. Es wird die Problematik der diffusen Verwendung des Begriffs "Polizei" angesprochen, da "die Polizei" in Deutschland aufgrund der Länderhoheit nicht einheitlich definiert ist. Die Aufgaben der Polizei werden in Strafverfolgung (Repression) und Gefahrenvorsorge (Prävention) unterteilt, wobei der Fokus über den bloßen Gesetzesvollzug hinausgeht und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung berücksichtigt wird. Die unterschiedlichen Konnotationen des Begriffs "Bürgerpolizei" werden ebenfalls beleuchtet. Der Begriff "Gewalt" wird als vielschichtig und komplex dargestellt, und der Unterschied zu legitimer Staatsgewalt im Sinne des Gemeinwohls wird hervorgehoben. Die Polizei wird als Institution mit dem Monopol auf legitimierte Gewalt beschrieben, welche aus zwei Perspektiven (Gewalt zum Schutz anderer und Gewalt als Ultima Ratio) betrachtet werden muss.
Schlüsselwörter
Polizei, Jugendhilfe, Prävention, Gewalt, Staatsgewalt, Jugendstrafrecht, Sozialarbeit, Gefahrenabwehr, Community Policing, Bürgerpolizei, Zusammenarbeit, Konflikt, Begriffsbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Polizei und Jugendhilfe, insbesondere im Hinblick auf Präventionsarbeit. Ein konkreter Fall, der Tod eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings, dient als Ausgangspunkt für die Analyse der unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen der Zusammenarbeit beider Bereiche.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis von Präventionsarbeit in Polizei und Jugendhilfe zu vertiefen und die unterschiedlichen Perspektiven und Begrifflichkeiten zu analysieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen der Zusammenarbeit und der Notwendigkeit eines gemeinsamen Verständnisses zentraler Begriffe.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Polizei und Jugendhilfe, der Präventionsarbeit in beiden Bereichen, der Begriffsbestimmung von Polizei, Gewalt und Staatsgewalt, der Rolle der Jugendhilfe im Jugendschutz und den Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendhilfe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung (mit Begriffsklärungen zu Polizei, Gewalt und Staatsgewalt), Polizei und Sozialer Arbeit (inkl. Jugendhilfe und Polizeiarbeit mit Kindern und Jugendlichen), Jugendstrafrecht und Erziehung, einen Exkurs zur Jugendkriminalität, Prävention (aus Sicht der Polizei und Jugendhilfe mit Kritik an der polizeilichen Präventionsauffassung) und ein Fazit.
Wie werden die Begriffe "Polizei", "Gewalt" und "Staatsgewalt" definiert?
Die Definition von "Polizei" wird als komplex dargestellt, da sie in Deutschland aufgrund der Länderhoheit nicht einheitlich ist. Die Aufgaben werden in Strafverfolgung und Gefahrenvorsorge unterteilt. "Gewalt" wird als vielschichtig beschrieben, mit einer Unterscheidung zwischen Gewalt und legitimer Staatsgewalt im Sinne des Gemeinwohls. Die Polizei wird als Institution mit dem Monopol auf legitimierte Gewalt charakterisiert.
Welche Rolle spielt die Prävention in der Arbeit?
Der Präventionsbegriff und seine unterschiedlichen Konnotationen in Polizei und Jugendhilfe stehen im Mittelpunkt. Die Arbeit analysiert die unterschiedliche Verwendung zentraler Begriffe und die Herausforderungen, die sich daraus für die Zusammenarbeit ergeben. Die unterschiedliche Sichtweise auf Prävention in Polizei und Jugendhilfe wird kritisch beleuchtet.
Welche Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von Polizei und Jugendhilfe werden angesprochen?
Die Arbeit hebt die Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendhilfe hervor, insbesondere die unterschiedlichen Perspektiven und Begrifflichkeiten, die zu Konflikten führen können. Der Fall des getöteten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings illustriert diese Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polizei, Jugendhilfe, Prävention, Gewalt, Staatsgewalt, Jugendstrafrecht, Sozialarbeit, Gefahrenabwehr, Community Policing, Bürgerpolizei, Zusammenarbeit, Konflikt, Begriffsbestimmung.
Was ist das Fazit der Arbeit?
[Hier muss der Inhalt des Fazit Kapitels aus dem Originaltext eingefügt werden]
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Zum Präventionsbegriff von Polizei und Sozialarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1478698