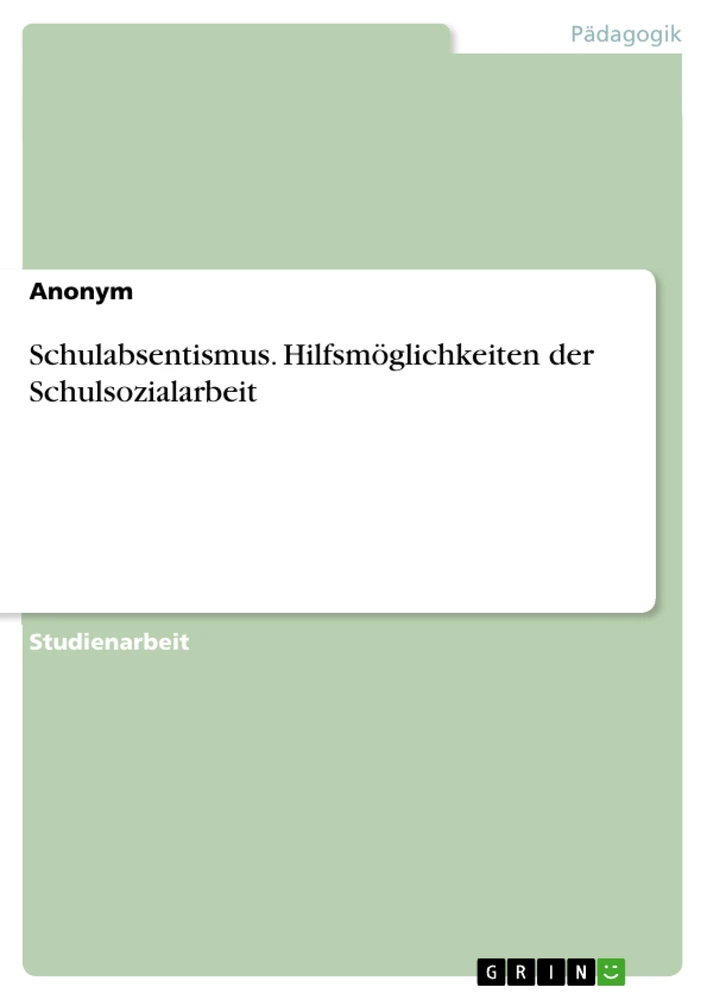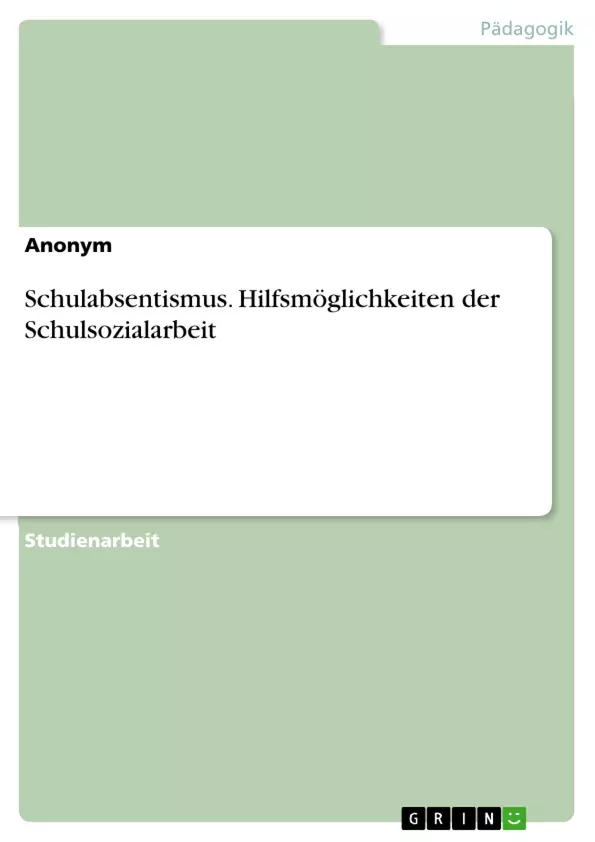Für Kinder und Jugendliche, die Schule negativ konnotieren und deshalb dem Unterricht fernbleiben, entstehen weitreichende, zukunftsgefährdende Probleme: Wer den Schulbesuch verweigert, erhält keinen Abschluss und hat weniger Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft. Hieraus ergibt sich die Frage, warum Kinder und Jugendliche trotz dieser extremen Folgen die Schule nicht besuchen. Gibt es Unterschiede zwischen den "Schulschwänzern"? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Welche rechtlichen Konsequenzen folgen, wenn man nicht am Unterricht teilnimmt und wie kann man Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, dem Schulalltag regelmäßig beizuwohnen?
Neben der Beantwortung dieser Fragen setzt sich diese Arbeit das Ziel, vor allem auch Unterstützungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit aufzuzeigen, da diese die Möglichkeit bietet, die Betroffenen unabhängig von Noten und Leistungsmessungen zu unterstützen und im Idealfall dafür sorgt, dass Schülerinnen und Schüler eine emotionale Bindung zum Sozialraum Schule aufbauen, denn das Thema Schulabsentismus ist im wissenschaftlichen Diskurs, besonders durch die Forschungen und wissenschaftlichen Expertisen von z.B. Ricking oder Thimm, bereits vielfältig untersucht und analysiert worden. Allerdings wird die Schulsozialarbeit im Hinblick auf Schulabsentismus meist nur als unterstützendes Randphänomen betrachtet. Im Rahmen dieser Arbeit soll deshalb auf die Wichtigkeit von Schulsozialarbeit eingegangen werden, indem pädagogische Hilfsmöglichkeiten vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Formen und Begriffe: Schulaversion, Schulabsentismus, Schulabbruch
- 2.1. Schulschwänzen
- 2.2. Angstbedingte Schulmeidung
- 2.3. Das Zurückhalten von Schülerinnen und Schülern
- 3. Rechtliche Grundlagen: Schulpflicht
- 3.1. Rechtliche Handlungsoptionen
- 3.2. Suspendierung
- 4. Hilfsmaßnahmen bei Schulabsentismus
- 5. Schulsozialarbeit und Schulabsentismus
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Schulabsentismus und beleuchtet die Ursachen, Folgen und möglichen Hilfsmöglichkeiten, die durch die Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen von Schulabsentismus
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Konsequenzen von Schulverweigerung
- Pädagogische Hilfsmaßnahmen zur Prävention und Intervention bei Schulabsentismus
- Rolle der Schulsozialarbeit bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Schulabsentismus
- Einblick in verschiedene Modelle der Schulsozialarbeit im Kontext von Schulabsentismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext von Schulabsentismus erläutert und die Relevanz des Themas für die Gesellschaft und die Bildung von Schülerinnen und Schülern hervorhebt.
Kapitel 2 befasst sich mit der Definition von Schulabsentismus und seinen unterschiedlichen Formen. Hierbei werden Konzepte wie Schulaversion, Schulschwänzen, angstbedingte Schulmeidung und das Zurückhalten von Schülerinnen und Schülern diskutiert.
Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Schulpflicht und stellt verschiedene Handlungsoptionen im Fall von Schulverweigerung vor, einschließlich der Möglichkeit von Suspendierungen.
Kapitel 4 präsentiert verschiedene pädagogische Hilfsmaßnahmen, die zur Prävention und Intervention bei Schulabsentismus eingesetzt werden können, um rechtliche Schritte gegen Schülerinnen und Schüler zu vermeiden.
Kapitel 5 widmet sich der Rolle der Schulsozialarbeit bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Schulabsentismus und stellt verschiedene Modelle der Schulsozialarbeit vor, die sich in den Alltag der Schulsozialarbeit integrieren lassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Schulabsentismus, Schulsozialarbeit, Schulverweigerung, pädagogische Hilfsmaßnahmen, rechtliche Grundlagen, Schulpflicht, Schulaversion, Schulschwänzen, Angstbedingte Schulmeidung, Zurückhalten von Schülerinnen und Schülern, Modelle der Schulsozialarbeit.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Schulabsentismus. Hilfsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1474371