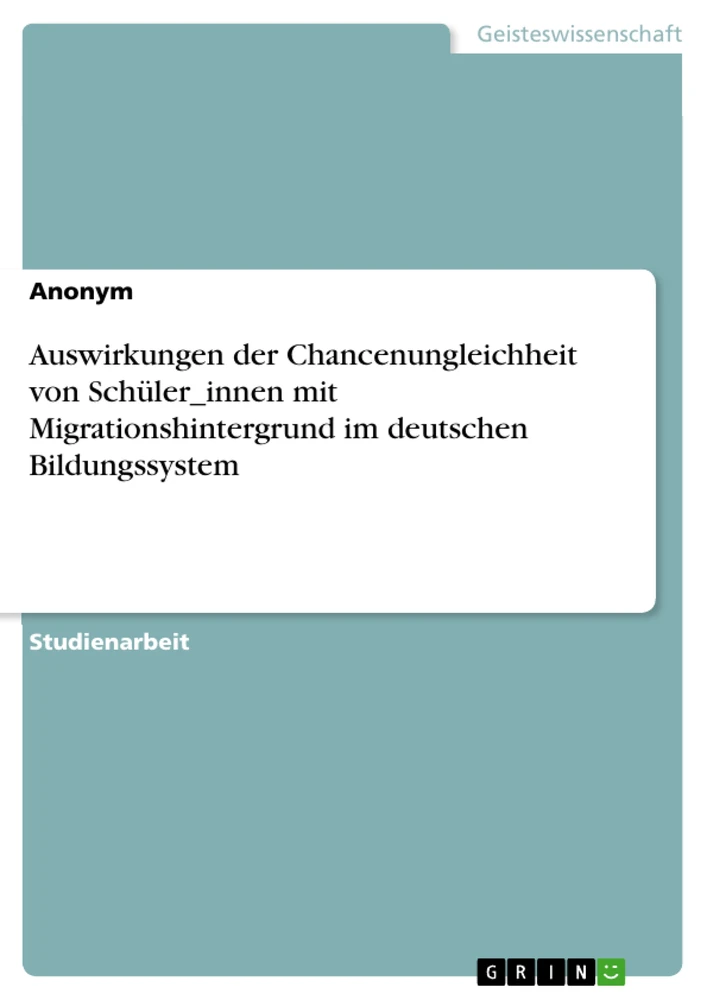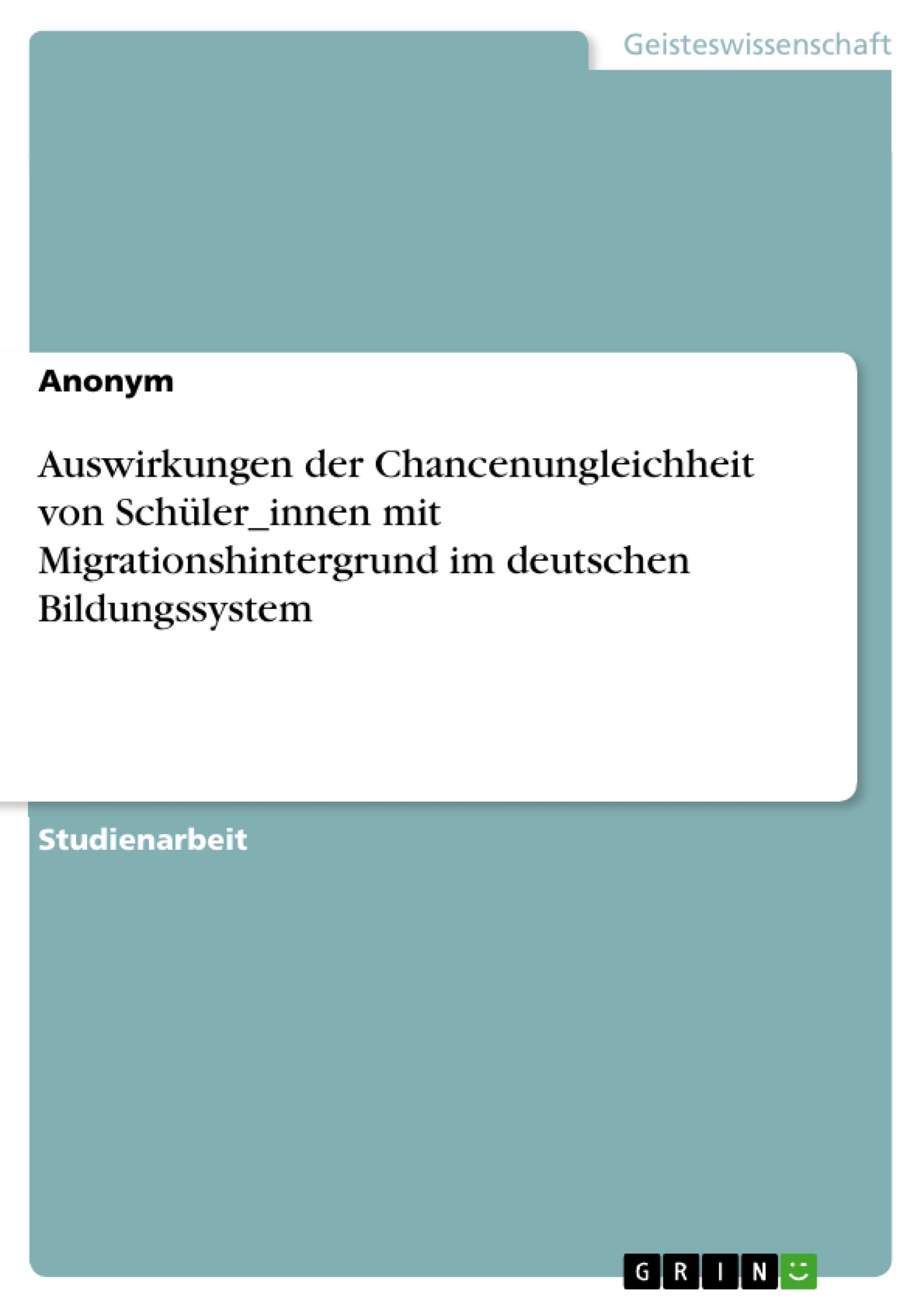Inwieweit hat die soziale Herkunft von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund in Deutschland Auswirkungen auf die Chancengleichheit im Bildungssystem in der Primarstufe und Sekundarstufe 1?
Das deutsche Bildungssystem steht seit Langem im Fokus, da trotz der neunjährigen Vollzeitschulpflicht die Chancengleichheit noch nicht erreicht ist. Insbesondere die Diskussion über die Bildungsungleichheiten von Schüler:innen mit Migrationshintergrund ist durch den "PISA-Schock" und die Erkenntnisse über die Unterschiede zwischen Schüler:innen mit und ohne Migrationshintergrund angeregt worden. Mit einem Anteil von 39 Prozent an allgemeinbildenden Schulen im Jahr 2019 ist die wachsende Zahl von Schüler:innen mit Migrationshintergrund ein zentraler Faktor. Die Ursachen dieser Ungleichheiten werden vielschichtig betrachtet, wobei ethnische Bildungsungleichheit als Sonderfall sozialer Ungleichheit herausgestellt wird. Diese resultiert nicht nur aus Diskriminierung, sondern auch aus historischen Einflüssen wie der Arbeitsmigration der 1950er Jahre und den damit verbundenen mangelnden Integrationsbemühungen des Staates. Sprache spielt eine zentrale Rolle, da mangelnde Lese- und Sprachkompetenz die Bildungsergebnisse beeinflussen. Die PISA-Studie hat die Debatte über Bildungsungleichheit vorangetrieben, indem sie die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufgezeigt hat. Eine mögliche Lösung besteht darin, das Bildungssystem grundlegend zu reformieren und sich am skandinavischen Modell zu orientieren, das weniger auf Selektion und mehr auf individuelle Förderung setzt. Damit könnten die Chancenungleichheiten im deutschen Bildungssystem reduziert und die Integration von Schüler:innen mit Migrationshintergrund verbessert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Bildung-eine deutsche Altlast?
- Ursachen der Bildungsungleichheit bei Schülern mit Migrationshintergrund
- ethnische Bildungsungleichheit als Sonderfall der sozialen Ungleichheit
- Geschichtlicher Hintergrund der Herkunftsbasierten Bildungsbenachteiligung
- Die Rolle der Sprache und deren Korrelation zur Bildungsbenachteiligung
- Die internationale Schulleistungsstudie PISA-Studie
- Auswirkungen der Chancenungleichheit von Schüler_innen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem
- primäre Herkunftseffekte
- sekundäre Herkunftseffekte
- Bildungschancen für Migrantenkinder mit sozial schwachem und bildungsfernem Hintergrund
- Forderungen und Lösungsansätze, um migrationsspezifische Bildungsungleichheit im Schulsystem zu begleichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die soziale Herkunft von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund in Deutschland Auswirkungen auf die Chancengleichheit im Bildungssystem in der Primarstufe und Sekundarstufe 1 hat. Sie analysiert die Ursachen der Bildungsungleichheit, beleuchtet die Rolle des historischen Kontextes und untersucht die Bedeutung der Sprache für den Bildungserfolg. Die Arbeit betrachtet die internationale Schulleistungsstudie PISA und deren Erkenntnisse sowie die Folgen der Chancenungleichheit für Migrantenkinder. Abschließend werden Forderungen und Lösungsansätze zur Behebung der migrationsspezifischen Bildungsungleichheit im Schulsystem vorgestellt.
- Bildungsungleichheit bei Schülern mit Migrationshintergrund
- Sozioökonomische Faktoren und ihre Auswirkungen auf den Bildungserfolg
- Rolle der Sprache und des kulturellen Hintergrundes
- Die PISA-Studie und ihre Erkenntnisse
- Forderungen zur Verbesserung der Bildungschancen von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Problem der Bildungsungleichheit in Deutschland und stellt die Frage, ob Bildung eine deutsche Altlast ist. Es wird auf die Bedeutung der Chancengleichheit im Bildungssystem und die Rolle der PISA-Studie im Hinblick auf die Bildungsungleichheit zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund eingegangen. Das zweite Kapitel untersucht die Ursachen der Bildungsungleichheit bei Schülern mit Migrationshintergrund. Es werden zwei Thesen diskutiert: die Selbstverantwortung von Migrantenfamilien für ihre nachteilige Bildungssituation und die Behauptung, dass Zuwanderer durch Diskriminierung am Bildungsaufstieg gehindert werden. Die Arbeit argumentiert, dass die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund nicht nur auf Diskriminierung zurückzuführen ist, sondern auch mit ihrer sozialen Stellung zusammenhängt. Das dritte Kapitel beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund der herkunftsbasierten Bildungsbenachteiligung und zeigt auf, wie das Gastarbeiterkommen in den Fünfzigerjahren zu einer tiefgreifenden Ungleichheit im Bildungssystem geführt hat. Die Arbeit diskutiert die Folgen des geringen Qualifikationsniveaus der damaligen Gastarbeiter_innen, die sich bis heute in den Nachfolgegenerationen fortsetzen. Das vierte Kapitel widmet sich der Rolle der Sprache und deren Korrelation zur Bildungsbenachteiligung. Es wird erläutert, wie Sprachbarrieren den Bildungserfolg von Migrantenkindern beeinträchtigen können. Das fünfte Kapitel stellt die internationale Schulleistungsstudie PISA vor und erläutert ihre Bedeutung für die Analyse der Bildungsungleichheit. Es werden die wichtigsten Ergebnisse der PISA-Studie im Hinblick auf die Bildungsungleichheit zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund beleuchtet. Das sechste Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Chancenungleichheit von Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Es werden sowohl primäre als auch sekundäre Herkunftseffekte betrachtet und deren Einfluss auf den Bildungsverlauf von Migrantenkindern analysiert. Das siebte Kapitel betrachtet die Bildungschancen von Migrantenkindern mit sozial schwachem und bildungsfernem Hintergrund. Es werden die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die diese Kinder im Bildungssystem erleben, beleuchtet. Das achte Kapitel fokussiert sich auf Forderungen und Lösungsansätze, um die migrationsspezifische Bildungsungleichheit im Schulsystem zu begleichen. Es werden verschiedene Strategien und Maßnahmen vorgestellt, die dazu beitragen können, die Bildungschancen von Migrantenkindern zu verbessern.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, soziale Herkunft, ethnische Bildungsungleichheit, PISA-Studie, Chancenungleichheit, Sprachbarrieren, Integration, Bildungserfolg, sozial schwacher Hintergrund, Bildungsfremde, Gastarbeiter, Deutschland, primäre und sekundäre Herkunftseffekte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Auswirkungen der Chancenungleichheit von Schüler_innen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1474059