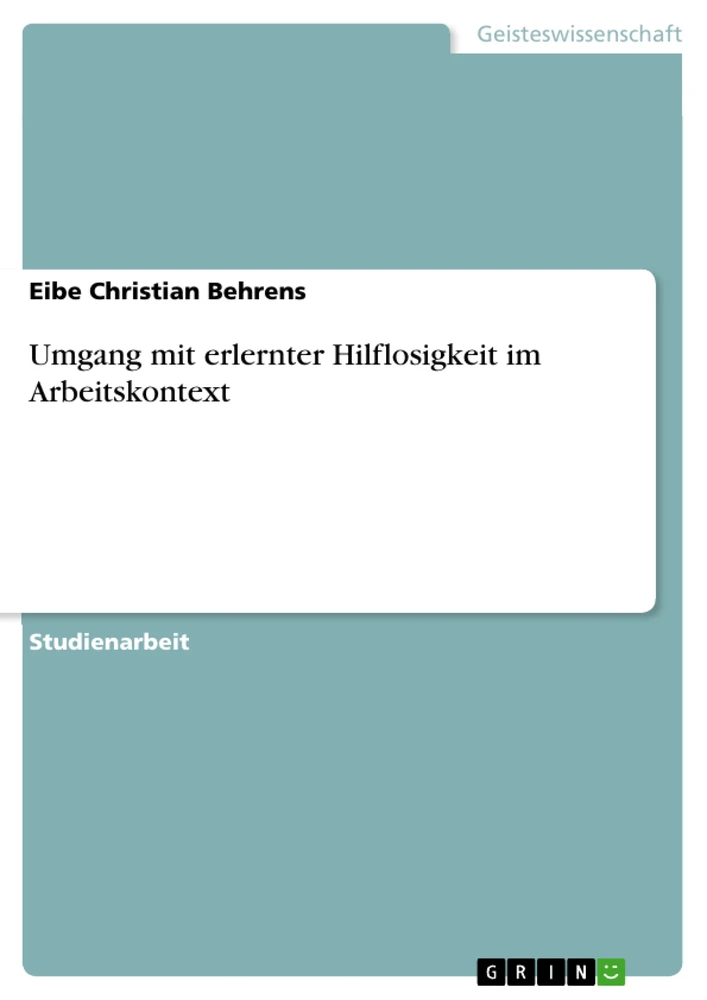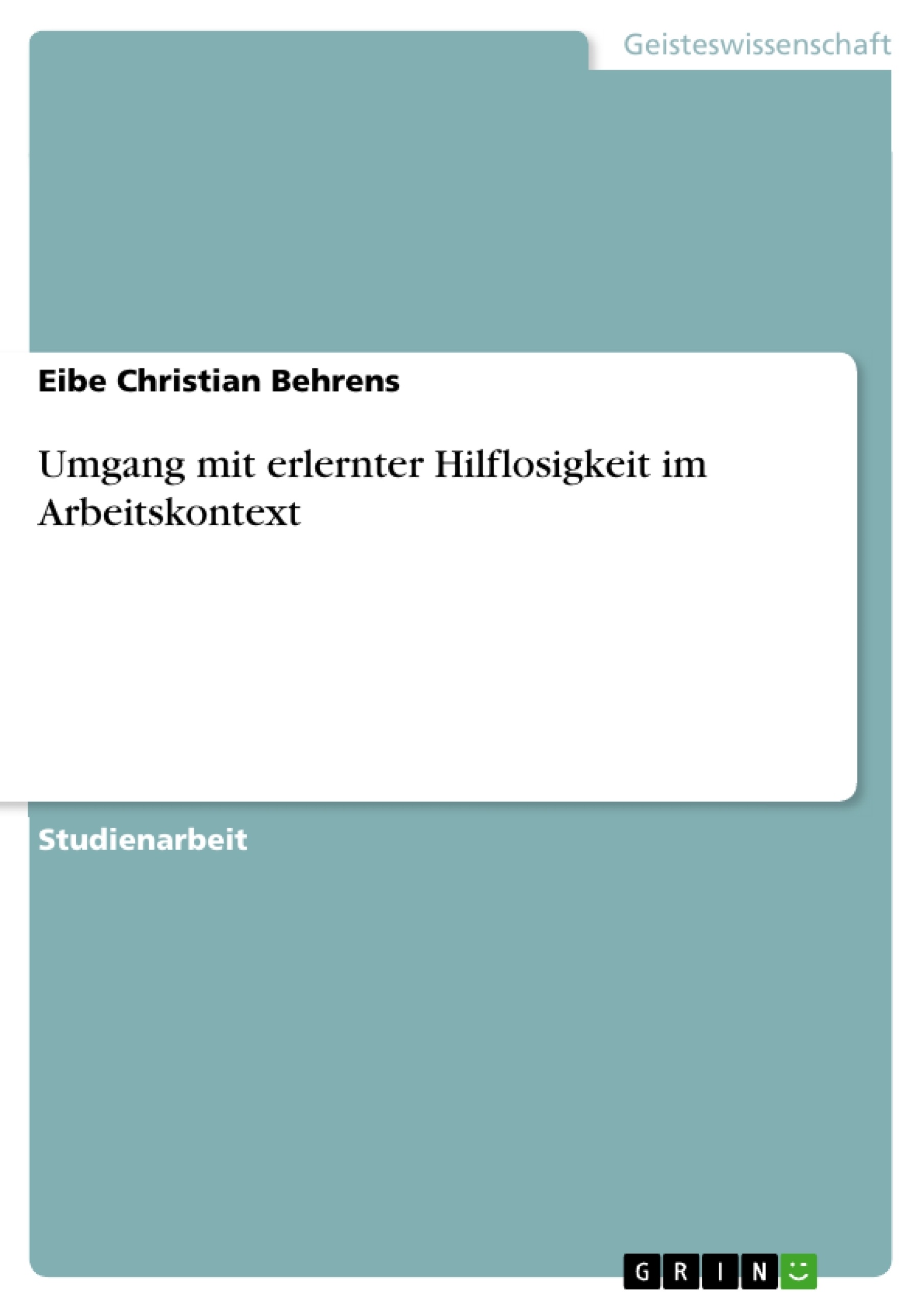Die Arbeit untersucht erlernte Hilflosigkeit im Arbeitskontext, ein Phänomen, das Gefühle der Hilflosigkeit hervorruft und oft mit Depressionssymptomen einhergeht. Sie beginnt mit einer Erläuterung des Konzepts nach Seligman und dessen Verbindung zur Depression. Dann werden verschiedene Modelle zur Ursachenanalyse vorgestellt, darunter attributionale Modelle, Heckhausens Selbstbewertungsmodell und Lewinsohns Verstärker-Verlust-Theorie. Die Arbeit betrachtet auch die Verbreitung der erlernten Hilflosigkeit im Arbeitsumfeld und deren Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit. Schließlich werden verschiedene Interventionsansätze vorgestellt, die auf Lerntheorie, Motivationstheorie und Persönlichkeitspsychologie basieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung des Konzepts der erlernten Hilflosigkeit
- Die erlernte Hilflosigkeit nach Seligman und das Hilflosigkeitsmodell der Depression
- Attributionale Weiterentwicklung
- Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen
- Verstärker-Verlust-Theorie nach Lewinsohn
- Erlernte Hilflosigkeit im Arbeitskontext
- Verbreitung
- Einfluss auf die Arbeitsleistung
- Behandlungsansätze
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit im Arbeitskontext. Ziel ist es, das Konzept der erlernten Hilflosigkeit näher zu beleuchten, verschiedene theoretische Modelle zur Entstehung dieses Phänomens vorzustellen und einen Überblick über mögliche Interventionsansätze zu geben.
- Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman und seine Verbindung zur Depression.
- Attributionale Modelle und das Selbstbewertungsmodell von Heckhausen.
- Die Verstärker-Verlust-Theorie von Lewinsohn.
- Die Verbreitung und der Einfluss erlernter Hilflosigkeit im Arbeitskontext.
- Verschiedene Interventionsansätze zur Bewältigung erlernter Hilflosigkeit im Arbeitskontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird das Konzept der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman erläutert und in Verbindung zur Depression gesetzt. Hierbei werden verschiedene Aspekte der beiden Phänomene, wie Symptome, Entstehung und Behandlung, miteinander verglichen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Attributionstheorie und die Verstärker-Verlust-Theorie von Lewinsohn als mögliche Erklärungsmodelle für die Entstehung erlernter Hilflosigkeit.
Das dritte Kapitel widmet sich der erlernten Hilflosigkeit im Arbeitskontext. Hier werden die Verbreitung des Phänomens in der modernen arbeitenden Bevölkerung und dessen Einfluss auf die Erwerbsarbeit behandelt.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Interventionsansätze zur Bewältigung erlernter Hilflosigkeit aus verschiedenen theoretischen Perspektiven vorgestellt.
Schlüsselwörter
Erlernte Hilflosigkeit, Depression, Attributionstheorie, Selbstbewertungsmodell, Verstärker-Verlust-Theorie, Arbeitskontext, Interventionsansätze, Motivationstheorie, Persönlichkeitspsychologie.
- Quote paper
- Eibe Christian Behrens (Author), 2024, Umgang mit erlernter Hilflosigkeit im Arbeitskontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1473167