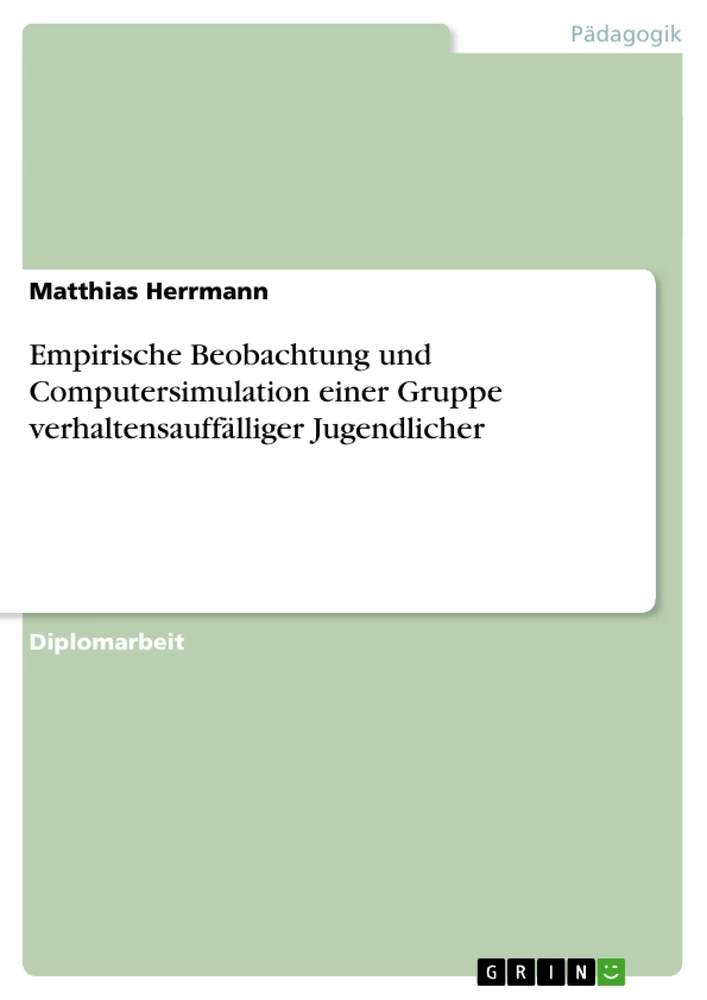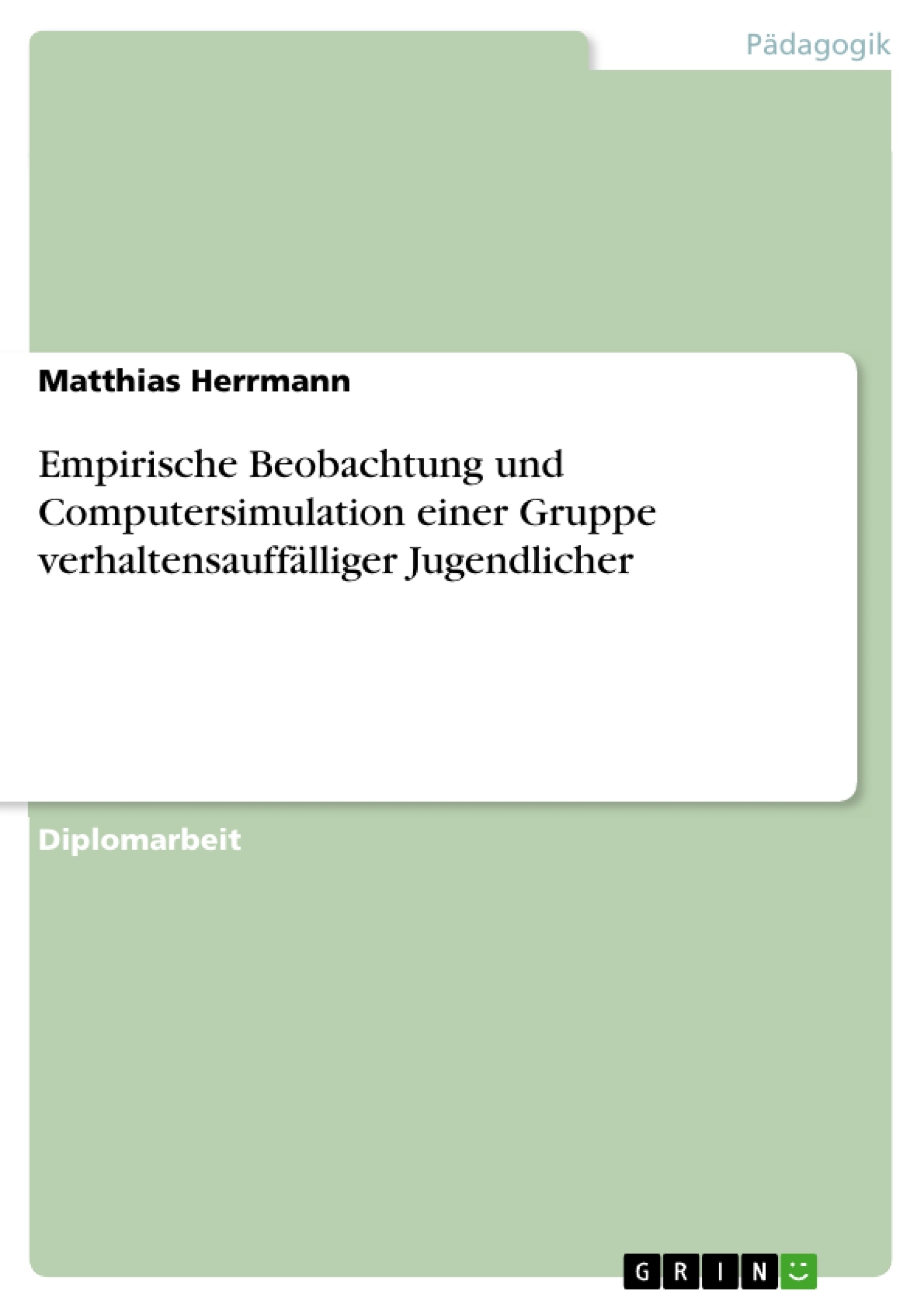Die vorliegende Arbeit behandelt für erziehungswissenschaftliche Kontexte ein relativ ungewöhnliches Thema: Es geht um die Konstruktion und Anwendung von Simulaionsprogrammen in einem sozialpädagogischen Handlungsfeld, nämlich einem Wohnheim für verhaltensauffällige Jugendliche. Zum Einsatz kommt hier ein Programm namens Zellularautomat, welcher in der Simulation prognostizieren soll, welche Subgruppen sich innerhalb des Wohnheimes bilden und wie wohl sich die Gruppenmitglieder fühlen. Die Simulationsergebnisse werden in der Folge mit empirischen Erhebungen der Wohnheimgruppe verglichen. Insofern ist das übergeordnete Ziel dieser Arbeit die empirische Testung der Simulationsprogramme auf deren Gegenstandsadäquatheit in Bezug auf sozialpädagogische Praxixfelder. Letztlich zeigt die vorliegende Arbeit auf diese Weise exemplarisch, was bei der Konstruktion und der praktischen Anwendung von Computersimulationsprogrammen in sozialen Handlungsfeldern zu beachten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Einleitung
- Beschreibung des exemplarischen, pädagogischen Gegenstands
- Mögliche Gründe für die Abstinenz von Computersimulationsprogrammen in pädagogikrelevanten Wissenschaften und deren Anwendungsbereichen
- Therapeutische Konzepte und Prinzipien in der Jugendhilfe
- Erkenntnistheoretischer Hintergrund in der empirischen Sozialforschung
- Trägerideologie
- Fazit
- Funktion und Methoden der empirischen Sozialforschung
- Funktion der empirischen Sozialforschung
- Quantitative und qualitative Forschungsmethoden
- Grundorientierung und Prinzipien quantitativer Sozialforschung
- Grundorientierung und Prinzipien qualitativer Sozialforschung
- Die quantitative Befragung
- Die qualitative Befragung
- Die quantitative Beobachtung
- Die qualitative Beobachtung
- Beschreibung der empirischen Untersuchungen der Jugendgruppe
- Erkenntnisinteresse
- Das der Befragung zu Grunde liegende Erkenntnisinteresse
- Das der Beobachtung zu Grunde liegende Erkenntnisinteresse
- Methodisches Vorgehen bei der Befragung
- Methodisches Vorgehen bei der Beobachtung
- Erkenntnisinteresse
- Datenauswertung der empirischen Untersuchungen
- Ergebnisse der Befragung
- Ergebnisse der Beobachtung
- Methodenreflexion
- Reflexion der Befragung
- Reflexion der Beobachtung
- Computersimulation der Jugendgruppe
- Begriffsdefinitionen
- System
- Gruppen-, bzw. Systemdynamik
- Simulation
- Modell
- Trajektorie
- Computersimulationsprogramme in den Sozialwissenschaften
- Die Funktionsweise von Zellularautomaten
- Der Zellularautomat MORENO12
- Das dem ZA12 zu Grunde liegende Erkenntnisinteresse
- Konkrete Vorgehensweise bei der Simulation
- Begriffsdefinitionen
- Auswertung und Reflexion der Simulation
- Ergebnisauswertung der Simulation
- Vergleich der Simulationsergebnisse mit denen der Beobachtung
- Vergleich der Simulationsergebnisse mit denen der Befragung
- Befragung der Gruppenerzieher nach der Realitätsnähe der Ergebnisse
- Fazit
- Reflexion der Simulationsanwendung
- Ergebnisauswertung der Simulation
- Vergleich: Empirische Methoden und Computersimulation
- Reflexion der Kombination von empirischen Methoden und Computersimulation
- Anwendungsperspektiven von Computersimulationen in Forschung und Jugendhilfe
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Kombination empirischer Methoden (Beobachtung und Befragung) mit Computersimulation zur Analyse einer Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Ansätze aufzuzeigen und Anwendungsperspektiven in der Jugendhilfe zu entwickeln.
- Vergleich quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden
- Anwendung von Computersimulationen in der Sozialforschung
- Analyse von Gruppenprozessen bei verhaltensauffälligen Jugendlichen
- Methodenreflexion der empirischen Untersuchungen und der Simulation
- Entwicklung von Anwendungsperspektiven für die Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Prolog: Der Prolog schildert eine dramatische Szene in einer Jugendhilfeeinrichtung, in der zwei Jugendliche andere Gruppenmitglieder provozieren und schließlich ein Handy zerstören. Dies dient als einleitendes Beispiel für die Komplexität der Interaktionen in der Gruppe und motiviert die Notwendigkeit für eine umfassendere Analyse mithilfe der gewählten Methoden.
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, nämlich die empirische Untersuchung und Computersimulation einer Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher. Sie beschreibt die Forschungsfrage und die angewandte Methodik, die aus einer Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden sowie einer Computersimulation besteht. Die Einleitung rechtfertigt die Wahl dieser Methoden und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Beschreibung des exemplarischen, pädagogischen Gegenstands: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die untersuchte Jugendgruppe, die Zusammensetzung der Gruppe, die Rahmenbedingungen in der Einrichtung sowie die spezifischen Herausforderungen und Probleme, mit denen die Erzieher konfrontiert sind. Es liefert den kontextuellen Hintergrund für die anschließende empirische Untersuchung und die Computersimulation.
Mögliche Gründe für die Abstinenz von Computersimulationsprogrammen in pädagogikrelevanten Wissenschaften und deren Anwendungsbereichen: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für die bisherige untergeordnete Rolle von Computersimulationen in der Pädagogik. Es werden therapeutische Konzepte, erkenntnistheoretische Hintergründe und trägerideologische Faktoren analysiert, die die Akzeptanz und Anwendung solcher Methoden bisher behindert haben. Das Kapitel dient als theoretische Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der Methodik der Computersimulation in der Arbeit.
Funktion und Methoden der empirischen Sozialforschung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der empirischen Sozialforschung, indem es die Funktion und die verschiedenen quantitativen und qualitativen Methoden erläutert. Es beschreibt die Prinzipien und Vorgehensweisen von Befragungen und Beobachtungen, sowohl quantitativ als auch qualitativ, und bildet die methodologische Grundlage für die im Folgenden beschriebenen empirischen Untersuchungen.
Beschreibung der empirischen Untersuchungen der Jugendgruppe: Hier wird das methodische Vorgehen bei der Befragung und Beobachtung der Jugendgruppe detailliert dargestellt. Es werden die konkreten Forschungsfragen, die Instrumente und das Verfahren der Datenerhebung beschrieben. Der Fokus liegt auf der methodischen Umsetzung der gewählten Forschungsansätze und der Begründung der Entscheidungen bezüglich der Methodik.
Datenauswertung der empirischen Untersuchungen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Befragung und Beobachtung. Die Ergebnisse werden detailliert beschrieben und interpretiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung und Interpretation der Daten, um eine fundierte Basis für die anschließende Computersimulation zu schaffen. Es wird auf die zentralen Ergebnisse eingegangen und deren Relevanz für die weitere Analyse herausgestellt.
Methodenreflexion: Die Methodenreflexion evaluiert kritisch die angewendeten Methoden der Befragung und Beobachtung. Stärken und Schwächen der gewählten Ansätze werden offengelegt und diskutiert. Diese Reflexion dient dazu, die Qualität der empirischen Daten zu beurteilen und mögliche Limitationen der Untersuchung aufzuzeigen.
Computersimulation der Jugendgruppe: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Anwendung der Computersimulation. Es werden die verwendeten Begriffe definiert (System, Gruppen-/Systemdynamik, Simulation, Modell, Trajektorie) und die Funktionsweise des gewählten Zellularautomaten MORENO12 erklärt. Die theoretischen Grundlagen der Simulation werden erläutert und die konkrete Vorgehensweise detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Verhaltensauffällige Jugendliche, Empirische Sozialforschung, Quantitative Methoden, Qualitative Methoden, Computersimulation, Zellularautomat, Gruppenprozesse, Jugendhilfe, Methodenreflexion, Anwendungsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kombination empirischer Methoden und Computersimulation zur Analyse einer Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Kombination von empirischen Methoden (Beobachtung und Befragung) mit Computersimulation zur Analyse einer Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Ansätze aufzuzeigen und Anwendungsperspektiven in der Jugendhilfe zu entwickeln.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert quantitative und qualitative Forschungsmethoden (Beobachtung und Befragung) mit einer Computersimulation (Zellularautomat MORENO12). Die empirischen Daten dienen als Grundlage für die Simulation, deren Ergebnisse wiederum mit den empirischen Befunden verglichen werden.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie die Kombination aus empirischen Methoden und Computersimulation die Analyse von Gruppenprozessen bei verhaltensauffälligen Jugendlichen verbessern kann. Es wird geprüft, ob die Simulation die Realität der Gruppe realistisch abbildet und welche Anwendungsperspektiven sich für die Jugendhilfe ergeben.
Warum wird eine Computersimulation eingesetzt?
Die Computersimulation ermöglicht es, komplexe Gruppenprozesse zu modellieren und zu analysieren. Sie bietet die Möglichkeit, verschiedene Szenarien durchzuspielen und die Auswirkungen unterschiedlicher Interventionen zu simulieren. Dies ergänzt die empirischen Daten und hilft, ein umfassenderes Verständnis der Gruppendynamik zu gewinnen.
Welche Aspekte der Jugendhilfe werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Anwendungsperspektiven von Computersimulationen in der Jugendhilfe. Sie untersucht, wie Simulationen dazu beitragen können, die Arbeit mit verhaltensauffälligen Jugendlichen zu verbessern und effektivere Interventionen zu entwickeln.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einem Prolog und einer Einleitung. Es folgen Kapitel zur Beschreibung der Jugendgruppe, der empirischen Methoden, der Datenauswertung, der Methodenreflexion, der Computersimulation, der Auswertung und Reflexion der Simulation, einem Vergleich der Methoden und der Anwendungsperspektiven. Die Arbeit endet mit einem Epilog.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Befragung und Beobachtung der Jugendgruppe sowie die Ergebnisse der Computersimulation. Die Ergebnisse werden miteinander verglichen und interpretiert, um die Stärken und Schwächen der verschiedenen Methoden aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Verhaltensauffällige Jugendliche, Empirische Sozialforschung, Quantitative Methoden, Qualitative Methoden, Computersimulation, Zellularautomat, Gruppenprozesse, Jugendhilfe, Methodenreflexion, Anwendungsperspektiven.
Welche Kapitel werden im Detail behandelt?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument beschreibt den Inhalt jedes Kapitels detailliert, inklusive Prolog, Einleitung, Beschreibung des pädagogischen Gegenstands, Gründen für die Abstinenz von Computersimulationen in der Pädagogik, empirischen Methoden, Datenauswertung, Methodenreflexion, Computersimulation, Auswertung und Reflexion der Simulation, Vergleich der Methoden, Anwendungsperspektiven und Epilog.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und bietet einen detaillierten Überblick über alle Kapitel und Unterkapitel der Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Matthias Herrmann (Autor:in), 2003, Empirische Beobachtung und Computersimulation einer Gruppe verhaltensauffälliger Jugendlicher, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/147271