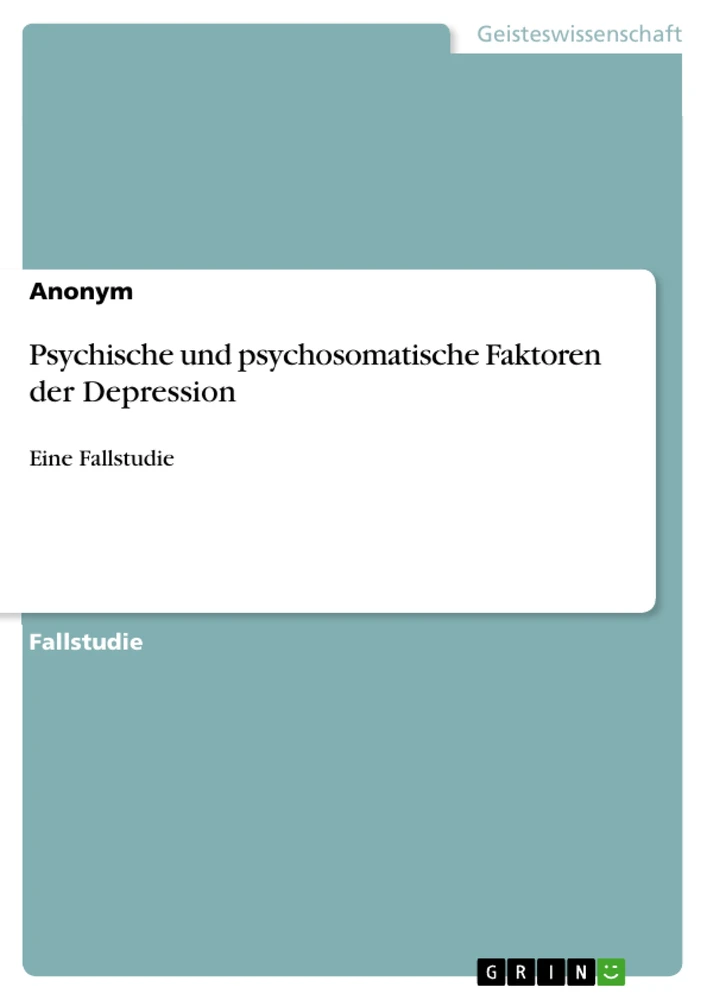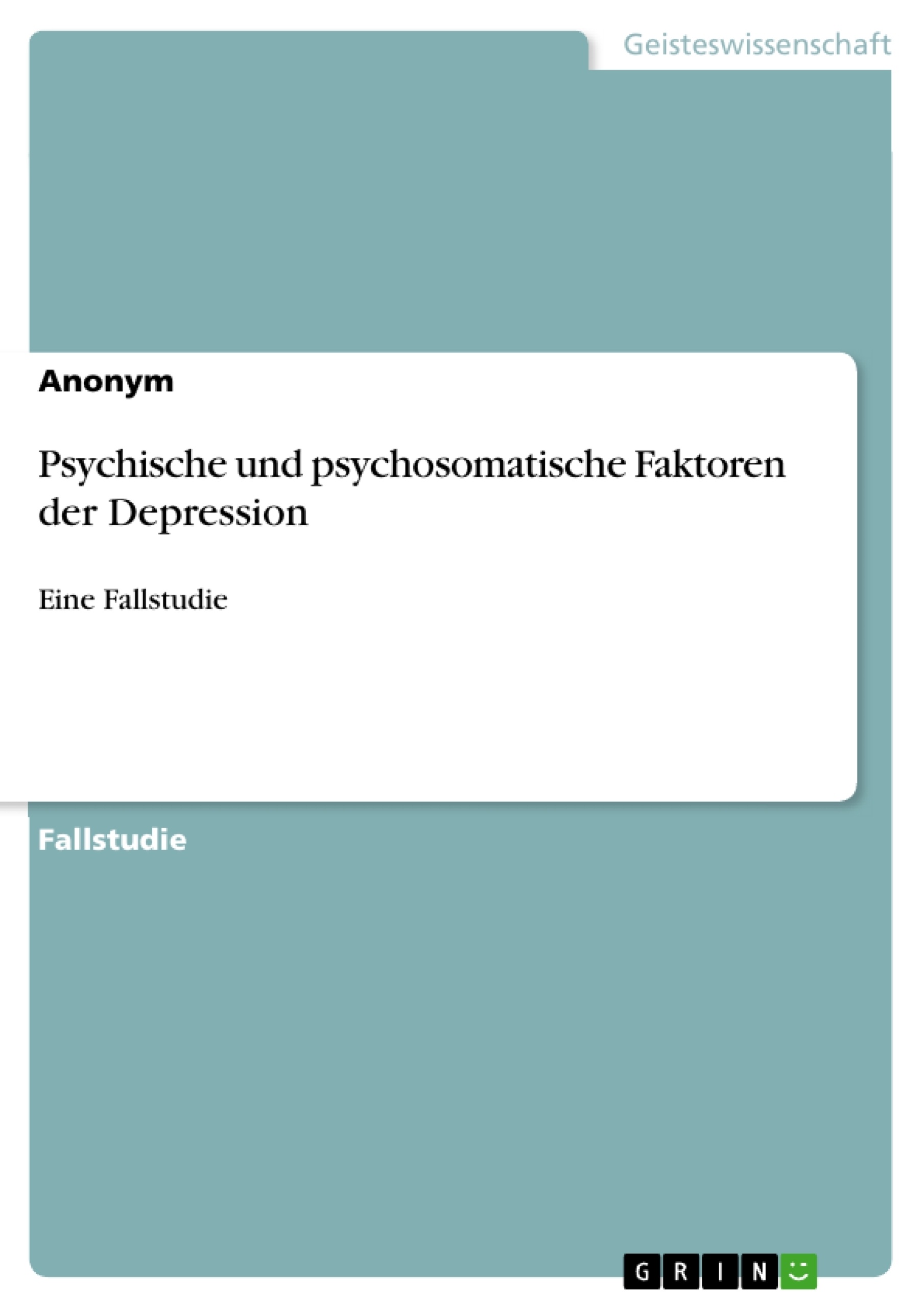Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit und sie manifestieren sich in einem heterogenen Spektrum aus Symptomen, zu denen u.a. emotionale, motivationale, kognitive, physiologische und Verhaltenskomponenten zählen. Weitergehend ist sie durch Kardinalsymptome wie eine gedrückte Stimmungslage, Antriebslosigkeit und Verlust an 1nteresse gekennzeichnet. Des weiteren weist diese psychische Erkrankung eine recht hohe Lebenszeitprävalenz von 20% auf, was bedeutet, dass ungefähr jedem fünften Einwohner Deutschlands, zur Lebzeit min. einmal eine unipolare Depression oder eine depressive Episode widerfährt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich anfangs mit dem mannigfaltigen Erscheinungsbild der Erkrankung auseinander. Der Fokus liegt auf psychischen und psychosomatischen Symptomen. Hierbei wird auf die Symptomatik, die diagnostischen Kriterien und die unterschiedlichen Ausprägungsgrade eingegangen. Nachfolgend wird sich mit den unterschiedlichen ätiologischen Konzepten beschäftigt, welche die Entstehungsmechanismen und Risikofaktoren für die Entwicklung einer depressiven Störung zu erklären versuchen. Anschließend wird die Prävalenzrate beleuchtet, mit Fokus auf der Unterscheidung der Geschlechter.
Diese Differenzen sind bedeutungsvoll, da sie auf biologische und auf soziokulturelle Faktoren hinweisen, die in Entstehung und Verlauf der Erkrankung involviert sind. Abschließend wird im theoretischen Teil, die umfassende Betrachtung der vielseitigen Ätiologie behandelt.
Basierend darauf, folgt der methodische Teil der vorliegenden Hausarbeit. 1n diesem erfolgt die Präsentation eines praxisnahen Fallbeispiels. Es wird die Makroanalyse angewendet, welche Einblicke in die übergeordneten Lebensumstände und psychosozialen Faktoren gewährleistet. Dazukommend liefert die Mikroanalyse, i.A.a an das „SORC-Modell", Erkenntnisse zu spezifischen Verhaltensweisen und situativen Bedingungen im Kontext einer depressiven Störung. Anschließend erfolgt eine solide Fallkonzeptualisierung, welche in einer fundierten Therapieplanung mündet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erkrankung: Depressive Störungen
- 2.1 Das Krankheitsbild depressiver Störungen
- 2.2 Die Prävalenz und Geschlechtsunterschiede depressiver Störungen
- 2.3 Die ätiologischen Konzepte depressiver Störungen
- 2.3.1 Die biologischen Modelle
- 2.3.2 Die lerntheoretischen und kognitiven Modelle
- 2.3.3 Die sozialen Faktoren
- 2.3.4 Das psychodynamische Krankheitsmodell: Depressiver Grundkonflikt
- 2.4 Zusammenfassung
- 3 Das Fallbeispiel
- 3.1 Die Makroanalyse
- 3.1.1 Das Elternhaus
- 3.1.2 Die Schulzeit
- 3.1.3 Die Ausbildungszeit und der Beruf
- 3.1.4 Die sozialen Kontakte
- 3.1.5 Die Partnerschaft
- 3.1.6 Der Krankheitsbeginn und der Krankheitsverlauf
- 3.1 Die Makroanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit depressiven Störungen. Ziel ist es, das Krankheitsbild, seine Prävalenz, ätiologische Konzepte und ein Fallbeispiel zu analysieren. Die Arbeit bietet einen Überblick über verschiedene Erklärungsmodelle und beleuchtet den Verlauf einer depressiven Erkrankung anhand eines konkreten Fallbeispiels.
- Krankheitsbild depressiver Störungen
- Prävalenz und Geschlechtsunterschiede
- Ätiologische Modelle (biologisch, lerntheoretisch, kognitiv, sozial, psychodynamisch)
- Makroanalyse eines Fallbeispiels
- Krankheitsverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der Arbeit und gibt einen Überblick über die folgenden Abschnitte. Es legt den Fokus auf die Analyse depressiver Störungen und deren Betrachtung anhand eines Fallbeispiels.
2 Erkrankung: Depressive Störungen: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit depressiven Störungen. Es beschreibt das Krankheitsbild, beleuchtet die Prävalenz und Geschlechtsunterschiede und geht detailliert auf verschiedene ätiologische Konzepte ein. Die biologischen, lerntheoretischen, kognitiven, sozialen und psychodynamischen Modelle werden jeweils vorgestellt und diskutiert, wobei deren jeweilige Stärken und Schwächen im Verständnis der Erkrankung herausgearbeitet werden. Die Zusammenfassung dieses Kapitels fasst die zentralen Aspekte der verschiedenen Erklärungsansätze zusammen und bereitet den Leser auf die anschließende Fallstudie vor.
3 Das Fallbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Fallstudie. Die Makroanalyse untersucht verschiedene Lebensbereiche des Patienten, darunter das Elternhaus, die Schulzeit, die Ausbildung, soziale Kontakte, die Partnerschaft und den Verlauf der Erkrankung. Die einzelnen Bereiche werden systematisch analysiert, um einen ganzheitlichen Einblick in die Entwicklung und den Kontext der depressiven Erkrankung zu geben. Die Analyse soll den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Lebensbereichen und dem Auftreten der Depression aufzeigen.
Schlüsselwörter
Depressive Störungen, Prävalenz, Geschlechtsunterschiede, Ätiologie, biologische Modelle, lerntheoretische Modelle, kognitive Modelle, soziale Faktoren, psychodynamisches Modell, Fallbeispiel, Makroanalyse, Krankheitsverlauf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse Depressiver Störungen anhand eines Fallbeispiels
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert depressive Störungen umfassend. Sie untersucht das Krankheitsbild, die Prävalenz, Geschlechtsunterschiede und verschiedene ätiologische Konzepte. Ein detailliertes Fallbeispiel veranschaulicht den Krankheitsverlauf und die Zusammenhänge zwischen Lebensumständen und der Entstehung der Depression.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Krankheitsbild depressiver Störungen, Prävalenz und Geschlechtsunterschiede bei Depressionen, verschiedene ätiologische Modelle (biologisch, lerntheoretisch, kognitiv, sozial, psychodynamisch), Makroanalyse eines Fallbeispiels, und der Krankheitsverlauf einer Depression.
Welche ätiologischen Modelle werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht biologische, lerntheoretische, kognitive, soziale und psychodynamische Modelle zur Erklärung depressiver Störungen. Jeweils werden Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle im Verständnis der Erkrankung diskutiert.
Wie wird das Fallbeispiel analysiert?
Das Fallbeispiel wird mittels einer Makroanalyse untersucht. Diese betrachtet verschiedene Lebensbereiche des Patienten, einschließlich Elternhaus, Schulzeit, Ausbildung, soziale Kontakte, Partnerschaft und den Verlauf der Erkrankung. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen diesen Lebensbereichen und dem Auftreten der Depression aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über depressive Störungen (inkl. Krankheitsbild, Prävalenz, Ätiologie), und ein Kapitel mit der detaillierten Analyse eines Fallbeispiels (Makroanalyse).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Depressive Störungen, Prävalenz, Geschlechtsunterschiede, Ätiologie, biologische Modelle, lerntheoretische Modelle, kognitive Modelle, soziale Faktoren, psychodynamisches Modell, Fallbeispiel, Makroanalyse, Krankheitsverlauf.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Unterkapiteln ist im Dokument enthalten und listet alle Abschnitte der Arbeit auf, von Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnissen bis hin zu den einzelnen Unterpunkten der Kapitel.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Analyse depressiver Störungen interessiert. Die detaillierte Darstellung der ätiologischen Modelle und die Fallstudie eignen sich besonders für Studenten und Wissenschaftler im Bereich Psychologie, Psychiatrie oder verwandten Disziplinen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2024, Psychische und psychosomatische Faktoren der Depression, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1472210