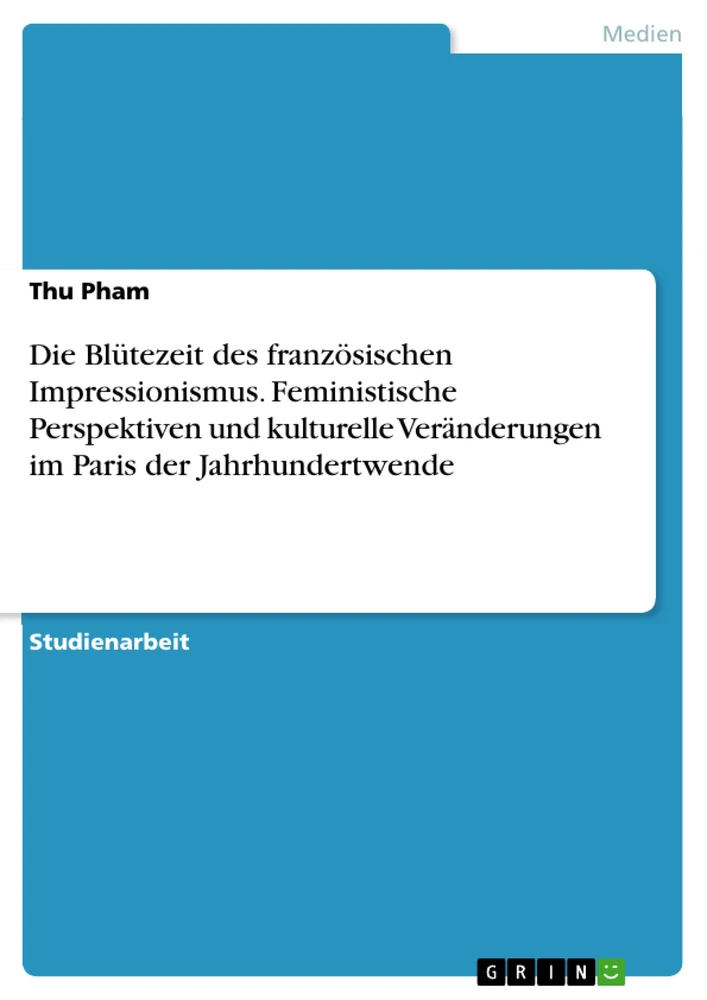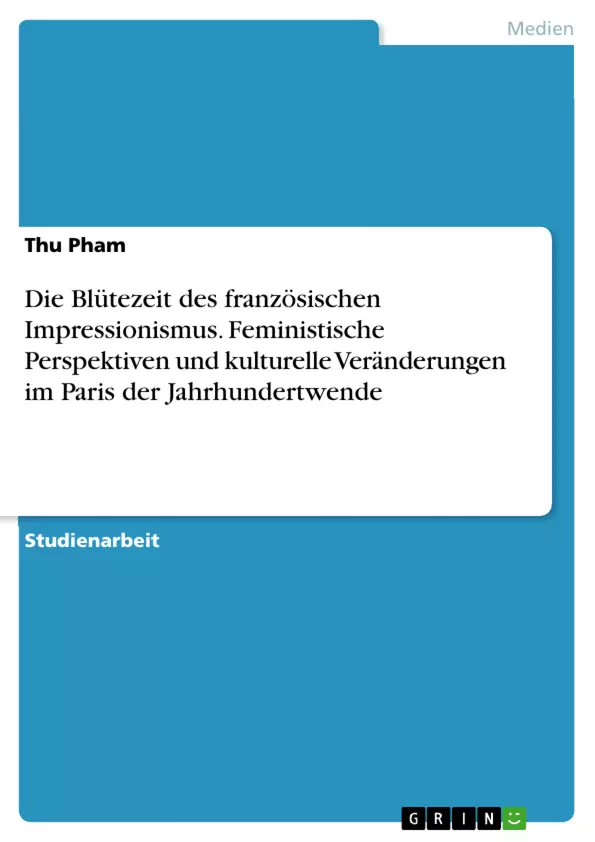Diese Arbeit beleuchtet die kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit Frankreichs, insbesondere in Paris während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, und verbindet sie mit den tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen und der Entwicklung des Impressionismus. Besonderes Augenmerk liegt auf den Werken und Einflüssen von Impressionistinnen wie Berthe Morisot und Mary Cassatt, die durch ihre Kunst gesellschaftliche und klassenbedingte Themen reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gendertheorien in der Kunstgeschichte
- Feminisierte Motive und Stile des Impressionismus
- Frauendarstellungen von impressionistischen Künstlerinnen und Künstlern im Vergleich
- Der Spiegel und das Toilette-Motiv
- Im Theater und in der Oper
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Darstellung von Frauen in der impressionistischen Malerei. Sie beleuchtet zunächst die Entwicklung von Gendertheorien in der Kunstgeschichte, um anschließend die spezifischen Motive und Stile des Impressionismus zu analysieren, die als "weiblich" interpretiert werden können. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie die Darstellung von Frauen in impressionistischen Werken die sozialen und kulturellen Verhältnisse des späten 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
- Entwicklung von Gendertheorien in der Kunstgeschichte
- Feministische Motive und Stile des Impressionismus
- Darstellung von Frauen in impressionistischen Werken
- Sozialer und kultureller Kontext der weiblichen Rolle im späten 19. Jahrhundert
- Vergleich von Frauendarstellungen von impressionistischen Künstlerinnen und Künstlern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und erläutert die Fragestellung, die sich mit der Darstellung von Frauen in der impressionistischen Malerei beschäftigt.
Gendertheorien in der Kunstgeschichte
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung von Gendertheorien in der Kunstgeschichte, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Frau in der Kunstproduktion und -rezeption. Es beleuchtet die traditionelle Sichtweise auf die Frau als Natur und den Mann als Kultur und zeigt, wie diese Dichotomie die Kunstgeschichte beeinflusst hat.
Feminisierte Motive und Stile des Impressionismus
Dieses Kapitel befasst sich mit den typischen Motiven und Stilen des Impressionismus, die als feminisiert interpretiert werden können. Es werden Beispiele für typische Bildthemen des Impressionismus wie Haushaltsführung, Freizeitvergnügungen, Mutter-Kind-Darstellungen und die Darstellung von Frauen in privaten Sphären wie Speiseräumen, Salons und Gärten genannt.
Frauendarstellungen von impressionistischen Künstlerinnen und Künstlern im Vergleich
Dieses Kapitel vergleicht die Darstellung von Frauen in Werken von impressionistischen Künstlerinnen und Künstlern. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Motive "Frauen bei der Toilette" und "Frauen im Theater und in der Oper" und zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf die weibliche Rolle und Identität im späten 19. Jahrhundert auf.
Schlüsselwörter
Impressionismus, Gendertheorie, Frauendarstellung, Kunstgeschichte, Feminismus, soziale Identität, Geschlechterrollen, Moderne, Künstlerinnen, Motiv, Stil, Paris, 19. Jahrhundert, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Marie Bracquemond.
- Arbeit zitieren
- Thu Pham (Autor:in), 2021, Die Blütezeit des französischen Impressionismus. Feministische Perspektiven und kulturelle Veränderungen im Paris der Jahrhundertwende, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1466314